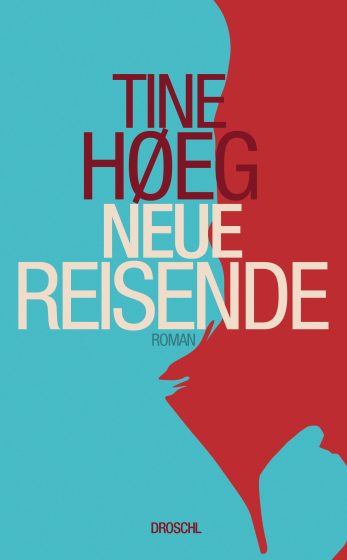
Schon wieder das Blau
Drei Lesehinweise von Ingrid Mylo
Ob man den Inhalt erzählt oder nicht: was passiert ist weniger wichtig als die Art, in der das Passierte abgeliefert wird. Satz unter Satz, manchmal nur Worte, kein Punkt, kein Komma, Sterne manchmal und gelegentlich ein Fragezeichen. In der formalen Verkleidung eines Gedichts rollt der Text über die vielen Seiten des Buches, Sätze zwischen August und Ende Dezember: Gesteinsproben subjektiver Realität, Gedankenmuster, Gefühlspartikel, Gewaltphantasien. Das Ich einer jungen Lehrerin: sie tritt eine neue Stelle an, sie schürft sich an einer neuen Liebe auf, zählt die Male, die sie ihn nackt sieht und unter welchen Umständen, bis 14 kommt sie: dann endet das Buch unter Gräbern. Daß ihre Stirnen was abkriegen, beide, hat sie sich schön ausgemalt: seine beim 9. Mal eine Beule, ihre schon beim 3. Mal blutige Risse durch einen Stacheldraht. Und das Gestreute dazwischen, Organisches unter den Algorithmen, die das Leben simulieren: Fruchtfliegen auf einer überfälligen Birne, der geschriebene und wieder ausradierte Name auf dem Skizzenblock, ein aufgeschwollenes Herz in der Novembersonne, eine überfahrene Katze, Träume von abgebissenenen Fingern, ein Kuß wie zwei sich paarende Waldschnecken, ein Nägelkratzen in der Nacht und am Morgen die Hautschuppen auf dem Boden. „Heiter ist das nicht gerade“, würde Oma Anna aus Marburg sagen. Heiter vielleicht nicht, komisch schon, auffallend allemal. Und dann die Anordnung, die den Sätzen was Striktes gibt: wo sie eh schon was Verschlossenes haben: ganz wie Kassiber. Aber heimtückisch bearbeitete Kassiber: mit ihnen läßt sich nichts mehr rausgeschmuggelt. Oder rein. Weil sie sich vorzeitig auflösen im Körper und ihre verkapselten Botschaften freisetzen wie Gift.
- Tine Høeg: Neue Reisende. Aus dem Dänischen von Gerd Weinreich. Droschl, Wien 2020. Klappenbroschur, 200 Seiten, 19 Euro.
****
„Irgendwie ist die Welt doch nicht zum Aushalten“, sagen sie. Und denken, „was für eine erbärmliche Farce das alles ist“, dieses Leben, das in den Romanen von Elizabeth Strout voller Sorgen und Sehnsüchte ist, Demütigungen zuhauf, Armut und Mißbrauch und jede Menge von dem, was im Englischen so treffend hardship heißt und mit Mühsal oder Plage nur unzureichend zu fassen ist: und dem deutschen Begriff Härte fehlt das Handwerkliche, der pragmatische Umgang mit dem Elend, in dem man manchmal steckt bis zum ungewaschenen Hals. Selbstmord ist eine Möglichkeit, Alkohol eine andere: von beidem wird Gebrauch gemacht. Auch Liebe käme infrage, wäre sie nicht unerwidert, unerwünscht, verheimlicht oder verraten, voller Schuldgefühle und Erbärmlichkeiten. Und vor allem ist da diese Traurigkeit, die die Menschen umhüllt wie ein Tüllkleid, Schichten und Schichten von etwas durchsichtig Zartem, etwas, das schön ist und schmückt und Umarmungen fernhält. Das Gefühl von Verlassenheit ist ihnen vertraut, selbst wenn sie zu zweit sind oder Familie haben: manche haben Angst vor dem Tod, andere nicht: und nach dem Tod tauchen, wie Relikte aus dem schwindenden Packeis, Dinge auf aus der Vergangenheit der Verstorbenen und verändern die Landschaft. Und nichts davon ist tragisch sondern einfach und selbstverständlich und so real wie der Rost auf der alten Karre oder der Sonnenstreifen auf dem Schreibtisch oder die Mauer, an der man sich den Kopf einrennt, immer wieder. Es ist das Leben, zum Teufel, und anders als die deutschen Romane mit ihrem Wehleid und Gewinsel und dem heiligen Gejammer, mit ihrer Ergriffenheit und ihrer Ehrfurcht vor dem Unglück, macht hier niemand eine große Nummer daraus.
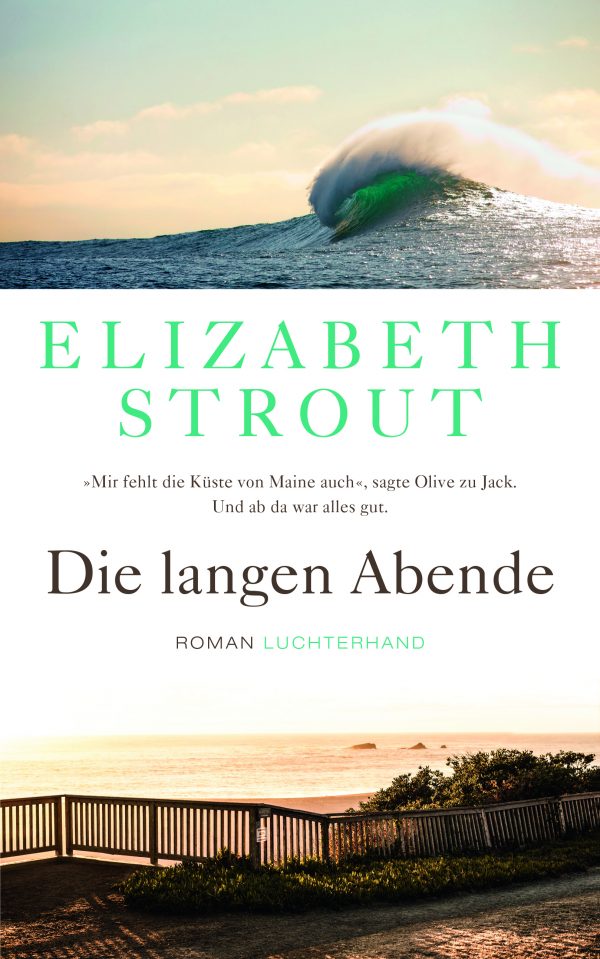
„Wir armen Menschen“, schreibt Elizabeth Strout: das klar umrissene Mitgefühl für Lebewesen, die dazu angehalten wurden, die ganze Scheiße halbwegs mit Anstand zu ertragen. Müde machen andere Dinge, die Wiederholungen, die Farblosigkeiten, der Überdruß, mit dem man feststellt, daß man ständig die verwelkten Blüten aus den blaßblauen Petunien zupfen muß, die man in einen hohlen Baumstumpf gepflanzt hat. Ja, wir armen Menschen: als hätte Elizabeth Strout beim Schreiben den ganzen Tag Townes Van Zandt gehört. Gehört, wie er ‚Gone Too Long‚ singt oder ‚No Place to Fall‚ oder ‚Waitin’ Round to Die’ oder in einem anderen Lied die Zeile vom betrunkenen Clown. Wenn er davon singt, daß er am Morgen da sein wird, heißt das: gerade mal bis zum Morgen: bevor er wieder unterwegs ist, dorthin „where the lonely road is taken me“, auf der Suche nach der nächsten Flasche, dem nächsten Spiel, dem nächsten Schuß, auf der Suche nach Liebe und auf der Flucht vor ihr, ein warmes Bett, singt er, sei den ganzen Schmerz nicht wert: und am Ende hat nichts eine Bedeutung. „All that i’ve done // all that i’ve said // means nothing to me // i’d soon be as dead // all of this world be forgotten„. Seine Poesie bringt die Menschen zum Weinen, seine Fans sitzen in den Irrenhäusern und Gefängnissen, Townes Van Zandt zu hören, lindert ihre Verzweiflung. „No words of comfort // no words of advice // nothing to offer a stranger„. Dieser Song, sagt seine Frau, als sie das liest, „is so beautiful.“ Townes‘ Antwort: „Song my ass … That’s a suicide note.“
- Elizabeth Strout: Die langen Abende (Olive, Again, 2019). Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth. Luchterhand Verlag, 2020. Hardcover, 352 Seiten, 20 Euro
****
Schon wieder das Blau: in diesem Buch riecht es nach Bittermandeln. Es streute Vernichtung und brachte Madonnen zum Leuchten auf den Gemälden, Jahrhunderte zuvor, und Schrödinger erschien es in Hunderten tanzender Flammen.
Wurde das Blau von einem Teufel erschaffen: oder verwandelt es den, der es erschuf, in einen Teufel?
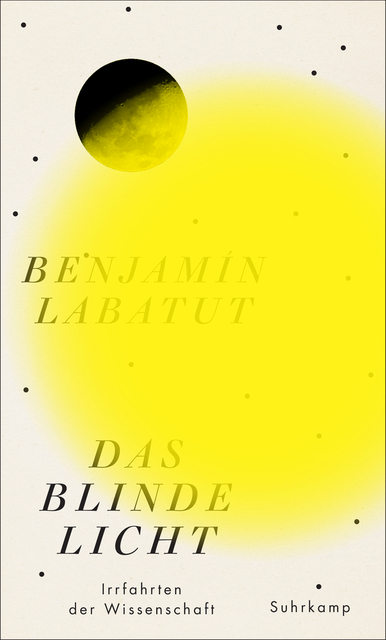
Neugier, die zu Erfindungen führt: was folgt, ist Vernichtung. Weiß man das immer? Macht man dennoch weiter? Einer hat es nicht getan, hat die Formel verbrannt anstelle der Menschen.
„Heute hat niemand mehr Zeit für die Ewigkeit“, schreibt Benjamin Labatut, und schon 119 Seiten davor denkt er nach über den „folgenschweren Tod der Sterne“.
Er reicht, wie bei einem Kinderspiel, eine Farbe weiter, einen Gegenstand von Namen zu Namen, Johann Conrad Dippel, Napoleon, Rasputin, Alan Turing, Fritz Haber, Hitler: was haben sie miteinander zu tun. Eine Kette von Schicksalscherben: und all die Toten dazwischen.
Beinschwarz – Schwarzschild – Schildläuse
Oft hängt Nebel in den Seiten, wirklicher und metaphorischer, und oft werden Hautverwüstungen beschrieben: es gibt zwischen allem einen Zusammenhang. Auch wenn man den Faden, der durch das Labyrinth führt, nicht fortwährend sieht: am Ende steht man am Ausgang. Der einst ein Eingang war.
Wissenschaftler, die „wie Schlafwandler auf die Apokalypse zuwanken“, sagte Alexander Grothendieck.
Zeiten, in denen eine Sekunde so lange dauert, daß man alt wird und älter und fürchtet zu sterben, bevor man ihr Ende erreicht. Zeiten, zerdehnt: bis die Konzentration nichts ist als ein hauchdünner Schleier, zu insubstanziell für einen einzigen Gedanken. Und Zeiten, da zieht einem die Raserei der Stunden den Boden unter den Füßen weg: wie sehr man auch rennt und um sich schlägt, man kommt nicht von der Stelle.
Wissen und die Darbietung von Wissen und darin eingewebt: Bruchstücke von Gedichten, Worte, die das Grauen fassen wie Edelmetall geschliffene Steine.
- Benjamin Labatut: Das blinde Licht. Irrfahrten der Wissenschaft. Aus dem Spanischen von Thomas Brovot. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 187 Seiten, 22 Euro.
© 2020 ingrid mylo











