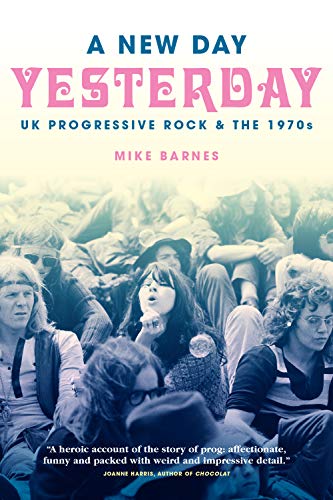
Das Musikbuch „A New Day Yesterday“ von Mike Barnes
Mein erstes Rockkonzert fand am 23. April 1973 statt. Emerson, Lake and Palmer gastierten in der Halle Münsterland. Warum sich mein jugendliches Interesse ausgerechnet auf dieses Trio konzentrierte, obwohl mir andere Bands besser gefielen, liegt vielleicht daran, dass es in meinem Freundeskreis schon reichlich Deep Purple- oder Jethro Tull-Fans gab. Die musikalischen Eskapaden des Keyboard-Maniacs Emerson und seiner zwei Mitstreiter den eingängigeren Tönen anderer Rockgruppen vorzuziehen, war ein Alleinstellungsmerkmal, auf das man als intellektuell ambitionierter Vierzehnjähriger nicht verzichten mochte. Dass man mit Van der Graaf Generator, Soft Machine oder Caravan einen größeren Distinktionsgewinn hätte erzielen können, wusste ich noch nicht. In meinem Fachblatt, der vom Schweizer Journalisten Jürg Marquard herausgegebenen Zeitschrift Pop, kamen diese Bands höchstens am Rande vor.
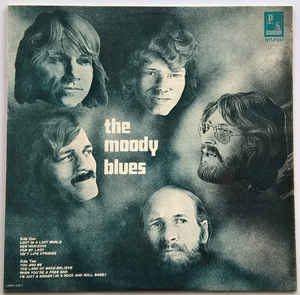
Dort hatte ich aber, ungefähr zur gleichen Zeit, eine enthusiastische Besprechung des Moody Blues-Albums „Seventh Sojourn“ gelesen, kaufte es mir gemeinsam mit einer Best-of-Kompilation von Keith Emersons vormaliger Gruppe The Nice und war so begeistert, dass ich es auswählte, als ein musikbegeisterter Lehrer uns bat, Lieblingsplatten mit in den Unterricht zu bringen. Leider fiel sein Urteil über die zugegeben recht sentimentalen Songs ziemlich harsch aus, während ein Klassenkamerad, der King Crimsons „Larks‘ Tongues in Aspic“ vorspielte, ein Kompliment ob seines guten Geschmacks einheimsen durfte. Die popmusikalische Sozialisation in den frühen siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war manchmal ein harter Lernprozess. Dabei galten seltsamerweise alle der oben genannten Bands als „progressiv“, womit sie sich zumindest in unserer Wahrnehmung positiv von den als „kommerziell“ verschrienen Glamrock-Bands wie T. Rex und Sweet unterschieden. Ein formidabler, aber notwendiger Irrtum, denkt man an das Bedürfnis junger Menschen nach einem klar strukturierten Weltbild.

Woher das Attribut „progressiv“ in Bezug auf Musik stammt, lernte ich erst durch die Lektüre des just erschienenen pophistorischen Werkes „A New Day Yesterday“ (nach dem Jethro Tull-Song). Auf mehr als 600 Seiten widmet sich der britische Journalist Mike Barnes der Geschichte der „progressiven“ Rockmusik im Vereinigten Königreich. Und schon im ersten Kapitel erfahren wir, dass Chris Welch vom englischen Melody Maker für sich in Anspruch nimmt, den Begriff 1967 zum ersten Mal benutzt zu haben, um den Sound der Band Cream zu beschreiben. Barnes selbst erinnert sich, dass 1968 im New Musical Express vom „progressive pop“ der Small Faces die Rede war. Nicht sehr beliebt ist die Kategorie allerdings bei den vielen Zeitzeugen, die für das Buch Rede und Antwort gestanden haben, zwingt sie doch eine Vielzahl von unterschiedlichen Musikstilen unter einen Hut. Gibt es (außer dem gemeinsamen Label Virgin) tatsächlich Parallelen zwischen den von kompromisslosem Kunstwillen geprägten atonalen Platten einer Band wie Henry Cow und Mike Oldfields kommerziell erfolgreichen Debütalbum „Tubular Bells“? (Dass Oldfield bei den Aufnahmen zum ersten Henry Cow-Album als Toningenieur einsprang, ist eine der vielen netten Anekdoten, mit denen Barnes aufwarten kann.)
Tatsächlich lässt sich „A New Day Yesterday“, allen musikologischen Exkursen zum Trotz, vor allem als eine große Erzählung mit vielen interessanten Protagonisten beschreiben. Einer von ihnen, der Pianist und Sänger Gary Brooker, auch heute noch mit seiner Band Procol Harum unterwegs, spielte bereits als Teenager in einer mäßig erfolgreichen Coverband und beschloss mit Anfang zwanzig, von nun an seine eigenen Songs zu schreiben. Das war 1966, zu einer Zeit, die, wie er sagt, „einen Punkt in der britischen Musikgeschichte markiert, von dem an man tun konnte, was man wollte“. Alle Grenzen schienen aufgehoben, und wenn es sie gab, wurden sie einfach ignoriert. Und das mit Erfolg: Bereits die erste Single, die Brooker mit seiner neuen Band aufnahm, wurde ein Welthit: „A Whiter Shade of Pale“. So viel zur Frage „progressiv“ oder „kommerziell“. Der Song war künstlerisches Statement und hitparadentauglich zugleich.
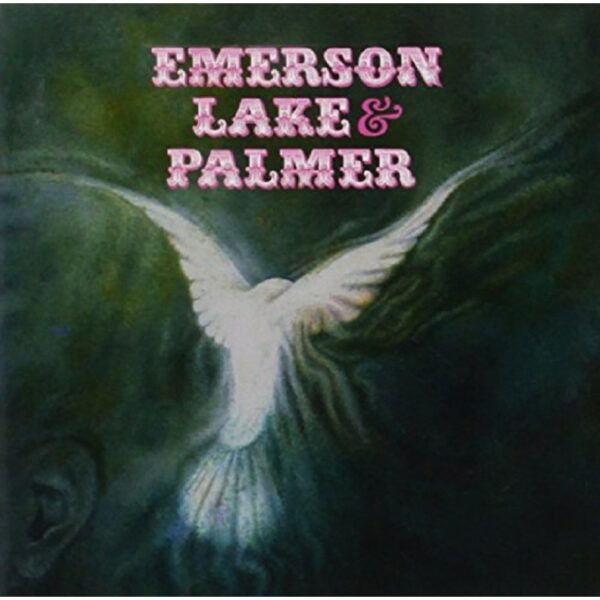
Bis in die zweite Hälfte der siebziger Jahre lässt sich der Höhenflug des „progressive rock“ verfolgen, dann bereitete ihm die Drei-Akkord-Ästhetik des Punks ein unrühmliches Ende. Endlich, so liest man es auch heute noch, wurde der „Bombast-Rock“ von ELP, Yes, Pink Floyd und Konsorten als Pseudokunst entlarvt und der ursprüngliche rebellische Geist der Rockmusik war zurück. Aber auch dieses beliebte Narrativ entpuppt sich bei näherem Hinsehen als unterkomplex. Mit spürbarer Genugtuung erzählt Mike Barnes von dem jungen Mann mit grün gefärbtem langen Haar und einer Vorliebe für Hawkwind und Van der Graaf Generator, der von dem geschäftstüchtigen Impresario Malcom McLaren als Sänger einer auf kommerziellen Erfolg getrimmten Punkband engagiert wurde. Name der Combo: The Sex Pistols. Name des Sängers: Johnny Lydon aka Johnny Rotten. „I Was a Punk Before You Were a Punk”, heißt ein satirischer Song der Tubes von 1978. Dass es sich bei manchem Punk tatsächlich um einen Hippie mit kurz geschnittenen Haaren handelte, passte nicht ins Marketingkonzept.
Für Mike Barnes ist die kurze Blütezeit jenes vielfältigen Phänomens, das man bis heute progressiven Rock nennt, eine der kreativsten Phasen in der Geschichte der populären Musik. Da mag man nach der Lektüre seines Buches ungern widersprechen. Dann kommt der Hörtest. Und ich muss gestehen: So schlecht klingen Emerson, Lake and Palmer gar nicht.
Joachim Feldmann
- Mike Barnes: A New Day Yesterday. UK Progressive Rock & the 1970s. Omnibus Press, London 2020. 616 Seiten, 20 Pfund.











