 Denkverbot
Denkverbot
„Auch bei der RAF könnte es Personen mit sehr unterschiedlichem Informationsstand gegeben haben. Es finden sich Anzeichen dafür, dass es inzwischen dem einen oder anderen der ehemaligen Terroristen dämmert, dass ihre verbrecherischen Aktionen auch anderen Zielen gedient haben könnten als denen, die ihnen damals ihre unmittelbaren Anführer verkündeten.“
Michael Buback: Der zweite Tod meines Vaters
Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter wurden am 7. April 1977 in Karlsruhe ermordet. 32 Jahre später ist noch immer nicht klar, wer geschossen hat. Michael Buback, Professor für Physikalische Chemie, präsentiert nun eine „Denkmöglichkeit“, von der er befürchtet, „dass sie nahe an der Wahrheit liegt“. Das ist schmerzhaft für ihn als Sohn. Denn als er feststellen muss, dass die Ermittlungen irritierende Lücken aufweisen, wird sein Grundvertrauen in den Rechtsstaat fundamental erschüttert. Der zweite Tod meines Vaters rührt an die „Schweigekartelle“, die es auch außerhalb der RAF gebe, wo die Analyse des Verbrechens dann aber unvermittelt verstummt.
Damit hat Michael Buback als „sekundäres Opfer“ wohl einen der gewagtesten Beiträge zur RAF verfasst, weil er als „Laie“ bis zu einem Bereich vordringt, der bis heute tabuisiert wird: Das Hineinwirken von Geheimdiensten in die Terrorgruppe. Seine „Denkmöglichkeit“ entblößt, will man ihrer Logik folgen, lediglich die Spitze eines Eisbergs. Um nicht als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt zu werden, bricht Buback jedoch an dem Punkt ab, wo das Denkverbot überwunden wird: „Wie unsagbar bitter, wenn im Tausch gegen Informationen für Geheimdienste auf Strafverfolgung der Mörder verzichtet worden wäre, wenn man meinen Vater wie eine Handelsware benutzt und missbraucht hätte.“
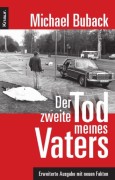 Auch heute noch ein ungeheuerlicher Gedanke, ruft man sich die Bilder des Staatsbegräbnisses vor Augen. Eigentlich müsste dieser hochspannende Bericht, der in sich schlüssiger wirkt als mancher sauber konstruierte Krimiplot, jetzt die Republik erschüttern. Denn die Hauptforderung des Postmillenniums, „keine Denkverbote“ mehr zuzulassen, hat hier nachhaltig Wirkung gezeitigt. Was wäre, wenn wir die angebotene Denkmöglichkeit „realisieren“ würden (im neudeutschen Doppelsinn, also sowohl „wahrnehmen“, als auch „verwirklichen“)? Nichts wäre. Wissen ohne Macht, darin hat Michael Buback leider recht, hat noch keine Berge versetzt. Und der bloße Glaube noch weniger. Vielleicht ist die Zurückweisung der Denkverbote ja nichts anderes als das, was Herbert Marcuse vor einem halben Jahrhundert bereits „repressive Toleranz“ nannte: In Gesellschaften, in denen subtile Machtungleichgewichte herrschen, führt ideologische Großzügigkeit stets zur Bekräftigung des Bestehenden. Niemand hat das scharfzüngiger kommentiert als Markus Werner in seinem Roman Zündels Abgang (1984): „Das Bestehende sehnt sich danach, von euch gefickt zu werden, und eure Erzieher sehnen sich danach, euch dabei zuzuschauen. Und je routinierter ihr euch anstellt, umso entspannter, umso wohlwollender, umso strahlender wird ihre Miene.“
Auch heute noch ein ungeheuerlicher Gedanke, ruft man sich die Bilder des Staatsbegräbnisses vor Augen. Eigentlich müsste dieser hochspannende Bericht, der in sich schlüssiger wirkt als mancher sauber konstruierte Krimiplot, jetzt die Republik erschüttern. Denn die Hauptforderung des Postmillenniums, „keine Denkverbote“ mehr zuzulassen, hat hier nachhaltig Wirkung gezeitigt. Was wäre, wenn wir die angebotene Denkmöglichkeit „realisieren“ würden (im neudeutschen Doppelsinn, also sowohl „wahrnehmen“, als auch „verwirklichen“)? Nichts wäre. Wissen ohne Macht, darin hat Michael Buback leider recht, hat noch keine Berge versetzt. Und der bloße Glaube noch weniger. Vielleicht ist die Zurückweisung der Denkverbote ja nichts anderes als das, was Herbert Marcuse vor einem halben Jahrhundert bereits „repressive Toleranz“ nannte: In Gesellschaften, in denen subtile Machtungleichgewichte herrschen, führt ideologische Großzügigkeit stets zur Bekräftigung des Bestehenden. Niemand hat das scharfzüngiger kommentiert als Markus Werner in seinem Roman Zündels Abgang (1984): „Das Bestehende sehnt sich danach, von euch gefickt zu werden, und eure Erzieher sehnen sich danach, euch dabei zuzuschauen. Und je routinierter ihr euch anstellt, umso entspannter, umso wohlwollender, umso strahlender wird ihre Miene.“
Uta-Maria Heim
Michael Buback: Der zweite Tod meines Vaters.
München: Droemer Knaur 2008. 368 Seiten. 19,95 Euro.











