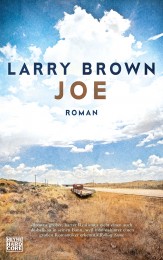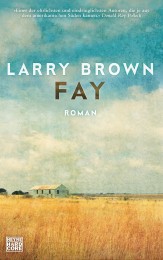Der Süden vergisst die seinen nicht
Zur Rezeption von Larry Brown – Von Marcus Müntefering.
Mehr als ein halbes Jahrhundert musste nach ihrem Tode vergehen, bis Flannery O’Connors –wenn auch bis zur Unkenntlichkeit verfremdetes – Antlitz 2015 auf einer Briefmarke des U.S. Postal Service prangte. Ein viertel Jahrhundert dauerte es nach dem Ableben William Faulkners, bis 1997 vor dem Rathaus von Oxford, Mississippi, die Bank errichtet wurde, auf der der Nobelpreisträger seitdem als regungslose Statue die Ewigkeit genießt. Larry Brown hingegen, wie die beiden Vorgenannten einer der großen Chronisten des Lebens in den US-amerikanischen Südstaaten, wurde bereits zwölf Jahre nach seinem frühen Tod im Alter von 53 eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Yalobusha Brewing Company benannte 2016 ein Bier nach dem Schriftsteller: „Larry Brown Ale“ hat einen Alkoholgehalt von 6,4 Prozent, auf dem Etikett ist – na klar – eine Schreibmaschine zu sehen, und alle Gewinne gehen an die Feuerwehr von Oxford, für die Brown 16 Jahre lang im Einsatz war, bis er schließlich vom Schreiben leben und seine Familie ernähren konnte.
Hierzulande wird Brown gerade erst entdeckt, aber auch in den USA gibt es Nachholbedarf. Verglichen mit Faulkner oder O’Connor hatte er wenig Erfolg – „Joe“ verkaufte sich in Amerika rund 20.000 Mal, sein größter Erfolg „Fay“ etwa 40.000 Mal –, aber vielleicht verehren ihn seine Leser mit größerer Leidenschaft. Denn Brown, von Kritikern zum „King of White Trash“ gekrönt, ist weder so unzugänglich und schroff wie Faulkner, noch so sardonisch distanziert wie O’Connor. Seinen Geschichten, auch wenn sie uns in die finstersten Abgründe der menschlichen Seele führen, merkt man jederzeit seine Zuneigung zu seinen Figuren an. Joe zum Beispiel ist ein Trinker und troublemaker, aber er ist im Grunde ein guter Mensch.
„A Good Man is Hard to find“ heißt eine der berühmtesten short storys O’Connors. So bitter und wahr diese Erkenntnis sein mag, Brown zeigt uns, dass es möglich ist, etwas Gutes in fast jedem Menschen zu finden (Garys Vater Wade einmal ausgenommen). Diese Einstellung, diese – wie der Schriftsteller Rick Bass einmal über Brown sagte – Unschuld und Zärtlichkeit verwandeln Larry Browns Leser in Liebhaber. In seinen Geschichten haben die Marginalisierten, die Ausgestoßenen, die Randständigen einen Platz im Zentrum. Auch wenn er sie am Ende nicht retten kann: Er verschafft den Verstummten Gehör, gibt den Machtlosen Kraft, den Würdelosen ein wenig von ihrer Selbstachtung zurück.
In der Vorbereitung auf diesen Text habe ich mit mehreren Autoren aus dem amerikanischen Süden korrespondiert. Sie alle verehren Larry Brown, und die meisten von ihnen nennen „Joe“ ihr Lieblingsbuch. William Boyle, Autor einiger außergewöhnlicher Brooklyn Noirs, schrieb: „Ich habe Joe das erste Mal mit Anfang 20 gelesen. Der Roman hat in mir den Wunsch geweckt, so über den Ort, aus dem ich stamme, zu schreiben wie Brown über die Gegend um Oxford: so mutig, so komplex und mit ebenso viel Herz.“ Tom Franklin, der mit der Westerngroteske „Smonk“ und mit „Krumme Type, Krumme Type“ zuletzt auch in Deutschland Aufmerksamkeit erregte, findet „Joe“ so meisterlich, weil es der von Browns Romanen sei, der am ehesten den Minimalismus seiner Kurzgeschichten mit den üppigen Schilderungen der Landschaften Mississippis verbinde. Und für Joe R. Lansdale war Brown ein Schriftsteller, der die Menschen in all ihren Facetten beschrieben hat, dessen Figuren immer auf den Punkt waren und der genau die Geschichten geschrieben hatte, die ihm am Herzen lagen.
Ähnlich sieht es Browns Biografin Jean W. Cash: „Browns Figuren sind echte Menschen, mit all ihren Stärken und Schwächen. Abgehängte Südstaatler, die versuchen in einer Welt zu überleben, die ihren Hoffnungen feindlich gegenübersteht. Das gilt in besonderem Maße für Joe Ransom, der aber auch an seiner Vorliebe für Alkohol und Gewalt scheitert.“
Angeklebte Etiketten
Larry Brown war nicht das, was man einen geborenen Schriftsteller nennt. Erst mit 29 Jahren begann er mit dem Schreiben, in der Hoffnung auf ein besseres Auskommen für sich und seine Familie. Als Feuerwehrmann schob er 48-Stunden-Schichten, und in den paar Stunden, die er zwischendrin frei hatte, verdiente er sich in diversen Jobs etwas hinzu. Er suchte den großen Erfolg, wie ihn Stephen King hatte, eines seiner Vorbilder zu Beginn seiner Karriere als Autor. Wobei von Karriere zunächst keine Rede sein konnte. Er schrieb short storys und Romane, ebenso unermüdlich wie unveröffentlicht. „Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat“, sagte Brown einmal über seine frühen Jahre als Schriftsteller. „Grauenhaft“ seien viele seiner Geschichten von damals, voller sex & crime, wie der Roman über einen menschenfressenden Bären, der im Yellowstone Park seinen Blutdurst stillt. Später, in „Big Bad Love“, einer 1990 veröffentlichten Sammlung von Kurzgeschichten, machte er sich über diese Zeit lustig: „The Apprentice“ erzählt von einer Frau, die so verzweifelt von dem Gedanken besessen ist, Schriftstellerin zu sein, dass ihre Ehe darüber in die Brüche geht – im richtigen Leben konnte sich Brown auf die Unterstützung seiner Frau Mary Annie verlassen, auch wenn sie Brown oft tagelang nicht zu Gesicht bekam, weil er entweder am Schreibtisch saß und schrieb oder in irgendeiner Spelunke abstürzte.
Sieben Jahre dauerte es, bis sich Browns Mühen und Mary Annies Nachsicht auszahlten. Mit „Facing the Music“ wurde ein erster Band mit Kurzgeschichten veröffentlicht, was ihn ermutigte, seinen Job zu kündigen und Vollzeitschriftsteller zu werden. Doch inzwischen war er als „der schreibende Feuerwehrmann“ berühmt geworden, auch weil er viele Interviews in seiner alten Wache gegeben hatte. Gegen dieses Image anzugehen, war eine Herausforderung, zumal sein Verlag Algonquin Books keinerlei Interesse an einer Korrektur hatte. Doch Brown hatte inzwischen als Autor seine eigene Stimme gefunden und schrieb statt über Killerbären darüber, was er kannte und liebte – die einfachen Menschen des amerikanischen Südens. Und er wollte Anerkennung bekommen für seine Romane und short storys, nicht für sein Leben.
Doch nicht nur das Etikett Feuerwehrmann wurde Brown angeklebt – als Schriftsteller, der in William Faulkners Wahlheimat Oxford, Mississippi, geboren wurde, musste er damit leben, wahlweise als würdiger Nachfahre oder Epigone des berühmten Vorgängers tituliert zu werden. „Mr Faulkner und ich haben nicht viel gemeinsam, außer das wir über dieselbe Art von Menschen aus derselben Gegend schreiben“, sagte Brown in einem Interview Mitte der Neunzigerjahre. Und er wehrte sich mit der stärksten Waffe, die ein Autor zur Verfügung hat: Literatur. In der satirischen Kurzgeschichte „Discipline“, ebenfalls aus „Big Bad Love“, gibt es ein Gefängnis, in dem Schriftsteller einsitzen, die sich des Plagiats für schuldig gemacht, vor allem bei Flannery O’Connor und – schauriger Höhepunkt von „Discipline“ – Faulkner abgeschrieben haben.
Mit den Jahren, und Romanen wie „Joe“, „Father and Son“ oder „Fay“, schrieb Brown sich frei von den ungeliebten Vergleichen. Immer seltener hieß es über ihn, er sei „ein Faulkner für das 21. Jahrhundert („Vanity Fair“). Stattdessen wurde er als „einer der wichtigsten Autoren der USA“ gerühmt oder als Schriftsteller, der „sein eigenes, frisches Tattoo auf den starken rechten Arm der Südstaatenliteratur gestochen hat“. Und Bestsellerautor John Grisham, der auf einer Farm Nähe Oxford lebt, schrieb anlässlich der posthumen Veröffentlichung von Browns letztem, unvollendetem Roman „A Miracle of Catfish“: „Larry Browns einzigartige Stimme lebt weiter. Er würde wollen, dass wir lesen und lachen und weinen und ein Bier auf sein Andenken trinken.“
 „The Rough South of Larry Brown“
„The Rough South of Larry Brown“
Diese „einzigartige Stimme“ zog um die Jahrtausendwende auch einen jungen, ambitionierten Filmemacher in ihren Bann. Gary Hawkins, der ein Jahrzehnt zuvor eine Doku über Browns großes Vorbild Harry Crews gemacht hatte, traf Brown 2000 und drehte mit ihm den Film „The Rough South of Larry Brown“, eine Mischung aus Interviewschnipseln und Dramatisierungen mehrerer von Browns short storys. Die Gespräche mit Brown und seiner Frau (letztere entstanden teilweise nach dem Tod des Autors) geben einen tiefen Einblick in diese ebenso raue wie herzliche Südstaatenwelt. Erst nachdem ich den Film gesehen hatte, verstand ich die tiefe Zerrissenheit von Browns tragischen Helden wirklich, verstand, warum sie sehenden Auges in ihren eigenen Untergang gehen. Wie Brown selbst wollen sie stets das Gute, aber oft stehen sie sich selbst im Weg. Und sie sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen, sich anzupassen an eine Gesellschaft, die nichts für sie bereithält. Brown hat exzessiv und obsessiv gelebt, getrunken, geraucht, gearbeitet, alles immer am Anschlag. Dass am Ende seine Frau Mary Anne und seine Kinder zu Opfern einer konsequenten künstlerischen Selbstverwirklichung wurden, klingt in Hawkins’ Dokumentation nur an. Glamourös sei das Leben an der Seite eines Schriftstellers nun wirklich nicht gewesen, sagt Mary Annie einmal: „Am glücklichsten war Larry, wenn er schrieb, und kreuzunglücklich, wenn er es nicht tat.“
Kurz nach seinem Treffen mit Larry Brown schrieb Gary Hawkins ein Drehbuch, basierend auf „Joe“. Erst rund zehn Jahre später wurde ein Film daraus. Auch wenn Regisseur David Gordon Green die Handlung von Mississippi nach Texas verlegte und das Ende, anders als im Roman, reichlich melodramatisch geraten ist – die Verfilmung wird der Vorlage gerecht. Weil Autor und Regisseur es verstanden haben, Browns Figuren in all ihrer Widersprüchlichkeit zu adaptieren. Und weil Hauptdarsteller Nicolas Cage – einer von Browns Lieblingsschauspielern – die wohl beste Leistung seiner Karriere abruft. Dass „Joe“ in den USA gerade einmal die Hälfte seiner Herstellungskosten von läppischen vier Millionen Dollar einspielte und in Deutschland gar nicht erst ins Kino kam, sondern auf DVD als Actiondrama mit dem Untertitel „Die Rache ist sein“ veröffentlicht wurde – wie könnte es anders sein. Schließlich war auch der Autor der Vorlage niemand, der jemals den Erfolg hatte, den er verdient gehabt hätte.
Marcus Müntefering
Larry Brown: Joe (1991). Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Mit einem Nachwort von Marcus Müntefering. Heyne Hardcore, München 2018. Hardcover mit Schutzumschlag, 352 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen hier.
Siehe auch Alf Mayer über „Fay“ und Larry Brown: Schreib, was du weißt und kennst.
Larry Brown: Fay (2000). Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Heyne Hardcore, München 2017. 656 Seiten; 24 Euro. Verlagsinformationen hier. Besprechung im DLF hier.