 Film, Verbrechen und ungleiche Mittel
Film, Verbrechen und ungleiche Mittel
Max Annas über den Film „Acı“ von Regisseur Yilmaz Güney.
Ich habe ein großes Herz für Filme, die jenen, die sie gemacht haben, gewaltigen Ärger mit der Macht einbringen. „Acı“ ist so ein Film, besser: einer aus einer ganzen Reihe von Werken, die Yilmaz Güney in den frühen 1970ern gedreht hat. „Der Schmerz“ lautet der Titel übersetzt, und unter den 25 Filmen, die Güney zwischen 1966 und 1983 geschrieben und gedreht hat, sind in manchen Filmographien ganze sieben dem Jahr 1971 zugewiesen. Einer davon ist „Acı“. Die Botschaft des Films ist simpel: Es gibt keine Situation, in der Du den Kampf verloren geben darfst.
Ali, gespielt von Güney selbst, kommt nach fünfzehn Jahren aus dem Gefängnis. Sein Weg führt ihn zum Haus von Avanos (Mehmet Büyükgüngör), dessen Sohn er ermordet hatte. Vater und Tochter Zelha (Fatma Girik) weisen ihn zurück, als er anbietet, den Verlust des Sohnes durch Arbeit wiedergutzumachen. Zelha schlägt ihn gar nieder. Weil sie befürchten, dass er dabei getötet worden ist, erhält er trotzdem eine Lagerstatt im Haus. So beginnt die Geschichte. Was wir sehen: Ein Überlandbus hält an einer staubigen Straße. Von der Haltestelle ist der Weg weit in die Berge zu Avanos und Zelha. Viele Leute bemerken ihn, einige von ihnen sind erstaunt, andere empört darüber, dass er sich wieder blicken lässt. Jemand läuft in die nächste Stadt. Dort wissen bald alle davon, dass Ali zurück ist. Wir lernen Haceli (Hayati Hamazoglu) kennen vor seiner Weinkellerei. Die Geschichte spielt in Kappadokien. Was wir hören: In hingeworfenen Dialogstücken erzählen Leute in der Stadt davon, dass Ali sehr jung war, als er Avanos´ Sohn tötete. Haceli soll der Auftraggeber gewesen sein. In der Folge geriet Haceli in den Besitz des Feldes, das zu jener Zeit dem Sohn gehörte. Der Konflikt ist vorbereitet. „Acı“ dauert bis hierhin noch keine zehn Minuten.
 Mit wenigen Strichen kommt Güney auch fortan aus. Ali wacht auf, misstrauisch beäugt von Vater und Zelha. Ali bringt sich ein und arbeitet auf dem Feld. Ali wird akzeptiert und isst mit den beiden. Vor allem Zelhas Blick auf Ali verändert sich. Aus Hass wird zuerst Neugier, dann Begehren. In der Stadt diskutieren derweil Haceli und seine Untergebenen, was mit Ali zu tun sei. Haceli will nicht ertragen, dass Ali mit dem Gegner paktiert. Ali trifft sich in der Stadt mit Hacelin, dann ist alles gesagt. Genau 30 Minuten läuft der Film, als Haceli mit seinem Anhang auf Ali und Avanos wartet, den Ali mittlerweile Baba nennt, Vater. Bis hierhin haben wir ein dicht inszeniertes Drama gesehen mit beindruckenden Furchen in Landschaft und Gesichtern. Das hätte Güney so weiter erzählen können bis zu einem Ende, an dem jemand getötet wird in einem hitziger werdenden Streit oder einer heimtückischen Abrechnung. Aber solche Filme hat Güney nicht gemacht. Jedenfalls nicht damals. Haceli und seine Leute warten auf Ali und den alten Mann, als die beiden gerade von der Feldarbeit kommen. Haceli warnt Ali. Ali widerspricht. Einer der Kollegen Hacelis greift ihn daraufhin körperlich an, Ali schlägt ihn nieder. Aus der Konfrontation geht Hacelis Bande siegreich hervor. Schließlich liegt der alte Mann tot am Boden, Ali ist schwer verletzt. Er hat sein Augenlicht verloren.
Mit wenigen Strichen kommt Güney auch fortan aus. Ali wacht auf, misstrauisch beäugt von Vater und Zelha. Ali bringt sich ein und arbeitet auf dem Feld. Ali wird akzeptiert und isst mit den beiden. Vor allem Zelhas Blick auf Ali verändert sich. Aus Hass wird zuerst Neugier, dann Begehren. In der Stadt diskutieren derweil Haceli und seine Untergebenen, was mit Ali zu tun sei. Haceli will nicht ertragen, dass Ali mit dem Gegner paktiert. Ali trifft sich in der Stadt mit Hacelin, dann ist alles gesagt. Genau 30 Minuten läuft der Film, als Haceli mit seinem Anhang auf Ali und Avanos wartet, den Ali mittlerweile Baba nennt, Vater. Bis hierhin haben wir ein dicht inszeniertes Drama gesehen mit beindruckenden Furchen in Landschaft und Gesichtern. Das hätte Güney so weiter erzählen können bis zu einem Ende, an dem jemand getötet wird in einem hitziger werdenden Streit oder einer heimtückischen Abrechnung. Aber solche Filme hat Güney nicht gemacht. Jedenfalls nicht damals. Haceli und seine Leute warten auf Ali und den alten Mann, als die beiden gerade von der Feldarbeit kommen. Haceli warnt Ali. Ali widerspricht. Einer der Kollegen Hacelis greift ihn daraufhin körperlich an, Ali schlägt ihn nieder. Aus der Konfrontation geht Hacelis Bande siegreich hervor. Schließlich liegt der alte Mann tot am Boden, Ali ist schwer verletzt. Er hat sein Augenlicht verloren.
 Jetzt wird aus „Acı“ der Film, den nie vergessen wird, wer ihn je gesehen hat. Der alte Mann ist tot, die Banditen haben ihre Macht gezeigt. Der Film allerdings gehört ab jetzt ganz Ali und Zelha. Beide übernehmen Rollen, die ihnen nicht eingeschrieben waren. Ali hat mit dem Verlust seiner Sehkraft die Fähigkeit verloren, Vergeltung zu üben. Zelha ist dieselbe, die kurz zuvor noch den alten Vater versorgt hatte, und der ein Leben zustand, das über diese Pflege nicht hinausging. Und doch ist sie eine ganz andere. Alis Ankunft hat vieles, der Tod des Vaters alles verändert. Nach wenigen Bildern, die Ali in der Folge von Hacelis Überfall verletzt zeigen, hocken Zelha und Ali zusammen. Ali formuliert die Rache, die er nicht ausführen kann – oder jedenfalls nicht allein. Und Zelha zeigt den letzten Rest, der ihr von der eingeübten Rolle geblieben ist. Sie warnt davor, den gefährlichen Weg zu gehen. „Wer soll das rächen außer uns?“, fragt Ali. „Du bist jetzt meine Arme, Flügel und das Licht meiner Augen.“ – „Lass uns weggehen von hier“, sagt Zelha zurück. „Die sind unser Verderben.“ – „Bring mir eine Glocke“, verlangt Ali von ihr.
Jetzt wird aus „Acı“ der Film, den nie vergessen wird, wer ihn je gesehen hat. Der alte Mann ist tot, die Banditen haben ihre Macht gezeigt. Der Film allerdings gehört ab jetzt ganz Ali und Zelha. Beide übernehmen Rollen, die ihnen nicht eingeschrieben waren. Ali hat mit dem Verlust seiner Sehkraft die Fähigkeit verloren, Vergeltung zu üben. Zelha ist dieselbe, die kurz zuvor noch den alten Vater versorgt hatte, und der ein Leben zustand, das über diese Pflege nicht hinausging. Und doch ist sie eine ganz andere. Alis Ankunft hat vieles, der Tod des Vaters alles verändert. Nach wenigen Bildern, die Ali in der Folge von Hacelis Überfall verletzt zeigen, hocken Zelha und Ali zusammen. Ali formuliert die Rache, die er nicht ausführen kann – oder jedenfalls nicht allein. Und Zelha zeigt den letzten Rest, der ihr von der eingeübten Rolle geblieben ist. Sie warnt davor, den gefährlichen Weg zu gehen. „Wer soll das rächen außer uns?“, fragt Ali. „Du bist jetzt meine Arme, Flügel und das Licht meiner Augen.“ – „Lass uns weggehen von hier“, sagt Zelha zurück. „Die sind unser Verderben.“ – „Bring mir eine Glocke“, verlangt Ali von ihr.
Der nächste Schnitt bringt uns zu einem Bild, in dem eine Glocke an einer Vogelscheuche hängt, eine weitere an einer anderen, und an der nächsten schon wieder eine Glocke. Wir sehen Scheuche und Glocke, dazu jeweils die Kordel, die aus dem Bild heraus führt. Sie – nicht etwa der Wind – bewegt die Glocke. Und am Ende der Kordel sitzt Zelha. Wir sehen die Scheuchen, dann die Landschaft, schließlich Zelha und Ali, die eine agierend, der andere lauschend. Wer den Plot nicht kennt, muss rätseln, wie der Plan mit den Glocken wohl ausgehen wird. Tatsächlich ist es ein faszinierendes Spiel zu sehen, wie Ali lernt, sich neu zu orientieren. Die Glocke ist Anreiz und Orientierung, sie öffnet den Raum Alis komplett neu – und der muss von vorn anfangen. Ganz von vorn. Güney nimmt sich viel Zeit, diesen Raum zu zeigen, in dem sich Zelha und Ali bewegen. Wobei es eigentlich Zelha ist, die sich mehr bewegt. Ali horcht, dreht sich und den Kopf, sucht seine Position zu verstehen. Erst langsam erobert er sich das neue Terrain. Schwankend, auf den Stock gestützt, zwischen Geröll und Felsen, Gestrüpp und getrampelten Pfaden. Langsam lernt er, die Position der Glocken zu bestimmen in seinem neuen System der Orientierung, umgreift sie fest, wenn er sie findet, um ihnen den hellen Klang zu nehmen als Zeichen des Triumphes.
 Zunächst sind die Glocke und ihr Klang der Anreiz für Ali, sich in Bewegung zu setzen, Schritt für Schritt zu machen, in sein neues Leben zu balancieren und sich auf unbekanntem Terrain aufrecht zu halten. Aber in einer Sekunde verändert sich das. Der Reiz, den er wahrnimmt, entstammt plötzlich nicht mehr der Glocke, sondern der, die sie bedient. In einer Situation zwischen den Lektionen, streift Zelha eine Glocke, die wie zufällig an einem Strauch aufgehängt ist. Ihr Klang ist der gleiche, den sie auch vorher produziert hatte. Aber nicht für Zelha und Ali. Beide erkennen die neue Situation auf ihre Weise. Zelha lockt Ali mit der Glocke, der folgt ihr, wie er es vermag, vorsichtig, tastend, mit ausgestrecktem Arm. Als er dabei seine Hand auf Zelhas Brust legt, zieht er sich unsicher zurück. Aber Zelha folgt ihm und schlingt ihre Arme um ihn. Dann zieht sie Ali hinter einen großen Ginsterstrauch. Die Kamera bleibt, wo sie ist.
Zunächst sind die Glocke und ihr Klang der Anreiz für Ali, sich in Bewegung zu setzen, Schritt für Schritt zu machen, in sein neues Leben zu balancieren und sich auf unbekanntem Terrain aufrecht zu halten. Aber in einer Sekunde verändert sich das. Der Reiz, den er wahrnimmt, entstammt plötzlich nicht mehr der Glocke, sondern der, die sie bedient. In einer Situation zwischen den Lektionen, streift Zelha eine Glocke, die wie zufällig an einem Strauch aufgehängt ist. Ihr Klang ist der gleiche, den sie auch vorher produziert hatte. Aber nicht für Zelha und Ali. Beide erkennen die neue Situation auf ihre Weise. Zelha lockt Ali mit der Glocke, der folgt ihr, wie er es vermag, vorsichtig, tastend, mit ausgestrecktem Arm. Als er dabei seine Hand auf Zelhas Brust legt, zieht er sich unsicher zurück. Aber Zelha folgt ihm und schlingt ihre Arme um ihn. Dann zieht sie Ali hinter einen großen Ginsterstrauch. Die Kamera bleibt, wo sie ist.
Diese ausgespielte Szene körperlicher Annäherung ist kein Selbstzweck. Sie ist das Ende einer erzählenden Linie, die sich durch den Film gezogen hatte und einer Auflösung bedurfte. Die Blicke Alis und Zelhas aufeinander hatten sich schon verändert, als Ali noch zu sehen in der Lage gewesen war. Hier geschah also, was beide wollten, und dass Zelha die aktive Rolle in dem Spiel übernimmt, ist im Sinne des Dramas leicht damit zu erklären, dass sie noch sieht und Ali eben nicht. Aber sie nimmt Ali nicht nur an die Hand, um ihm den kürzesten Weg zu einem grünen Bett zu zeigen. Sie lockt ihn, und sie weiß, was sie tut. Sie übernimmt keine Rolle, die ihr zugefallen ist, sondern sie wählt aus, Ali zu führen und zu verführen. Und also ist das, was folgt in „Acı“, gebaut auf Nähe und Intimität, auf Vertrauen und der Sehnsucht, zu überleben, gemeinsam zu überleben.
 Der Schnitt von der Szene danach im grünen Bett führt zum Schlüssel des Showdowns. Das Essenspaket, das Zelha öffnet, bringt zuerst zwei Brote zum Vorschein. Darunter ist ein weiteres Tuch zu sehen, darin ein Revolver und etliche Patronen. Die beiden haben nicht erst seit der Liebesszene die Konfrontation hinter sich gelassen, die ihre erste Begegnung charakterisierte. Aber die Liebesszene ist der Träger für das, was nun kommt. Ali hat schon viel gelernt, seit er in dem Kampf erblindete. Jetzt lernt er auch noch zu schießen. Und zu treffen. Zelha souffliert. Und sie fliegt so sicher zwischen die Felsen und durch sie hindurch wie die beiden Protagonistinnen Kaneto Shindos in dessen Räuberinnendrama „Onibaba“ durch das hohe Schilf.
Der Schnitt von der Szene danach im grünen Bett führt zum Schlüssel des Showdowns. Das Essenspaket, das Zelha öffnet, bringt zuerst zwei Brote zum Vorschein. Darunter ist ein weiteres Tuch zu sehen, darin ein Revolver und etliche Patronen. Die beiden haben nicht erst seit der Liebesszene die Konfrontation hinter sich gelassen, die ihre erste Begegnung charakterisierte. Aber die Liebesszene ist der Träger für das, was nun kommt. Ali hat schon viel gelernt, seit er in dem Kampf erblindete. Jetzt lernt er auch noch zu schießen. Und zu treffen. Zelha souffliert. Und sie fliegt so sicher zwischen die Felsen und durch sie hindurch wie die beiden Protagonistinnen Kaneto Shindos in dessen Räuberinnendrama „Onibaba“ durch das hohe Schilf.
Der Showdown selbst eröffnet viele Möglichkeiten, ihn zu deuten. Natürlich geht es um jene Vergeltung, die in den Dialogen so präsent ist. Aber daneben lässt sich die Konfrontation zwischen Ali und Zelha auf der einen Seite und Hacelis Leuten auf der anderen auch als Aufstand lesen. Ein kleine Gruppe, zu allem entschlossen trotz der Widrigkeiten, in denen sie gefangen zu sein scheint, bekämpft einen übermächtigen Gegner. Übermächtig ist er in der Tat. Da sind vier Männer, bewaffnet und gewohnt, die Waffen zu benutzen. Und da sind Ali und Zelha, er blind, sie nicht an der Waffe trainiert. Die Glocken setzt Zelha nun kreativ ein, eine wirft sie einem der Gangster sogar an den Leib, damit Ali ihn mit Kugeln durchlöchern kann. Die Choreografie Zelhas und Alis ist eine des Vertrauens. Das Bild vom blinden Vertrauen hat selten so gut gepasst wie hier.
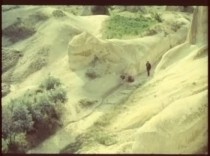 Aber auch andere Motive durchziehen den Showdown. Der Aufstand lässt sich leicht lesen als einer, der gegen die Mehrheitsgesellschaft gerichtet ist, dargestellt durch eine Gruppe von Mördern, die Land besitzt. Kappadokien ist eine Gegend, die von vielerlei Leuten geprägt ist, und die Produktion von sowie der Handel mit Wein war zum großen Teil in griechischer Hand. Jedenfalls noch in der Zeit vor dem Zypernkrieg, der 1974 begann. Möglicherweise ist der Film durchzogen von der Ahnung, was bald geschehen würde. Die griechische Bevölkerung wurde vertrieben, der Weinhandel war fortan in türkischer Hand. Und Avanos ist ein griechischer Name.
Aber auch andere Motive durchziehen den Showdown. Der Aufstand lässt sich leicht lesen als einer, der gegen die Mehrheitsgesellschaft gerichtet ist, dargestellt durch eine Gruppe von Mördern, die Land besitzt. Kappadokien ist eine Gegend, die von vielerlei Leuten geprägt ist, und die Produktion von sowie der Handel mit Wein war zum großen Teil in griechischer Hand. Jedenfalls noch in der Zeit vor dem Zypernkrieg, der 1974 begann. Möglicherweise ist der Film durchzogen von der Ahnung, was bald geschehen würde. Die griechische Bevölkerung wurde vertrieben, der Weinhandel war fortan in türkischer Hand. Und Avanos ist ein griechischer Name.
„Acı“ wird hier und dort mit Italo-Western verglichen, und sicher hat Güney davon ein wenig genascht. Die Art, den Zoom zu benutzen und die mitunter deklamatorische Musik mögen dafür stehen. Hans-Christoph Blumenberg hat Güney einmal mit Pasolini verglichen, dabei hat der einen ganz anderen Blick auf die in ganz anderen Realitäten lebenden kleinen Leute gehabt. Sicher fänden sich im italienischen Kino Bilder, die Verwandtschaften zu jenen Güneys aufweisen: Wie die Präsenz von Gesichtern in Viscontis „Ossessione“ etwa. Oder die selbstverständliche Lässigkeit, mit der Haceli vor seinen Untergebenen über deren Bild in der Öffentlichkeit und – im Fall des Falles – im Knast referiert, das sind Motive, die man ähnlich bei Petri oder Rosi fände. Aber letztlich hat Güneys Erzählwut, getragen von seiner politischen Wut, eine ganz eigene Qualität. Seine Filme stellen einen individuellen Aufbruch dar, die Sprengung einer Filmindustrie, die ein Unterhaltungsmonster gewesen war, bis er sich ihr angenommen hatte. Die tiefe Feindschaft, die er sich dadurch zugezogen hat, liegt auch darin begründet, dass Güneys Plan war, diese Maschine von innen her zu zerstören. Von einem der populärsten Schauspieler des Landes zum Staatsfeind mit einer Handvoll Filme. Und Staatsfeinde – das sehen wir gerade – braucht die herrschend Klasse der Türkei bis heute.
Max Annas
Acı; Regie und Drehbuch: Yilmaz Güney; Türkei 1971; Kamera: Gani Turanli; Musik: Metin Bükey; DarstellerInnen: Yilmaz Güney, Fatma Girik, Mehmet Büyükgüngör, Hayati Hamazoğlu











