
Maurer, Dichter, Shigulimann
Wendezeit ist Dichterzeit: Jedenfalls für einen so begnadeten Autor wie den 1963 in Gera geborenen Lutz Seiler. Nach seinem grandiosen „Kruso“ (2014, Deutscher Buchpreis) nun also „Stern 111“ (Leipziger buchpreis 2020). Statt Flucht-Visionen der Hiddensee-Kommune nun also Berliner Umbruch-Aufbruch-Abbruch-Szenarios mit eigenwilligen Außenseiter-Typen. Carl taucht nach dem Fall der Mauer und dem „Weggang“ der Eltern in den Westen in die turbulente Berliner Nachwendezeit ein, als Häuser besetzt wurden, um sie bewohnbar zu machen. – Von Peter Münder.
Im „Heimathafen der Gedichte“ fühlte sich der Lyriker Lutz Seiler („im federlatein“, 2010) immer am wohlsten; kein Wunder also, dass sein Rückblick auf die mühselige Entstehung seines ersten Romans „Kruso“ eine Chronik qualvoller Agonie, hilfloser Archivsortierungsversuche zwischen 14 Bücherkisten und Dutzenden von Ordnern sowie intensiven Krisenbewältigungsphasen wurde: „Alles, was ich las, war genauso grau und stumpf wie das Papier der Akten – oder es hypnotisierte mich“, schrieb der Villa Massimo-Stipendiat in seinem Rückblick „Von Rom nach Hiddensee“ (Die Zeit, 26. Nov. 2015): Besonders die archivierten 400 Blatt zum „Diensthundewesen“ hypnotisierten und beschäftigten ihn extrem: Die adligen Namen der Grenzhunde schwirrten ihm lange im Kopf herum, aber Berry von der Schweizerhütte, Tell von Vogelhaus oder Ondra von Hildekloster erwiesen sich dann doch als unergiebig für Kruso“ – trotz Berrys Leidenswegs durch Grenzhundekasernen von der Berliner Mauer bis nach Mannheim. „Der Stoff war interessant, die Faszination des Faktischen wirkte, ergab aber keinen Sinn für mein Schreiben“, resümierte Seiler. Erst nachdem ihm bei einem Konzert in Rom Krusos väterlicher Russen-General mit nassen Hosen als markant-groteskes Phantom-Bild erschienen war und seine lange Hiddensee-Blockade in einen fulminanten Schreibfluss verwandelte, konnte er Bildern stärker vertrauen als allen Plänen und Recherche-Unterlagen.
Der russische General spielt also in Kruso eine Rolle, während die besondere „Sensibilität der Grenzhunde“ nun in „Stern 111“ thematisiert wird und die Konflikte unter den Besetzergruppen „Freie Republik Utopia“, „Vereinigte Linke“ und „Autonome Aktion“ anheizt. Während Carl als Maurer-Realo Wände verputzt und Asseln in den Beton drückt („Ihr müsst jetzt versteinern, kleine Freunde, in zehntausend Jahren wird man Euch finden“), wollen die auf Klassen- und Häuserkampf fixierten Fundis die bewährten DDR-Grenzhunde unbedingt auf ihrer Seite haben, wenn gegen kapitalistische Ausbeuter, Skins und Fascho-Horden gekämpft würde: „Nirgendwo auf dieser Welt wird es ein lebendiges Wesen geben, das besser vorbereitet wäre für unseren Kampf“, erklärt der Comandante, „..es liegt in ihrer Natur, wenn man selbst bereit ist dafür, wenn man nicht nur saufen und ficken will.“
Es ist dieser Mix von magischem Surrealismus und gesellschaftskritischen Szenarios, der Seilers Romane so unwiderstehlich macht. Plumpes Besserwisser-DDR-Bashing aus bequemer dreißigjähriger Distanz ist jedenfalls nicht seine Sache. Er orientiert sich eher an „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ und dessen Faible für Künstlerfiguren, mit denen er am liebsten auf ihren Theater-Tourneen mittingelt.
Go West, Forget the Rest?
Vielleicht ist Seiler auch vom geheimnisvollen Harfner im „Wilhelm Meister“ inspiriert worden, dessen Glissando-Klänge alle Zuhörer bezaubert und inspiriert? Denn Carls Vater schickt er mit einem Akkordeon auf dem Rücken und der Parole „Go West“ auf seine Reise nach Westen – und der wird ja nicht nur als PC-Experte und Dozent für Computersprachen anerkannt, sondern auch als Musiker, der sogar amerikanische Bill Haley- und Boogie-Melodien im Repertoire hat. Und die unkompliziert-temperamentvolle Inge tanzt dazu! Kein Wunder, dass Carl angesichts dieser rosigen Perspektiven für das elterliche Traum-Paar den gar nicht so ironisch gemeinten Spruch absondert, „Die Eltern sollen es mal besser haben“. Die erinnern sich sogar noch an ihre Ausflüge mit dem Carl dem Kleinen im Kinderwagen, als sie das „Stern 111“-Kofferradio dabei hatten, um mit der Welt da draußen in Kontakt zu bleiben und Musik zu hören.
Vater und Sohn verbindet das Faible für das schneeweiße Shiguli-Prachtvehikel, an dem sie oft zusammen bastelten. Es ist ein russischer Lizenzbau des Fiat 1100 Kompaktautos (1,2 Liter Hubraum, 60 PS, in der DDR damals für drei Jahresgehälter eines Arbeiters erhältlich).Wenn Walter den Motor einstellte und wartete, wirkte er wie ein „Motorenflüsterer“ – diese intensive Hingabe an technische Raffinessen und die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug hat Carl jedenfalls hingebungsvoll internalisiert: Als er sich entschließt, der Tristesse in Gera zu entfliehen und im Shiguli nach Berlin zu fahren, räumt er das komplette Werkzeug in den Kofferraum. So hat er trotz seiner diffusen Zukunftspläne wenigstens eine solide Handwerkerbasis. Und schon bei den ersten Kontakten zum „klugen Rudel“ der Besetzer/Instandsetzer wird er mit dem Spitznamen „Shigulimann“ geadelt.
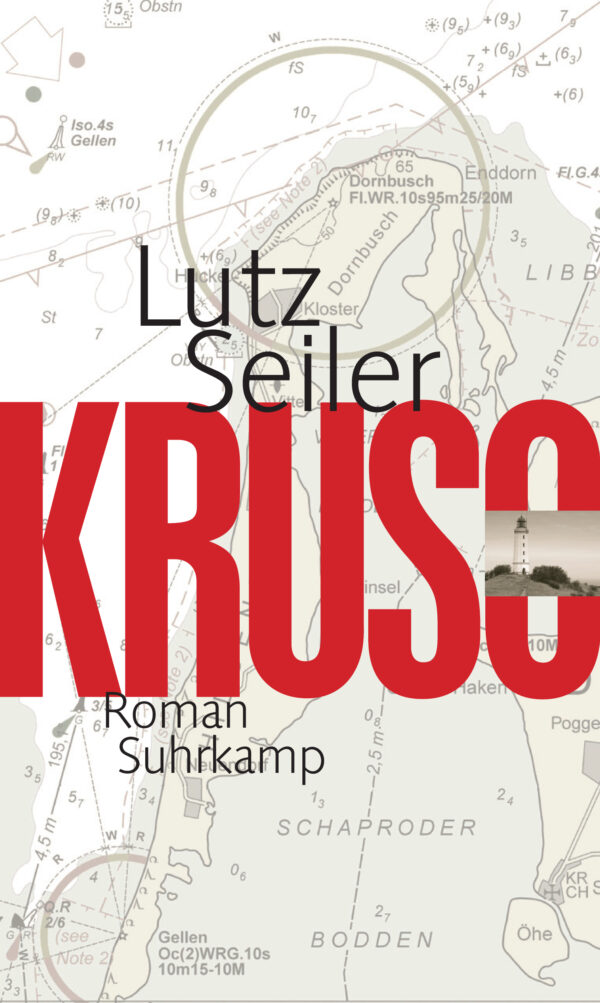
Die Welt als Assel und Panoptikum
Ähnlich wie Edgar in „Kruso“ will auch Carl seinen eigenen Weg finden. Er ist „Maurer auf Wanderschaft“, auf dem Weg zum Dichter-Dasein und kann sofort fachmännisch anpacken beim Renovieren, Ausbauen, Verputzen und dann auch als Kellner aushelfen. Sein Germanistik-Studium in Halle hat er unterbrochen, um seinen Eltern nun im Dezember 1989 bei der Regelung ihres „Weggangs“ zu helfen; aber was Inge und Walter genau planten, kann er nur ahnen. Sie wollen sich in den Westen absetzen, mehr weiß er nicht. Er soll in Gera „das Hinterland sichern“, während Inge und Walter in kleinen Etappen ihren „großen Plan“ verwirklichen und ihm regelmäßig darüber berichten würden.
Ähnlich wie in „Kruso“ gibt es im bunten Haufen der Instandsetzer der „Assel“ und etlichen anderen Keller-Treffs auch einen messianisch anmutenden Hirten mit Guru-Qualitäten und Zirkus-Talenten – nämlich Hoffi: Seine Ziege Dodo hat er so geschickt an einem Stock festgebunden, dass er sie elegant in der Luft herumwirbeln kann. Und die Ziegenmilch ist ähnlich wirkungsvoll wie Krusos „heilige Suppe“ – vor allem, wenn sie mit Wodka angereichert wird. Was die allmählich immer zahlreicher eintreffenden Russen begeistert. Carl trifft hier seine früher aus der Ferne angebetete große Liebe Effi, er hat diverse Techtelmechtel, auch Verkehr mit Nutten, als sich die Club-Kneipen-Szene ändert und immer mehr halbseidene Pseudo-Coole einfinden: Alkis, Kokser, windige Geschäftemacher auf der Suche nach dem großen Deal und Zocker, die auf den schnellsten Kalaschnikow-Baumeister wetten: Bei diesem blitzschnellen Zusammenbau des russischen MGs ist Carl sofort und sehr erfolgreich dabei.

Obwohl der verunsicherte Maurer seinen Weg zum Lyriker allmählich findet, wirft ihn doch – wie es sich für einen tiefer schürfenden Entwicklungsroman gehört – doch Einiges aus der Bahn. Das Paris-Abenteuer mit Effi – natürlich im exotischen Shiguli – ist zwar das große Glück, doch die ganze Beziehungskiste wird für Carl zu kompliziert und undurchsichtig. Und als Carl sich schließlich entschließt, sich „offiziell“ in einer instandgesetzten Wohnung anzumelden, ist er sich überhaupt nicht sicher, ob das vielleicht schon ein Schritt ins verspießerte Bürgertum ist. Jedenfalls ist seine Anarcho-Phase nun abgeschlossen und den Weg zum Dichter-Dasein, den er in Angriff nahm, kann er nun resoluter vorantreiben. Und Carl wird nun endlich seine Ängstlichkeit überwinden, fertige Manuskripte aus der Hand zu geben, mit denen er sich vielleicht „entblößen“ könnte. Der „Höhle für ein poetisches Dasein“ ist er ein gutes Stück näher gekommen; den Rest des Wegs muss er sich allein durchschlagen, ohne die Solidarität verschrobener Kauze.
Ach ja, ein Wiedersehen mit den Eltern in ihrem exotischen El Dorado gibt es auch noch. Aber wo das stattfindet, wird nicht verraten. Für Carl wäre dieses neue Nest in der Ferne auch nichts gewesen. Nach all den Problemen der Eltern in Flüchtlingslagern von Büsum bis Gießen, Diez etc. gönnt man Inge und Walter unbedingt diesen finalen Happy Swing under the Blue Sky!!
Nach „Kruso“ ist dies also Seilers zweiter „Wenderoman“, der eigentlich ein klassischer Entwicklungsroman ist. Das ist so bemerkenswert an Seiler: Er verstrickt sich nicht in parteipolitischen Niederungen/Grabenkämpfen, sondern lässt sich auf die Ostberliner Umbruchzeit und ihre Auswirkungen auf seine fragilen Protagonisten ein. Klischees und Vorurteile werden nicht bedient, seine Figuren sind verletzlich, kauzig, schrill, gehemmt und kreativ und müssen sich gegen die Irrungen/Wirrungen der streckenweise extrem brutalen Wendezeit behaupten. Er entwickelt prägnante Psychogramme und blendet dazu noch magisch-surrealistische Momente ein, die über banale Alltagssituationen eines Mikrokosmos auf eine erhellende Meta-Ebene verweisen. Seiler wagt zudem literarische Balanceakte, die sich zwischen dadaistischer Überraschungsnummer, magisch-surrealistischer Verzauberung und esoterischem Krypto-Shintoismus entfalten. Er ist der Meister im Unterwandern herkömmlicher Erwartungshaltungen und verweigert die plumpe Einordnung in Schubladen mit griffigen Etiketten- meine eigenen Labels (s.o.) sind daher auch nur als prophylaktische Orientierungshilfen zu verstehen.
Kurz und gut: Was zu Zeiten des Kritikerpapstes Reich-Ranicki jahraus, jahrein so sehnlichst beschwört und erwartet wurde – nämlich Der GROSSE DEUTSCHE ROMAN –ihn nun endlich (nach „Kruso“ eigentlich zum zweiten Mal!) Lutz Seiler geschrieben.
Peter Münder
Lutz Seiler: Stern 111. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 528 Seiten, 24 Euro.











