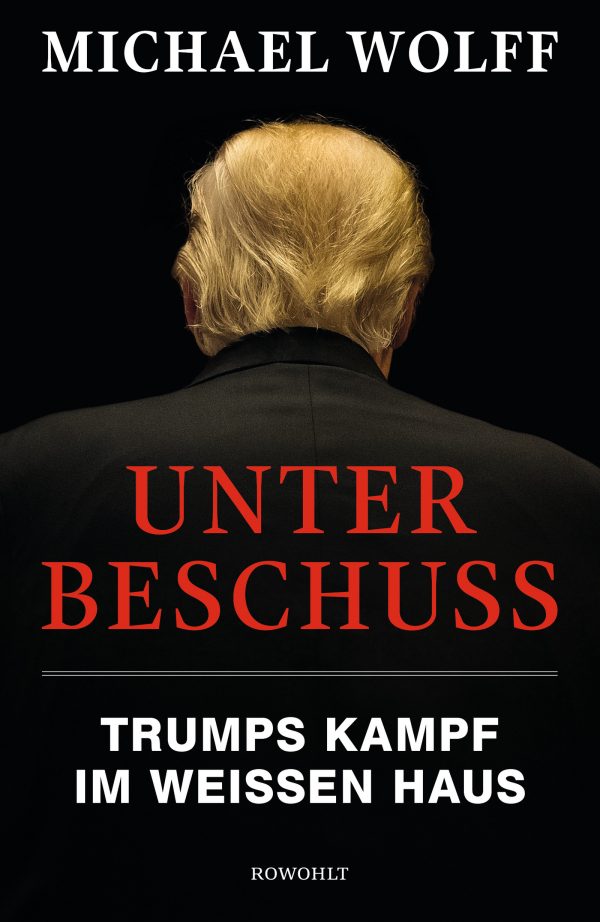
Wo ist der Killer-Anwalt?
Peter Münder über das neue Buch von Michael Wolff
Hatte Michael Wolff in „Fire and Fury“ über das Chaos im Weißen Haus und über den labil-egomanischen und völlig überforderten Präsidenten Trump während des ersten Amtsjahres nicht schon eine glänzende, umfassende Systemkritik sowie ein präzises Psychogramm geliefert? Nun sei im zweiten Amtsjahr des laut Verdikt des ehemaligen Chefstrategen Steven K. Bannon „fucking crazy“ Präsidenten jedoch eine stark veränderte Situation eingetreten, erklärt Wolff im Vorwort zum neuesten Band „Siege“: Viele Trump-Mitarbeiter seien inzwischen gefeuert worden oder aus Frust zurückgetreten; außerdem würden viele Abteilungen im Regierungsapparat gegen Trump arbeiten: Der Präsident sei jetzt einem „Siege“ (Belagerungszustand) ausgesetzt.
Er ist also unter Beschuss und muss mit unangenehmen Ermittlungen und Verfahren – möglicherweise auch mit einem Impeachment – rechnen, die Sonderermittler Robert S. Mueller einleiten könnte. Wolff, 65, ist Magazin-Reporter und sorgte 2008 mit seiner kritischen Biographie über Medien-Mogul „Ruthless Rupert“ Murdoch für großes Aufsehen, weil er den Aufstieg des Australiers im weltweiten Kontext der veränderten Parameter im Print-Sektor analysierte. In „Siege“ (deutscher Titel „Unter Beschuss“) sondiert er die Interessenlage der Hauptbeteiligten in diesem Trump-Zirkus: Familienangehörige, Berater, Anwälte, Kritiker, „beste Freunde“ – sie alle sind meistens völlig perplex, weil sich der ewig twitternde oder vor dem TV-Apparat hockende Präsident so verhält wie ein psychopathischer Alien, dem offenbar niemand etwas anhaben kann. Er will zwar um jeden Preis peinliche Situationen und Erniedrigungen vermeiden, wie der abtrünnige Trump-Kumpel Bannon erklärt – aber er provoziert gerade diese Situationen mit schöner Regelmäßigkeit. Kein Wunder also, dass Wolff sein Interesse am aberwitzigen Trump-Phänomen mit der Faszination erklärt, die ein katastrophales Zugunglück auf Zuschauer ausübt…
Wie kann man aus Trumps Verhaltensmustern überhaupt noch schlau werden? Erratisch, unberechenbar und disruptiv: So lauten die üblichen Etiketten, mit denen Trump-Beobachter seine Sponti-Allüren einordnen. Erst wird dem nordkoreanischen Rocket-Boy gedroht, sein Land mit Feuer und Wut zu überziehen, dann erklärt Trump den Koreaner zum besten Freund, in den er sich „verliebt“ habe.
Unberechenbarkeit hält Trump für ein Indiz der Stärke: Nachdem 140 Mitarbeiter des Gouverneurs von New Jersey Chris Christie ab Mai 2016 sechs Monate lang ausführliche Pläne für einen möglichen Trump-Erfolg bei der Präsidentenwahl ausarbeiteten und für jeden Tag, für jeden neuen Posten präzise Arbeitspläne, Gesetzesvorlagen, Mitarbeiterprofile und neue Projekte vorgeschlagen hatten, überbrachte der mit begeistertem Lob des neuen Amtsinhabers rechnende Christie das dreißig Bände umfassende Mammut-Konvolut. Statt Trump nahm Stratege Steve Bannon die Bände im Trump-Tower in Empfang, die sofort vernichtet wurden. Und Gouverneur Christie wurde mit einem knallharten Hausverbot bedacht: „Wehe, er lässt sich hier nochmal blicken“, lautete die sadistische Reaktion des neuen Präsidenten. Der orientiert sich weder an Plänen noch an Ratschlägen, sondern einfach am eigenen Bauchgefühl, das ihm auch bei schwierigen Deals immer weiter half, wie er schon in seinem Buch „The Art of the Deal“ betonte. Offenbar irritieren den immer auf sich selbst fixierten Trump alle Arten von Strategien, Tagesordnungen und Plänen. Er weigert sich, von Ministern, hohen Militärs oder anderen Mitarbeitern ausgearbeitete Dossiers oder Expertisen zur Lektüre anzunehmen: „Die lösen keine Probleme, sondern sind selbst Teile des Problems“, ist Trump überzeugt. Hinzu kommt aber auch – es ist vielleicht der wichtigste Aspekt dieser Entscheidungsfrage – dass der Dauer-Twitterer Trump nur noch eine Konzentrationsphase von wenigen Sekunden im Griff hat und sich eigentlich kaum etwas merken kann. Und Trumps Allgemeinwissen soll laut dem inzwischen extrem kritischen Bannon kaum noch das Niveau eines Grundschülers erreichen: „Bloß nie fragen, wo Nord-Korea auf der Landkarte zu finden ist“, höhnt Bannon etwa über Trump.
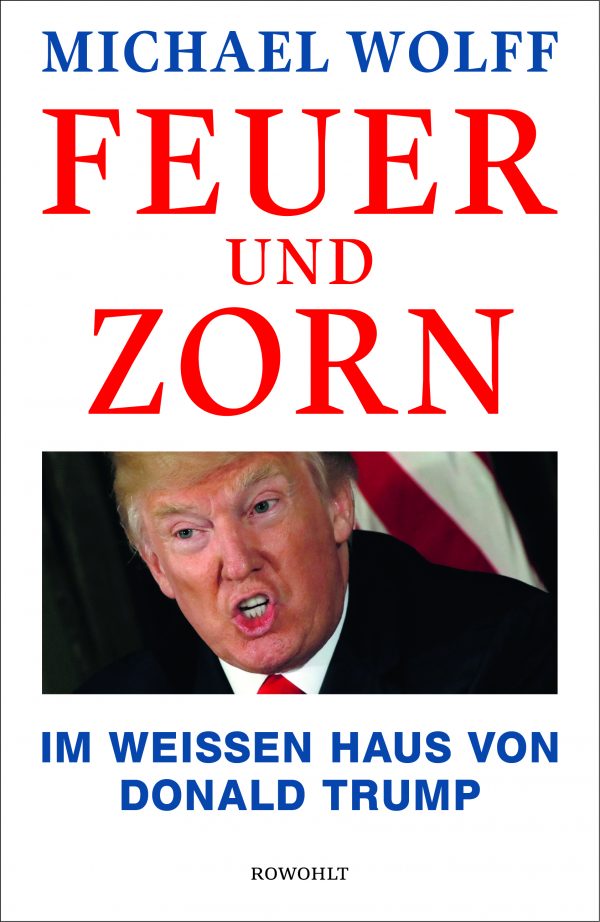
Mein Casino, meine Yacht, mein Hubschrauber
Es ist also ein exotisches, lächerliches und fatales, gefährliches Panoptikum mit potentiell toxischen Auswirkungen, in dem sich Wolff als Beobachter und Analytiker bewegt. Wo sich eben auch der Trend zum Promi-Gossip andeutet und vor allem die amerikanische Sucht vorherrscht, die Dollarzeichen in den eigenen Augen zum Leuchten zu bringen: Viele Photos seiner Status-Symbole in seiner Protzer-Autobiographie „The Art of the Deal“ (1987) hatte Trump im Stil deutscher Bausparkassen-Reklame früherer Wirtschaftswunderjahre mit Hinweisen auf „Mein Haus, meine Yacht, mein Auto“ gehalten. Seine monströse Yacht Nabila gehörte früher Adnan Kashoggi, sein bombastisches Spielcasino in Atlantic City war so insolvent wie der angebliche Milliardär selbst. Er bezahlte vereinbarte Baukosten meistens nur mit großer Verzögerung und mit großen Abschlägen, auf den Buch-Photos posierte er aber unverdrossen „in meiner eigenen Boeing 727“ oder „vor meinem eigenen Hubschrauber“. Und die Bilder der Wolkenkratzer und Modelle signalisieren immer nur: „Ich bin der Größte!“
Aber an dieser Plutokraten-Schiene kommt auch Wolff nicht ganz vorbei, wenn er das Umfeld Trumps beleuchtet und erwähnt, welche Milliardäre wichtige Posten in der Administration übernehmen – und dann bald wieder zurücktreten oder gefeuert werden. Der Boss erwartet von seinen Mitarbeitern eine totale Loyalität, doch er selbst fühlt sich niemandem verpflichtet und lässt andere jederzeit ins Messer laufen, wenn kriminelle Machenschaften oder dubiose Deals auffliegen. Paul Manafort, Robert Cohen u.a. hatten sich auf illegale Aktivitäten zur Unterstützung ihres präsidialen „Freundes“ eingelassen, weil sie auf dessen Unterstützung in kritischen Situationen zählten – doch Trump hat keine Freunde. Was er dringend brauchte, war ein skrupelloser „Killer-Anwalt“: Der sollte ihm alle juristischen Hindernisse, drohende Prozesse usw. aus dem Weg räumen. „Wo ist mein Killer-Anwalt?“, lautete sein Mantra, wenn Gerüchte über bevorstehende Vorladungen und Verhöre im Weißen Haus die Runde machten.
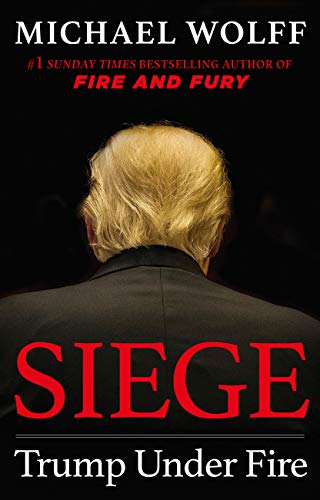
Wie ein geprügelter Hund
Der glänzende Stilist Wolff kann nicht nur wie weiland Alfred Polgar auf einer Glatze Locken drehen; seine Spezial-Disziplin ist das Analysieren und Ausleuchten signifikanter, symbolträchtiger Szenen. Wenn also Trump bei einem Treffen mit Putin (2018 in Helsinki) darauf besteht, trotz der Proteste von Außenminister Pompeo ganz allein und ohne andere US-Amtsträger mit Putin zu sprechen, dann schrillen bei den mitgereisten Mitarbeitern und Experten, die vergeblich versucht hatten, Trump für sein Treffen vorzubereiten, natürlich die Alarmglocken: Gab es da nicht diese peinlichen Vorgeschichten in Moskau – etwa „Pee Gate“, Projekte für ein Trump-Hotel, Videos mit Porno-Szenen usw.? Die entsetzten Berater mussten aber wieder einmal zur Kenntnis nehmen, dass man einem Trump nie widersprechen darf, bzw. davon ausgehen muss, dass dies nur für extremen Frust sorgt.
Als Trump nach dem zweistündigem „Summit“-Gespräch mit Putin zusammen mit dem russischen Machthaber vor die Presse trat, wirkte er laut Bannon „wie ein geprügelter Hund“: Was war passiert? Trump war total gedemütigt, hatte Putin ihm mit Erpressungsmanövern gedroht? Was konnte dahinter stecken? Vom „Pee Tape“ bis zu E-Mail-Ankäufen von Trump Junior, Steuererklärungen und miserablen Schulzeugnissen wurden alle Möglichkeiten erörtert – doch ohne konkrete Ergebnisse. Außerdem hätte Trump sowieso alle möglichen Hinweise als Fake abgetan. Der hilflose Stammler Trump, der sich selbst in seinen Erklärungen widersprach, stand fassungslos vor den Pressevertretern, während Putin wie ein lässiger Terminator auftrat, der gerade eine Fliege zerquetscht hatte – oder wie Wolff es ausdrückt: „Putin was the coolest cat who ever swallowed a canary.“
Doch von den entsetzten Mitarbeitern hörte man nur läppische Kommentare und Nörgeleien – Trumps totale Unfähigkeit, ein Desaster zu vermeiden, wurde vom Hofstaat – wenn auch mit Kopfschütteln und Unverständnis – fast lethargisch hingenommen.
Wolff ist zwar manchmal zu ausführlich auf Klatsch und Tratsch, auf die Marotten einzelner Akteure fixiert. Er verdeutlicht aber auch, dass es Trump vor allem um Phrasen und polarisierende Slogans geht, die von den Medien so gierig aufgenommen und ventiliert werden, dass der eitle Präsident sich vor dem Fernseher mal wieder selbst bewundern kann – an irgendwelchen Lösungen virulenter Probleme ist er einfach nicht interessiert. Der Mauerbau und der Shutdown werden in separaten Kapiteln behandelt, die illustrieren, wie wankelmütig und launisch dieser Präsident agiert. Dass Wolff den Strategen Bannon als Wegbereiter einer reaktionären Ideologie so positiv einschätzt und sich über weite Strecken auf dessen Berichte und Erinnerungen verlässt, liegt daran, dass der laut Wolff weder opportunistisch noch verlogen vorgeht. In seiner Danksagung bezeichnet Wolff ihn als zuverlässigen, hellsichtigen „Vergil“, auf dessen Analysen des Trump-Phänomens er sich verlassen konnte – selbst wenn Bannon sich wohl manchmal wie ein Dr. Frankenstein vorkommen musste, der ein Monster geschaffen hatte, dessen Anblick in ihm extrem ambivalente Gefühle ausgelöst haben müssen.
Der lernresistente Egomane Trump wird sich also weiter auf sein Bauchgefühl verlassen, keinem Konflikt aus dem Weg gehen, alle juristisch relevanten Vorwürfe aus dem Mueller-Report abstreiten – seine Maxime lautet ja „Deny everything“! – und sich früher oder später, wie Michael Wolff betont, selbst zerstören. Wir dürfen daher einen dritten Band von Wolff über den Irren im Weißen Haus erwarten. Vor allem auch wegen der weiteren Auswirkungen des Mueller-Reports: Warum sollte es nur den russischen E-Mail-Hackern an den Kragen gehen? Hatten die Väter der amerikanischen Verfassung in ihren Impeachment-Klauseln nicht auch ein Amtsenthebungsverfahren wegen möglicher Inkompetenz/ Unfähigkeit des Präsidenten vorgesehen? James Madison hatte im 25. Amendment ja genau diese Form der „Incapacity“ als Begründung für ein Impeachment angeführt – bei Trump kämen ja noch andere Aspekte wie Kollaboration mit einer feindlichen Macht, Vetternwirtschaft, Korruption u.a. hinzu.
Jedenfalls vermittelt uns Michael Wolff mit scharfem analytischen Blick nicht nur Einsichten in einen erschreckenden, naiven und verstörenden Jahrmarkt der Eitelkeiten; ihm gelingt auch das Kunststück, aus dem Psychogramm eines Egomanen die fatale Misere einer fehlgeleiteten Politik so facettenreich und bedrohlich darzustellen, dass seine darin enthaltene Systemkritik umso glaubwürdiger wirkt.
Michael Wolff: Siege. Trump under Fire. Henry Holt, New York 2019.
Deutsche Ausgabe: Unter Beschuss. Trumps Kampf im Weissen Haus. Aus dem Englischen von: Werner Schmitz; Hainer Kober; Peter Torberg; Silvia Morawetz; Jan Schönherr; Karsten Singelmann; Stefanie Römer; Gisela Fichtl; Henriette Zeltner; Elisabeth Liebl. Rowohlt Verlag Hamburg 2019. 480 Seiten, 22 Euro.











