
Journalist, Kritiker und Romancier
„Diese unmoderne Persönlichkeit mit unglaublich modernen Ansichten“ (Alfred Kerr)
Selten gab es so ein literarisches Allround-Talent wie Theodor Fontane: Schon als junger Apotheker schrieb er Gedichte und Balladen, wechselte dann als Quereinsteiger zum Journalismus, machte während des Krim-Krieges 1855 PR in London für die preußische „Centralstelle für Preßangelegenheiten“, schrieb für die Berliner „Kreuz“-Zeitung und die „Vossische Zeitung“ Feuilletons und Theaterkritiken, bis er sich dann „im zarten Alter von sechzig Jahren entschloß, ein naturalistischer Dichter zu werden und mit „Irrungen, Wirrungen“ flugs den besten Berliner Roman schrieb“ (Alfred Kerr). Welche Aspekte werden in den vier neuen Fontane-Biographien von D’Aprile, Dieterle, Zimmermann und Rutsch in den Mittelpunkt gestellt? – Ein Essay von Peter Münder.
Selbst Jack Kerouac hätte die „On the Road“-Euphorie wohl beglückt ausgekostet, die Fontane in vielen Texten vermittelt: Diese Aufbruchstimmung, die Gier nach neuen aufregenden Ufern und Naturerfahrungen – nicht nur in der Mark Brandenburg – hatte schon den sechsjährigen Jungen erfasst, der vom Vater auf die nächtliche Kutschfahrt von Neuruppin über Altruppin und Kremmen zum Großvater nach Berlin mitgenommen wird. O-Ton Fontane:
„Ich horchte hoch auf, beglückt in meiner kleinen Seele, die schon damals nach allem, was einen etwas aparten und das nächtlich Schauerliche streifenden Charakter hatte, begierig verlangte… Und wirklich, ich wurde hinaufgereicht und wie ich da ging und stand in den Fußsack gesteckt, der vorn auf dem Wagen lag. In raschem Trabe ging es auf Kremmen zu und lange bevor wir dieses erreicht hatten, zogen die Sterne herauf und wurden immer heller und blitzender. Entzückt sah ich in die Pracht, und kein Schlaf kam in die Augen. Ich bin nie wieder so gefahren; mir war, als reisten wir in den Himmel. Gegen acht Uhr früh hielt unser Gefährt vor dem Haus unseres Großvaters…“ (Fontane: „Meine Kinderjahre“)
Seine Schottland-Tour mit dem Freund Bernhard von Lepel, die Brandenburger Wanderungen, die meistens mit der Postkutsche „erfahren“ wurden, seine gefährliche Exkursion zu französischen Kriegsschauplätzen, die zur Festnahme und Internierung führte und erst nach Bismarcks Intervention noch ein glückliches Ende nahm – all diese Ausflüge waren für Fontane immer auch Expeditionen, die er später literarisch verwerten wollte – egal, ob als Ballade, Reisebericht oder Reportage. Seine Eindrücke hielt er penibel in Notizbüchern fest, die man nun in der großen Fontane-Ausstellung in Neuruppin besichtigen kann.
Hatte dieser schon in Jugendjahren bei Verwandten oder Freunden untergebrachte Autodidakt, der als Apotheker-Lehrling ja ursprünglich in die Fußstapfen des Vaters treten wollte, überhaupt mal für längere Zeit einen stabilen Fixpunkt? Der Vater hatte seine Löwen- Apotheke in Neuruppin beim Kartenspiel verzockt und war lange „on the Road“, um irgendwo in der Provinz mit geliehenem Investitionskapital eine kleinere Apotheke zu finden, die er übernehmen konnte. „Am liebsten wäre er wohl jahrelang mit der Kutsche über Land gefahren – immer auf der Suche nach einer hübschen Apotheke“, meinte Theodor Fontane einmal über dieses unstete Herumfahren des Vaters, das ja fast einer „Quest“ ähnelte – aber die Sympathie des Sohnes für diese ewige Suche des geliebten Vaters ist nicht zu überhören. Als die Eltern sich nach 30jähriger Ehe endlich (ohne Scheidung) trennten, kommentierte Fontane diese ewigen Streitereien zwischen dem lässig-platonischen väterlichen Plauderer und Kartenzocker und der auf rigide Zucht und Ordnung insistierendem Mutter mit Hinweisen auf den 30jährigen Krieg: Er erlebte diese Konflikte offenbar als Vorstudien mörderischer Ehekriegs-Szenarios im Stil eines August Strindberg.
Aber diese Erfahrungen machten Fontane auch zum Experten für aus dem Ruder gelaufene Irrungen und Wirrungen, für verkorkste Beziehungen, unglückliche Ehen oder für eine gnadenlose, rachsüchtige Außenseiterin wie Grete Minde, die laut einer altmärkischen Chronik um 1615 in Tangermünde mehrere Häuser abfackelte, um sich für unerträgliche Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten zu rächen. Fontane bürstete seine Erzählungen eben gerne gegen den preußisch-moralisierenden Strich und entwickelte ein Faible für Plots und Figuren, die gegen tradierte Normen und Erwartungshaltungen angelegt waren. Auch als „Gartenlaube“-Mitarbeiter machte es ihm nichts aus, den spießigen Sittenkodex mit seinen kleinkarierten Richtlinien zu den Themen Liebe, Religion, Politik usw. frontal anzugehen, um zu entlarven, welche Zwänge und Rituale das Gesellschaftssystem im Innersten zusammenhalten. „Auch in erotischer Hinsicht“ sollten nämlich Gartenlaube-Beiträge laut Leitfaden so gestaltet sein, „daß sie auch von jüngeren Mitgliedern im Familienkreise vorgelesen werden können. Auch darf weder eine Ehescheidung noch ein Selbstmord vorkommen.“…
Was schon Jane Austen, die Bronte-Sisters, Flaubert und Tolstoi an der Ehebruch-Thematik faszinierte und was auch „Irrungen, Wirrungen“, „Effi Briest“ und andere zeigen, das war jedenfalls auch für Fontane entscheidend: „Liebesgeschichten in ihrer schauderösen Ähnlichkeit haben was Langweiliges, aber der Gesellschaftszustand, das Sittenbildliche, das versteckt und gefährlich Politische, das diese Dinge haben, das ist es, was mich so sehr daran interessiert“, erklärte er.
In seinem Text-Bauchladen hatte der Journalist, Reporter, Dichter und Romancier Fontane zwar immer mehrere Entwürfe, Rohfassungen und Ideen – aber vom Anbieten des Rohstoffs bis zum Abliefern des fertigen Romans/Reise- oder Kriegs-Berichts konnten mitunter Jahre ins Land gehen: An seinem ersten Roman „Vor dem Sturm“, 1878 veröffentlicht, hatte Fontane zwölf Jahre lang gearbeitet. Da war der 60jährige gerade erst in Schwung gekommen für Novellen und Romane: „Grete Minde“, „L` Adultera“, „Schach von Wuthenow“, „Graf Petöfy“, „Cecile“, „Irrungen, Wirrungen“ und „Steffi Briest“ erschienen erst zwischen 1880 und 1896, das späte opus magnum„Der Stechlin“, wurde 1897 als Vorabdruck und 1898 nach des Autors Tod als Buch veröffentlicht.
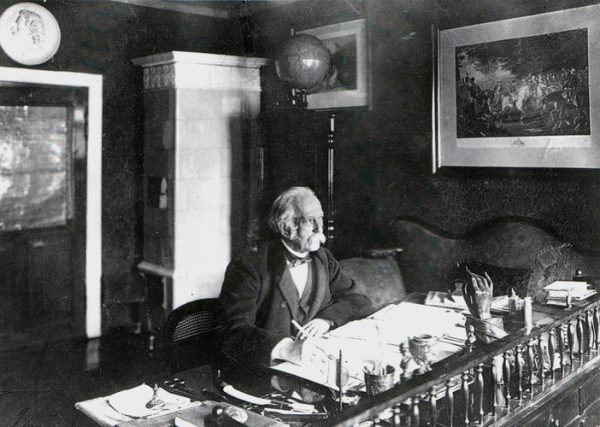
Herkunft/Rechte: Kurt Tucholsky Literaturmuseum (CC BY-NC-SA)
Lebenszeit identisch mit Schreibzeit
Von allen Biographen wird Fontane ja als „schreibsüchtig“ beschrieben. Hans-Dieter Rutsch („Der Wanderer“) bringt es präzise auf den Punkt, wenn er konstatiert, für Fontane war die Lebenszeit identisch mit Schreibzeit. Er feilte auch im Urlaub fast ununterbrochen an Texten, Korrekturen und Korrespondenzen und spannte für das Abschreiben und Korrigieren der Texte seine Frau und die Tochter Martha ein. Die Textmanufaktur Fontane war tatsächlich ein veritabler Familienbetrieb, der sogar noch expandierte, als der Sohn Theodor Junior seinen eigenen Verlag gründete und des Vaters Werke veröffentlichte. Und das Schreiben erwies sich für den depressiven Autor während einer kräftezehrenden Burnout-Phase inklusive Morphiumvergiftung und hartnäckiger Erkältung 1892 als ideale Therapie: Der Hausarzt empfahl ihm nämlich, seine Erinnerungen an die Kinderzeit niederzuschreiben, was Fontane auch beschwingt umsetzte und dann beglückt feststellte, er habe sich damit „wieder gesund geschrieben“. Kritisch anzumerken wäre jedoch, dass die darin geschilderte Kindheits-Idylle trügt: Die mit beinharten Strafmaßnahmen immer schnell und gnadenlos intervenierende Mutter wird fast so extrem verklärt wie der gutmütige väterliche Plauderer. Dazu Rutsch: „Der doppelbödige Text preist eine Kindheit als schön und enthüllt eigentlich eine Tragödie.“
Wenn Fontane also als Vielschreiber neben aktuellen Terminarbeiten immer neue Projekte in Angriff nahm und selbst im hohen Alter während der Arbeit am „Stechlin“ noch ‚nebenher’ „Die Poggenpuhls“ und „Effi Briest“ schrieb, dann lag das daran, dass er eigentlich nur beim Schreiben intensive Glücksgefühle entwickeln konnte.
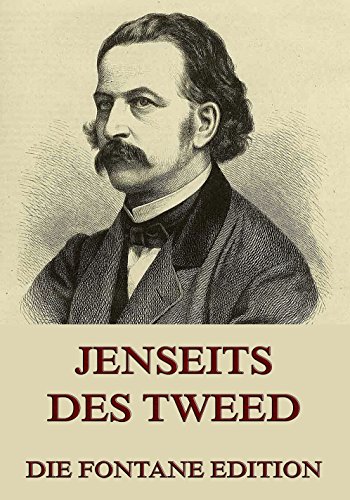
London als Erweckungserlebnis
Seine dreijährige Journalistenzeit in London (1855-1858) war für den preußischen Presse-Agenten Fontane wegen der internen Bürokraten-Probleme mit dem Ministerium einerseits extrem nervtötend. Wie Regina Dieterle („Theodor Fontane“) detailliert beschreibt, hatten die Berliner Beamten das englische Pressewesen falsch eingeschätzt; die gegen Rußland und Preußen gerichtete Berichterstattung über den Krimkrieg sollte Fontane ja beobachten und irgendwie konterkarieren. Aber er war als preußischer PR-Journalist in London schnell bekannt und die abwegige Idee, mit Bestechungsgeldern bei englischen Zeitungen erfolgreich zu sein, hatte Fontane seinen Vorgesetzten schnell ausreden können. Jedenfalls konnte er mit seinem unterfinanzierten kleinen Büro keinen pro-preußischen Einfluss generieren. Immerhin hatte er noch genügend Spielraum, um für die erzreaktionäre „Kreuzzeitung“ und andere Journale seine eigenen Kulturberichte und Reise-Impressionen zu veröffentlichen.
Der Potsdamer Historiker und Spezialist für die Moderne Iwan-Michaelangelo D` Aprile verweist auch auf Fontanes genauen Blick für die Veränderung der Medien-Landschaft und die Entstehung eines ganz neuen Reporter-Typs, worüber er damals mehrere Artikel veröffentlichte. Fontane schrieb Porträts über WH Russell, den ersten Kriegsreporter der Moderne, der bei den englischen Truppen auf der Krim zwar „embedded“, aber sehr kritisch die Kriegsscharmützel zwischen englischen und russischen Truppen beobachtete. Russell sprach und lebte mit den Soldaten und erkannte die gigantischen Fehler der englischen Generäle, die gedankenlos Tausende ihrer Soldaten für eine spektakulär inszenierte „Charge of the Light Brigade“ in den Tod schickten. Russell sorgte mit seinen ätzenden „Times“-Berichten über Krankenpflege, hygienische Bedingungen und der Unfähigkeit vieler Offiziere für heiße Debatten im Unterhaus und damit auch für die Beseitigung vieler Mißstände im Militärwesen.
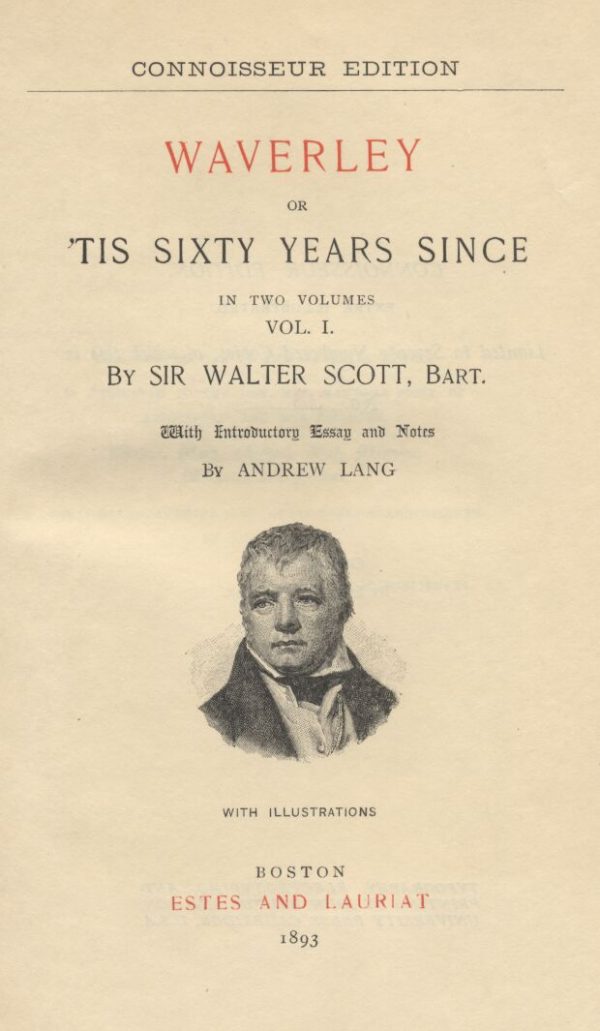
London bot dem nach Kunst, Kultur und Politik-Disputen dürstenden Beobachter Fontane die perfekte Kulisse für eine umfassende Studium Generale Fortbildung: Begeistert konnte er hier Shakespeare-Stücke im volkstümlichen Ambiente ansehen, Kunstausstellungen besuchen, Schiffsexkursionen auf der Themse machen oder sogar einen längeren Schottland-Trip mit seinem Freund Lepel unternehmen – was ihn auch seinem literarischen Idol Walter Scott („Waverley“) näher brachte. Vor allem schien Fontane die englische Debattenkultur wesentlich perfekter entwickelt zu sein: Hier war man direkter, polemischer in heißen Diskussionen und musste nicht permanent vor irgendwelchen Zensurinstanzen kuschen.
Der Berliner Journalist wollte sich aber auch als Hofberichterstatter profilieren: Zur pompösen Hochzeitsfeier der prominenten Royals Vicki (Tochter von Queen Victoria) und des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen im Londoner Prussia House brachte sich Fontane rechtzeitig als eine Art „Kir Royal“-Klatschreporter ins Gespräch und heizte die Stimmung deutscher Leser mit mehreren Vorberichten an. Seine Berichte erschienen dann in der „Zeit“; die Reaktion der Leser war sehr erfreulich.
Dagegen erscheinen die meisten der in „Sommer in London“ veröffentlichten Berichte merkwürdig blass und betulich. Seine Bootsfahrt nach Richmond („Die Töchter sind hübsch wie alle englischen Töchter“) ist dermaßen uninspiriert und stereotyp „hingeschmaddert“ (so nennt er selbst nichtssagendes Geplapper), dass dieser Text heute wohl nicht mal beim Landsberger „Bäcker-Boten“ eine Chance hätte.
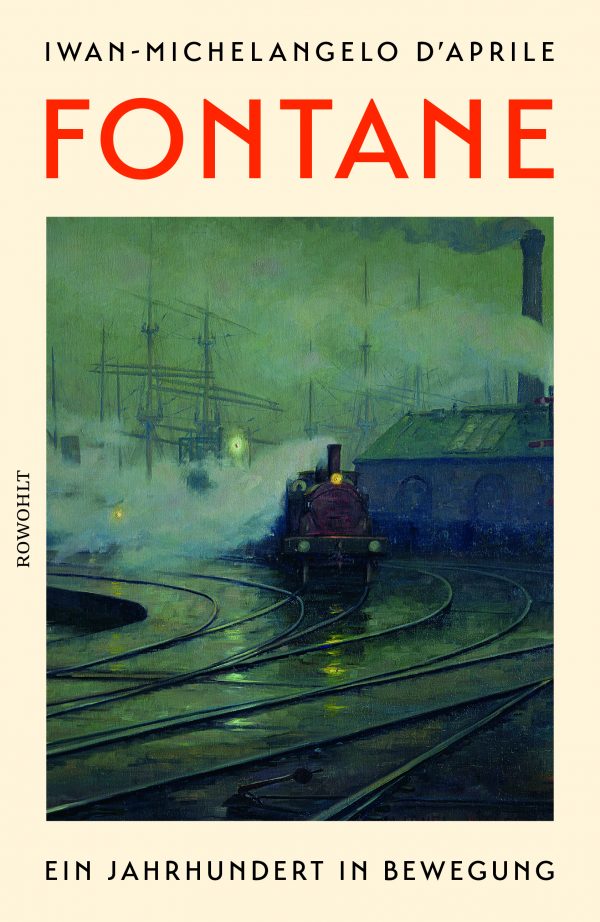
Das große Faszinosum London bestand für den Eisenbahn-Fan Fontane im spannenden Mix neuer Technologien und der faszinierenden Medien-Vielfalt: Der rasante Fortschritt der Mobilität bei Eisenbahn und Dampfschiffen, die schnelle Verbreitung des Telegraphen und dazu Dutzende von Zeitungen – das war ganz nach seinem Geschmack. Auch wenn das Tempo in der damals größten Metropole Europas für den hektisch herumwieselnden Journalisten immer mörderischer wurde. Da Iwan-Michelangelo D’Aprile „Ein Jahrhundert in Bewegung“ (so der Untertitel seiner Biographie) und den Wandel der Moderne als Leitmotiv versteht, betont er natürlich auch diese Aspekte. Reich illustrierte Magazine wie die London Illustrated News und den Traveller hatte Fontane damals sofort für das Berliner Büro abonniert „und so Bilder von der Welt in die Amtsstuben gebracht“, schreibt D’Aprile: „Die Illustrated News hatte allein sechs Zeichner auf die Krim geschickt, um Bilder vom Krieg zu bekommen.“
Manche Fontane-Kommentare zur Korrespondenten-Situation seiner Zeit muten zwar immer noch ganz scharfsinnig an, etwa, wenn er sich zur Verlagerung der globalen Schwerpunkte in der Berichterstattung äußert. Ihm war nämlich aufgefallen, dass die englischen Zeitungen Korrespondenten in Kalkutta, Bombay und Melbourne besaßen, aber keine Londoner Zeitung einen Berliner oder Petersburger Berichterstatter. D’Aprile zitiert Fontane dazu: „Das alte Europa ist halb ein ausgedörrtes und halb ein abgemähtes Feld, es verlohnt sich nicht mehr, von Lissabon bis Petersburg Korrespondenzen zu unterhalten“… Doch die Lage änderte sich natürlich sofort, wenn das alte Europa mal wieder von neuen Kriegen oder Revolutionen erschüttert wurde – was Fontane ja selbst registrierte, als er die Schlachtfelder bei Schleswig oder in Frankreich besuchte.
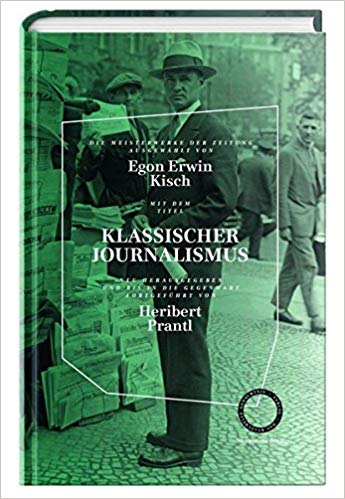
„Unvertraut mit Mördermanieren“
In seinem Band „Klassischer Journalismus“ bescheinigt Egon Erwin Kisch dem Reporterkollegen Fontane, er habe sich „Phrasenlosigkeit , Sprachknappheit und den Sinn für die Tatsache“ bewahrt. Kisch hatte mit seinem Lob den Kunst- und Theater-Kritiker Fontane gemeint, der zwanzig Jahre lang für die Vossische Zeitung Aufführungen des Königlichen Theaters Berlin besprach. Und mit seiner Unterstützung neuer skandalumwitterter Dramatiker wie Gerhart Hauptmann und Ibsen deren provokante naturalistische, sozialkritische Dramen wie „Vor Sonnenaufgang“ oder Ibsens „Gespenster“ oder „Die Wildente“ die gesamte Bewegung der von Otto Brahm gegründeten „Freien Bühne“ unterstützte. Kisch veröffentlichte Fontanes „Vor Sonnenaufgang“-Kritik aus der Vossischen Zeitung vom 20. Oktober 1889 und betonte in seinem Kommentar begeistert, der engagierte Fontane habe den Kampf um den jungen Naturalismus der „Freien Bühne“ entschieden und damit den „wüsten Agitatoren für Häßlichkeit und Rohheit“ sein Placet gegeben. Kisch hatte allerdings versäumt, den lässig-ironischen Stilisten zu würdigen, der in glänzenden Verrissen über Glamour und Show-Effekte in den Stücken von Brachvogel oder Gutzkow auch die Gier des bürgerlichen Publikums nach plumpem Amüsement attackierte. Zu großer Form lief Shakespeare-Fan Fontane in seinen Kritiken des englischen Klassikers auf: Er hatte sich intensiv mit den Werken des Barden aus Stratford beschäftigt, war während seiner Londoner Zeit als preußischer Presse-Redakteur nach Stratford gefahren und brachte es fertig, analytisch-gründlich und dennoch ironisch etwa über eine Berliner MacBeth-Inszenierung (20. Dez. 1879) zu befinden: „Das Gelungenste war der Regen, der gegen das alte Schloß von Inverness peitschte; danach kam der Pförtner, Herr Oberländer. Etwas outriert, etwas lustspielhaft, aber im ganzen doch ansprechend und beinah erquicklich. Das Ehepaar MacBeth, an dem natürlich der Erfolg des Aktes hängt, fährt zu wirr und unstet umher und macht viel zu viel Gebärdenlärm. Ich habe Macbeth nicht mehr gekannt und bin überhaupt unvertraut mit Mördermanieren. Aber so kann es nicht gewesen sein. Es ist ganz unmöglich.“
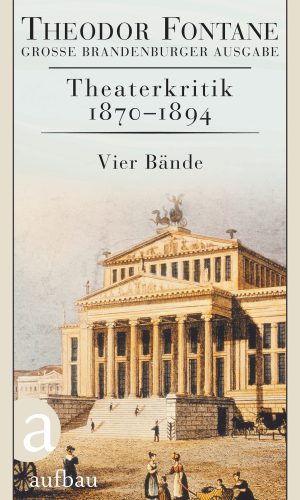
Irritierend ist jedoch der ideologische Kurswechsel, den er in einer Ibsen-Kritik („Noch einmal Ibsen und seine Gespenster“, 1887) andeutet: Nach früheren Pro-Ibsen Stellungnahmen legt er plötzlich Protest ein gegen Ibsens Plädoyer für eine „Heirat aus Neigung und nicht nach Geld“. Denn das „Lieben auf Abbruch“, so Fontane, „würde die Welt in ein unendliches Wirrsal stürzen und eine Verschlimmbesserung ohne gleichen sein“. Offenbar bricht nun doch wieder die preußische Ordnungsliebe bei ihm durch? Waren „Irrungen, Wirrungen“, „L’Adultera“ und andere nicht als Verurteilung arrangierter Ehen gedacht? Hätte sich Effi mit diesem von den Eltern verpassten „ehrenhaften“ preußischen Zwangskorsett etwa stillschweigend abfinden sollen?
Weitere Widersprüche und Ungereimtheiten in Fontanes Weltanschauung stellen die selbstironischen Einschätzungen seiner rebellischen 1848er-Phase post festum dar: Er war ja damals auch begeistert auf den Berliner Barrikaden gewesen und konnte sich eine andere als die rigide preußische Regierung samt Militärmaschinerie gut vorstellen – aber aus seiner Retrospektive wird daraus eine verspielte Kindergarten-Aktion, bei der er damals mit Murmeln und kaputten Waffen hantierte.
Ein Antisemit?
Seine oft kaschierten, dann aber doch offen zutage tretenden antisemitischen Tiraden werden von den Biographen auch thematisiert. Eine wichtige Frage, weil sich Fontane hier in Widersprüche verstrickt. Hans-Dieter Zimmermann („Der Romancier Preußens“) widmet diesem Problem das Kapitel „Ein Antisemit?“ Es wirkt ja unerträglich und makaber, wenn Fontane dem befreundeten Amtsrichter Georg Friedlaender (1814-1923) jahrelang ausführlich Briefe schreibt (ein Briefband mit 436 Seiten wurde 1994 veröffentlicht) und diesem längst evangelisch getauften Mann mit jüdischem Hintergrund versichert, wie gern er mit ihm Ausflüge und Spaziergänge mit ihren immer wieder so spannenden Gesprächen unternimmt. Und ihn dann in einem Brief an Friedrich Paulsen (12. Mai 1898) auf übelste Weise antisemitisch verunglimpfe. Da faselt Fontane davon, sein Freund sei ein „Stockjude“, zwar „mit einem ehrlich verdienten eisernen Kreuz bewaffnet“, doch würde seine Frau blutige Tränen weinen, „bloß weil ihr Mann die jüdische Gesinnung nicht los werden kann“. Auch vom „Arischen“ ist da die Rede und davon, dass die Juden vor allem im Pulk und als Klüngel unerträglich seien. Diese perfiden Absonderungen werden auf Fontane-Symposia schon seit vielen Jahren diskutiert; ein amerikanischer Fontane-Experte hat dazu, wie Zimmermann berichtet, schon 1998 auf der Konferenz zum 100. Todestag Fontanes in Potsdam seinen Vortrag mit dem Fazit beendet: „Ist das der Fontane, der vier Jahrzehnte früher (1856) auf Freytags bürgerlichen Antisemitismus in „Soll und Haben“ antwortete: „Wohin soll das führen?“
Ein unsicherer Kantonist?
Hatte Thomas Mann also Recht, als er in seinem berühmten Fontane-Essay von 1910 Fontane einen „unsicheren Kantonisten“ nannte, der sich in den Briefen hemmungsloser und rücksichtsloser geben konnte, weil er keine Rücksicht auf Verleger und andere Bedenkenträger nehmen musste? „Andere spielten Domino, züchteten Rosen, hörten Musik und verführten Mädchen“, meinte Reich-Ranicki ja in seiner „Nachprüfung“ über den Briefeschreiber Fontane: „Er aber schrieb Briefe, gab Stimmungen und Launen nach und ließ sich zu bisweilen kaum diskutablen Äußerungen hinreißen.“ Wer kann da widersprechen? Jedenfalls polemisiert der unsichere Kantonist Fontane hier dermaßen indiskutabel und bedient menschenverachtende Klischees mit einer so schauderhaften Ausgrenzungs-Terminologe, dass dieser Vorgang keineswegs als Exkurs eines irregeleiteten Briefschreibers verharmlost werden kann.
Auch wenn die Lektüre der vier Fontane-Biographien bereichernd ist und jede einzelne spannende und bisher kaum bekannte Aspekte erörtert, bleiben doch etliche Fragen offen, wenn wir ein komplettes Psychogramm des in mancher Hinsicht allzu empfindsamen und die angebliche Nichtanerkennung (und Unterbezahlung) allzu oft bejammernden Autors erwarteten.
Faszinierend sind jedenfalls die Kontraste, die sich zwischen dem phasenweise doch sehr unsicheren und verärgerten Fontane und seinen eigenen so souveränen Figuren wie etwa der dynamischen Powerfrau Mathilde Möhring oder dem alten Dubslav im „Stechlin“ ergeben. Die verständnisvolle Attitüde des alten Stechlin, die über allem Übel heiter schwebend auf eine Versöhnung von Gegensätzen gerichtet ist, sollte aber nicht als desinteressiertes angepasstes Mainstream-Abnicken missverstanden werden: Stechlins Behauptung „Wenn ich das Gegenteil gesagt hätte, wäre es genauso richtig“ zielt ja auf den gesellschaftlichen nichtprovokativen Umgang in der Zeit eines allgemeinen Umbruchs und der Umwertung aller Werte: „Das Neue willkommen heißen, aber das Alte nicht komplett ablehnen“ lautet Stechlins und auch Armgards Devise. Auch heute noch keine schlechte Erkenntnis angesichts rasanter Globalisierungstendenzen und einer Weltvernetzung, die das Telefonieren vom Stechlin-See mit Java nicht nur bei gefährlichen vulkanischen Eruptionen ermöglicht.
Peter Münder
Zu Teil 1 geht es hier. Peter Münder bei CrimeMag hier.
Literatur-Info:
Iwan-Michelangelo D’Aprile: Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung. Rowohlt 2018, 544 Seiten.
Regina Dieterle: Theodor Fontane. Hanser 2018, 832 Seiten.
Hans-Dieter Rutsch: Der Wanderer. Das Leben des Theodor Fontane. Rowohlt Berlin 2018, 333 Seiten.
Hans-Dieter Zimmermann: Theodor Fontane. Der Romancier Preußens. C.H. Beck 2019, 458 Seiten.
Helmut Nürnberger: Fontane. Rowohlt Monographie, Reinbek 1968, 192 Seiten.
Theodor Fontane: Vor Sonnenaufgang/ Rez. Vossische Zeitung 20. Okt. 1889 In: Egon Erwin Kisch: Klassischer Journalismus, Rogner& Bernhard S. 508-519
Marcel Reich-Ranicki: Nachprüfung. Aufsätze über deutsche Schriftsteller von gestern. dtv 1984











