„Chandler war zu subtil für mich“
Daniel Woodrell, Autor von „Winters Knochen“ (hier bei cultmag) und „Der Tod von Sweet Mister“, begann seine deutsche Lesetour beim Hamburger Harbour Front Festival. Er sprach mit Peter Münder und Frank Göhre über den mühsamen Weg zum Schreiben.
„Bei dem, was wir machten, war es meist nötig, nicht gesehen zu werden“, erklärt der 13-jährige übergewichtige Ich-Erzähler Shuggie in „Der Tod von Sweet Mister“. Erst mal soll er einen Pick-up umlackieren, dann wird er vom sadistischen Stiefvater Red – der bezeichnet ihn nur als „Fettsack“– gezwungen, Medikamente zu klauen, die Red dann verhökert oder selbst einwirft. Shuggies gutmütige Mutter Glenda süffelt bedüselt ihren Rum-Cola-Mix, erträgt die sadistischen Bosheiten von Red und hängt sehr an ihrem Shuggie, den sie mit viel Zuneigung und Leckereien verwöhnt. Im abgelegenen Grenzgebiet zwischen Missouri und Arkansas sind die Knospen aufgeplatzt, Wildblumen „ragten groß und prahlend aus dem Unkraut“, außerdem gibt es noch reichlich Vogelgesang samt Hummeln „und all den anderen Frühlingsscheiß“.
Nicht unbedingt eine Idylle aus dem Poesie-Album, die Daniel Woodrell hier in „Sweet Mister“ entwirft. Aber seine Welt ist eh eine düstere Gegenwelt, in der es zarte Gemüter schwer haben. Sie müssen sich, wie die 16-jährige Ree in „Winters Knochen“, gegen sinistre Typen behaupten, die als Spezialisten für die fachmännische Crack-Produktion ihre Aktivitäten auch verheimlichen wollen. In den Ozarks zwischen Missouri und Arkansas, auch im Frogtown der sumpfigen „Bayou-Trilogie“ gelten eben andere, archaische Regeln, die identitätsstiftenden ritualisierten Stammestraditionen aus dem afrikanischen Busch ähneln.
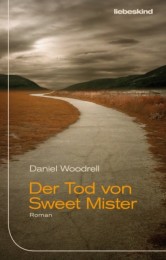 Actionreiche Tristesse
Actionreiche Tristesse
Ob man diese hochdosierte, actionreiche Tristesse, diese bizarre Symbiose von Outsidern mit einer tristen Randzonen-Ödnis nun „Country Noir“, „Hillbilly Noir“ nennt wie die New York Times oder ihn selbst als „Balladensänger des weißen Abschaums“ (taz) tituliert, das ist Woodrell ziemlich schnuppe. Wie weiland Anton Tschechow hält er Schubladen und Klassifikationen nämlich für schlecht kaschierte Vorurteile. Er will eben nicht moralisieren, sondern die Atmosphäre einfangen und die Charaktere in ihrem natürlichen Habitat beschreiben. „Eine düstere, ökonomisch unterentwickelte Umwelt verstärkt die Chance, selbst deprimiert aufzuwachsen und arm zu bleiben“, meint Daniel Woodrell, 59, bei unserem Gespräch in einem Hamburger Hotel in Hafennähe.
Die Suche nach biografischen Bezugspunkten in seinen Büchern ist sicher interessant, aber spannender als die in der Trilogie beschriebenen drei Brüder (wie bei Woodrell) mit ihrem flippigen, aber sympathischen Vater oder der kleinkriminelle Hintergrund; über dem permanent hochprozentige Whisky-Nebel wabern, ist sicher die literarische Karriere des Autors, der als 17-Jähriger 1971 die Schule schmiss, der Familie Goodbye sagte und sich bei den Marines bewarb, um sich aus der kleinkarierten Spießerhölle auszuklinken: „Lieber nach Vietnam, als weiter im stumpfsinnigen Kansas City zu verblöden, wo wir damals lebten“, erklärt Woodrell seinen damaligen Entschluss. Der wurde ihm auch erleichtert von Militär-Anwerbern, die den Jungen mit Sprüchen köderten wie etwa: „You want to be a man? Come on and join us!“ So mutiert er also zum bewaffneten Mann, aber dann schiebt er seinen Dienst doch nur auf Guam und in Florida, und wird nicht in Vietnam eingesetzt, weil eine Klausel besagt, dass nur Männer über 18 Jahre für den Kriegseinsatz berücksichtigt werden können.
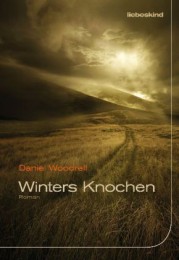 Soldat und Leser
Soldat und Leser
Seine Laufbahn als Schriftsteller begann Woodrell eigentlich als Soldat: „All diese Stunden, die man herumhing und auf irgendwelche Einsatzbefehle wartete, die konnte ich optimal zum Schreiben nutzen“, erklärt er. Ein passionierter Leser war er ohnehin schon: „Aber ich las einfach alles, was mir in die Finger kam, mit Vorliebe Mutters Lieblingsautor Mark Twain, auch Hemingway auf der Schule, dann Chandler und Hammett sowie Klassiker wie ‚Don Quijote‘, Nelson Algren, Walt Whitman sowie William Faulkner. Natürlich auch Mickey Spillane und Dutzende von anderen Pulps und dazu noch die Iren des frühen 20. Jahrhunderts.“ Ein gut angerührter Zufallsmix. Aber Chandlers Philip Marlowe hat auf Woodrells Detective Rene Shade (der „Bayou-Trilogy“) wohl ebenso wenig abgefärbt wie Hammetts Spürnase Sam Spade: „Natürlich fand ich das große Noir-Duo faszinierend und hab diese Bücher verschlungen. Aber Chandler fand ich viel zu subtil und stilisiert – mich hatten damals die Pulps viel stärker interessiert.“
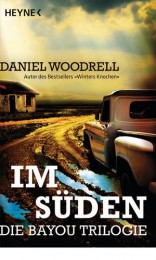 Variabilität
Variabilität
Dass der düstere sozialkritische Erzählton von Woodrell auch umschlägt in groteske Slapstick-Szenarios, in denen exotische Figuren auftauchen, die von noch schrilleren Außenseitern übers Ohr gehauen oder in eine tödliche Falle gelockt werden, geht sicher auf Woodrells Interesse für ein extrem breites literarisches Spektrum und experimentierfreudige Erzählperspektiven zurück. Aber seine eigenen Erfahrungen in einem buntgemischten, verarmten und kleinkriminellen Milieu machten ihn auch zum Sozial-Anthropologen, der schrille Beobachtungen machte: „Nachdem ich in den Ozarks mehrmals von Typen aus der Nachbarschaft ausgeraubt wurde, konnte ich denen nur empfehlen, sich auch mal in anderen Vierteln zu betätigen, wo es mehr zu holen gab – die waren einfach so dämlich, dass es schon weh tat.“

Frank Göhre und Daniel Woodrell
Entscheidend war für ihn das Hineinrutschen in eine eher dubiose Peer Group und in ein fragwürdiges Milieu, aus dem manche seiner Freunde (und einer seiner Brüder) nicht mehr herausfanden: „Hinterher, als ich dann auch bei den Marines wegen Drogenproblemen und angeblich asozialer, aufmüpfiger Verhaltensmuster rausflog, das College besuchte und Creative Writing studierte, konnte ich mich natürlich mokieren über diesen ganzen Mist, den wir damals ausgeheckt hatten, aber für einige war das ewige Herumhängen, Kiffen, Einbrechen, Saufen usw. auch der Anfang einer langen Knastkarriere.“
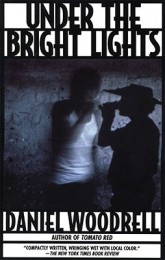 American Dream
American Dream
Die Sehnsucht nach der Verwirklichung des American Dream, das fortwährend demonstrierte Power Play, die Zurschaustellung von Statussymbolen: All das fängt Woodrell in seinem sozialkritischen Panoptikum wunderbar ein. Als Shuggie im rassigen grünen Thunderbird von Glendas Liebhaber Jimmy Vin Pearce sitzt, erlebt er das fast wie ein religiöses Erweckungserlebnis: „Das Wageninnere strahlte wunderschön, es war makellos weiß, es fühlte sich an, als würde man in einem feinen weichen Bett auf Rädern liegen, das jemand sanft und sicher lenkte. Dieser Wagen hatte Sachen, nach denen ich noch nicht mal zu fragen gewusst hätte … Ein großartiges Auto. So hoch war ich in der Welt noch nie gekommen.“
Nach seiner Zeit bei den Marines ging Woodrell ans College, studierte englische Literatur, schrieb Kurzgeschichten und nahm an einem Wettbewerb teil, bei dem er sofort den ersten Preis gewann: „Da hatte ich die Illusion, Schreiben wäre kinderleicht – das hat sich dann aber schnell gegeben“, erklärt er lächelnd. „Natürlich ist das Schreiben ein mühsamer Prozeß, den man nicht mit links erledigen kann.“ Er hat lange Perioden durchgemacht, in denen er deprimiert war und an seinen eigenen Fähigkeiten doch zweifelte. Aber die Kurse an der Creative Writing School in Iowa, die er dann besuchte, hält er für ziemlich überschätzt, weil die Lehrer keine großen Leuchten waren.
Sein erster, 1986 veröffentlichter Roman war „Under the Bright Lights“, der erste Teil der „Bayou Trilogy“. Die dichte Atmosphäre, die ungewöhnlichen Figuren, dazu noch ein ganz besonderer, lakonisch-lässiger Sprachduktus – das war von Anfang an Woodrells Markenzeichen. „Für jeden Roman versuche ich eine eigene Sprache zu finden“, sagt Woodrell. Er lässt sich auch nicht hetzen von Deadlines, die ihm der Verlag vorgibt: „Ich muß in Ruhe arbeiten können, faul bin ich nicht. Ich will aber das Maximum aus einem Text herausholen. Wenn es mit dem Buch nicht voran geht, dann ist es eben nicht gut genug. Ich veröffentliche lieber gar kein Buch als einen Stinker!“
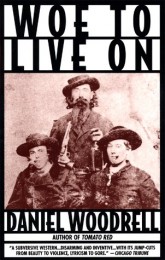 Keine Labels
Keine Labels
Sein Krimi-Label kann man jetzt offenbar erstmal einmotten, denn Woodrell hat sich wieder auf historische Themen kapriziert. Er ist immer noch fasziniert von der amerikanischen Bürgerkriegsepoche, von den Gründerjahren der USA, der Lage der Sklaven. Das alles hatte er ja schon 1987 in „Woe to live on“ („Zum Leben verdammt“) thematisiert, nachdem er dafür mehrere Jahre an Recherchen investiert hatte und es dann, absolut beflügelt von diesem facettenreichen Stoff, in sechs Monaten fertig schrieb. Sein neuer Roman heißt „The Maid’s Version“ und setzt sich mit einem mysteriösen, ungeklärten Brand von 1928 auseinander, bei dem 28 Menschen starben. Der Brand war von einer Explosion in der Kleinstadt ausgelöst, in der Woodrell früher lebte. Die Suche nach den Tätern wurde offenbar eingestellt, als sie einigen einflussreichen Politikern nicht mehr ins Konzept passte. Er fand alte Dokumente, Tagebücher usw. und war absolut fasziniert vom Eintauchen in eine andere Welt, in eine vergangene Epoche. Im Grunde genommen ist Woodrell eigentlich ein Historiker, der einfach nur spannende Geschichten sucht. Absolut aufregend findet er es etwa, wenn er Briefe einer Sklavin aus dem Bürgerkrieg findet: „Das war eine Zeit mit einer Analphabetenrate von rund 90 Prozent! Und wenn ich jetzt sehe, dass wir einen Präsidenten wie Barack Obama haben, dann bin ich doch sehr zufrieden – ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben würde.“
Das Interview führten Frank Göhre und Peter Münder, der diesen Text verfasst hat.
Daniel Woodrell: Der Tod von Sweet Mister. Aus dem Englischen von Peter Torberg. München: Liebeskind 2012. 191 Seiten. 16,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Ders.: Winters Knochen. Aus dem Englischen von Peter Torberg. München: Liebeskind 2011. 223 Seiten. 18,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Ders.: Im Süden. Die Bayou Trilogie. Mit einem Nachwort von Frank Göhre. Heyne 2012. 650 Seiten. 10,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.













