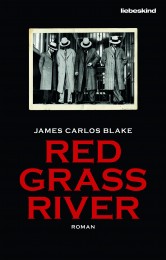 History Noir, falls es so etwas gibt
History Noir, falls es so etwas gibt
Das rasiermesserscharfe Gras der Everglades korrespondiert wirkungsvoll mit dem erzählerischen Untergrund dieser Outlaw-Ballade aus einem alles andere als sonnigen Florida. Prohibition, Familienfehden, Blutvergießen, Alkoholschmuggel und Gangsterkriege machten zwei Männer zu Legenden und Volkshelden. Der eine ist John Ashley, Killer, Bankräuber, Schmuggler und Ausbrecher, sein Gegenpart ist Sheriff Bobby Baker, dem Ashley einst sein Mädchen stahl. James Carlos Blake Blake, der hier mit epischem Atem von den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erzählt, macht auch die Zerstörung und Ausbeutung der Everglades zum Thema, die Ausbreitung von Big Business und organisiertem Verbrechen. Die Ashley Gang ist historische Realität, Blake entwirft ein fieber- und farbenprächtiges, sumpfpralles Zeitgemälde. „Sex and drawlin’ dialogue that don’t give a damn about real English, along with big whiffs of piney-fresh description, gusts of gunfire, and howling action like a night in a cathouse during a hurricane“, meinte die „Kirkus Review“.
Nach „Das Böse im Blut“ (In the Rogue Blood) und „Pistolero“ (The Pistoleer) ist dies nun das dritte, von James Carlos Blake in Deutschland veröffentliche Buch. Der Verlag Liebeskind erwirbt sich hier Meriten. Bei CrimeMag war „Odysseus in Amerika“, Alf Mayers zweiteiliges Porträt von James Carlos Blake, im September und Oktober 2013 zu lesen. „Red Grass River“ erschien ein Jahr nach „Das Böse im Blut“, war Blakes erster Ausflug in ein Genre, das man vielleicht „History noir“ nennen kann: Erkundungen auf der dunklen und blutigen Seite des amerikanischen Traums. Blakes Protagonisten sind die Ruhe- und Heimatlosen, die Verstoßenen, Bastarde, Abenteurer, Sturköpfe, Außenseiter, einsamen Herzen, Verbrecher und Gesetzlosen. „Der typische Amerikaner ist in seinem Wesen hart, abgesondert, stoisch und mörderisch“, lautet eines der vier Motti, die Blake dem „Bösen im Blut! voranstellte.
Mit einer Sondererlaubnis des Verlages präsentieren wir Ihnen hier den Anfang von „Red Grass River“, einige Tage vor dem Erscheinen am 19. Februar.
PROLOG
Der Liars Club
Falls sich der Teufel je einen Garten angelegt hat, dann die Everglades. Der größte und gemeinste Sumpf, den Sie je zu sehen bekommen – größer als so mancher Staat der USA. All die Kiefernwälder und das Zwergpalmetto-Gestrüpp, die Zypressensümpfe, das ganze Kletterpflanzengewirr. Doch vor allem ist es ein Fluss, ein Fluss, wie es auf der Erde keinen zweiten gibt. Er ist hundert Kilometer breit, fünfzehn Zentimeter tief und verläuft vom Lake Okeechobee bis zum südlichen Ende des Staates über einem Morast ohne festen Boden. Das Ganze ist mit Binsenschneide, einer Art Sauergras, überwuchert, scharf wie ein Rasiermesser. Zwischen diesem schneidend scharfen Gras gibt es weit und breit nichts außer vereinzelten Hammocks – höher gelegene, mit Laubbäumen und Palmen bewachsene Inseln –, die größtenteils noch kein Mensch je betreten hat. Da draußen wirkt die Welt viel größer, und der Himmel kennt kein Ende. Es heißt, dass es kaum einen anderen Ort gibt, an dem man weiter schauen und dabei weniger sehen kann. Und alles trägt die eine oder andere Schattierung von Grün, außer bei Sonnenaufgang oder schwinden- dem Tageslicht, wenn dieser große Grasfluss so rot wird, dass man meint, er würde brennen oder aus Blut bestehen.
Nur die Verzweifelten oder die von Gott Verdammten leben dort draußen. In den Everglades gibt es alle möglichen Dinge, die einen schneiden, verbrennen oder mit Juckreiz quälen, die einen stechen, vergiften oder gleich am Stück auffressen können. Es gibt Treibsand und Alligatoren, Panther und Schlangen und Mücken und alle anderen erdenklichen Insekten, die einen in den Wahnsinn treiben können. Im Sommer ist die Luft so heiß und feucht, dass man meint, gekochte Baumwolle einzuatmen. Gott allein weiß, was der faulige Schlick unter der Binsenschneide alles verschluckt hat und nie wieder freigeben wird. In diesem Schlamm finden sich Knochen, die eine Million Jahre alt sind, aber auch welche von letzter Woche. Tierknochen. Menschenknochen. Dort draußen liegen zehntausend Geschichten begraben, die außer dem Teufel niemand kennt.

Ja, eine bessere Bezeichnung als Devil’s Garden hätte man solch einem Ort nicht geben können. Selbst auf neuen Karten findet man diesen Namen noch an einem Stück Wildnis östlich von Immokalee. Es waren die ersten Cracker, die den Namen erfunden haben – und so groß die Glades auch heute noch sein mögen, in jenen Tagen waren sie viel größer und dehnten sich fast über die ganze Region beiderseits des Lake Okeechobee aus. Einen Cracker nannte man jemanden, der im Sumpfland aufgewachsen ist und sein täglich Brot vor allem mit der Jagd und dem Fallenstellen verdiente, auch wenn manche versuchten, sich mit ein bisschen mühseligem Ackerbau, ein bisschen Viehzucht oder ein bisschen von allem über Wasser zu halten. Die ersten Cracker, die in Florida auftauchten, kamen aus allen möglichen Ecken des Südens, aber überwiegend aus Georgia. Sie verdanken ihren Namen ihren knallenden Peitschen, mit denen sie ihr Vieh vor sich hertrieben. Man- che dieser ledernen Peitschen waren so groß, dass man sie mit beiden Händen festhalten musste. Sie knallten laut wie Gewehrschüsse und waren kilometerweit zu hören.
Keine anderen Weißen kannten den Devil’s Garden je so gut wie die Cracker. Und keine anderen Cracker kannten ihn so gut wie die Ashleys.
Heute sind nur noch wenige Cracker übrig, die den Ashleys noch von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Ich meine, wir sind alt, allesamt. Wir sind alt, haben alle unsere Gebrechen und brauchen mindestens einen Stock zum Gehen, manche sogar einen Rollator. Kaum einer von uns Männern kommt ohne Brille aus, mit Gläsern so dick wie Flaschenböden. Kaum einer fragt nicht ständig: »Was?«, wenn jemand mit ihm spricht, oder kann die Nacht durchschlafen, ohne ein- oder zweimal zum Pissen aufzustehen. Aber fast alle von uns kannten die Ashleys, als wir noch Kinder waren. Zumindest kannten wir sie so gut, dass wir uns auf der Straße grüßten, wenn wir uns trafen. Näher kam man den Ashleys sowieso nicht, wenn man nicht zur Familie gehörte. Sie waren eine stolze Sippe, und man kam nur schwer an sie ran. Aber hin und wieder liefen wir einem von ihnen über den Weg, und natürlich bekamen wir mit, dass ständig über sie geredet wurde.
Während wir aufwuchsen, hörten wir hundert Geschichten über die Ashleys und über John Ashleys Gang und die Verbrechen, die sie begingen. Wir hörten alles über die Feindschaft zwischen John Ashley und Bobby Baker und über den Krieg, den die Ashleys mit den Yankee-Schmugglern führten, die sich auf ihrem Territorium breitmachen wollten. Wir hörten ein Dutzend Versionen darüber, was sich an der Sebastian River Bridge zutrug und schließlich zum Ende der Gang führte. Noch heute erzählen wir diese Geschichten, wenn wir uns im Park treffen, um unsere alten Knochen in die Sonne zu halten und uns die Zeit mit etwas anderem zu vertreiben als der Frage, ob es irgendwo einen Demokraten gibt, der in der Lage ist, die nächste Wahl zu gewinnen.
Die Sache ist die: Über die Ashley-Gang wurden so lange so viele Geschichten erzählt – und zwar von so vielen Leuten, die die Tatsachen auf die eine oder andere Art verdrehen –, dass man kaum unterscheiden kann, was echte Fakten sind und was nicht. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht so wichtig. Jeder weiß, dass die einfachen Tatsachen allein nicht notwendigerweise die Wahrheit erzählen. Manch einer kann den ganzen Tag nur wahre Fakten von sich geben und dabei doch lügen, da muss man sich nur mal für eine Weile in einen Gerichtssaal setzen. Auf der anderen Seite kann eine Geschichte, die hier und da ein wenig großzügig mit den Fakten umgeht, so viel Wahrheit enthalten, wie man sich nur wünschen kann. So jedenfalls sehen wir das.
Unsere erwachsenen Kinder grinsen, zwinkern sich zu und schütteln die Köpfe über unsere Geschichten, und trotzdem gibt es in den Friseurläden, den Cafés und auf den Plätzen vor den Gerichten in jedera Stadt ein paar alte Knacker wie uns. So läuft es nun mal hier unten im Süden. Als wir klein waren, saß eine Gruppe Graubärte auf dem Hauptplatz der Stadt und er- zählte Geschichten vom Bürgerkrieg, von den schlechten alten Zeiten der Reconstruction, von den Machenschaften des Klans und so weiter. Jeder nannte diese alten Kerle den Liars Club. Und so nennt man heute auch uns …
(Mit freundlichem Dank an Verlag und Übersetzer – d. Red.)
James Carlos Blake: Das Böse im Blut (In the Rogue Blood, 1997). Roman. Dt. von Matthias Müller. Liebeskind, München 2013, 448 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformati0nen zum Buch und Autor.
James Carlos Blake: Pistolero (The Pistoleer, 1995). Roman. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Liebeskind, München 2015. Hardcover, 400 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen zum Buch und Autor.











