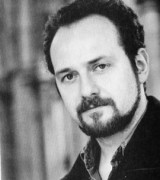 Lust am Splatter
Lust am Splatter
Man sollte misstrauisch werden, wenn Buchmarkt und Kritik mit großen Namen und neuen Labels um sich werfen, um einen Autor zu promoten. Das wird dem in dieser Weise Bedachten nämlich im Zweifel nicht gerecht. Dem Schotten Stuart MacBride geht das so, der in den letzten drei Jahren mit seinen ersten vier Romanen um DS Logan McRae einen fulminanten Start hingelegt hat. Ein Porträt von NELE HOFFMANN
„Der neue Ian Rankin“, das muss er sich wahrscheinlich genauso oft gefallen lassen wie die Etikettierung mit dem schönen Begriff „Tartan Noir“ (den übrigens James Ellroy geprägt haben soll). Stuart MacBride begegnet solchen Etikettierungen gelassen. Die Konstruktion einer schwarzkarierten „Gruppe“ von schottischen Kriminalautoren akzeptiert er als ein probates Marketing-Label, ohne daraus so etwas wie eine literarische Bewegung ableiten zu wollen. Und anders als Ian Rankin hat er nicht vor, die nächsten zwanzig Jahre mit ein und demselben Protagonisten zu verbringen. Der allerdings kann einem durchaus ans Herz wachsen, zusammen mit allen anderen Figuren des Polizeireviers der Grampian Police in Aberdeen. Nicht etwa deshalb, weil irgendeine von diesen Gestalten auch nur ansatzweise ‚cosy‘ wäre, ganz im Gegenteil. Darauf und auf sein neuestes Projekt, Sawbones, kommen wir gleich zu sprechen.
Zunächst aber etwas zum Autor selbst: MacBride ist Ende Dreißig und war in verschiedenen Metiers unterwegs, bevor er zu schreiben begann, unter anderem offshore auf den Bohrinseln der Nordsee, als Graphikdesigner und als Webdesigner. Wer an einer Home-Story interessiert ist, die hier nicht geliefert wird, kann sich zumindest ein Bild von seiner virtuellen Persona verschaffen. Auf seiner Homepage unterhält er einen Blog, in dem der „bearded protagonist“ zum Besten gibt, was er aus der Einsamkeit am Schreibtisch seiner „Casa MacBride“ mitzuteilen hat, die irgendwo in der Nähe von Aberdeen liegt. Das ist oft klug und witzig, manchmal unappetitlich und meistens sehr, sehr verspielt.
Die Logan McRae-Serie
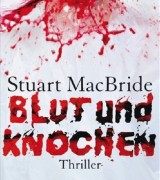 Die Romane um Detective Sergeant Logan McRae spielen in Aberdeen, einer Stadt im Nordosten Schottlands. Aberdeen ist geprägt vom Hafen, der Ölindustrie und dem Granit, der leuchtet, wenn ausnahmsweise mal die Sonne scheint, aber meistens regnet es. Hafenszenarien, spießige Interieurs, kuriose Gestalten. Die Polizeiromane von Stuart MacBride sind Romane „von unten“ – er interessiert sich für den alltäglichen Wahnsinn der mittleren und unteren Dienstgrade. Freie Tage werden grundsätzlich gestrichen, die schmutzigsten Aufgaben werden von den Ranghöheren gnadenlos und manchmal süffisant grinsend verteilt, die Observationsschichten in schrottreifen Autos sind lang und öde.
Die Romane um Detective Sergeant Logan McRae spielen in Aberdeen, einer Stadt im Nordosten Schottlands. Aberdeen ist geprägt vom Hafen, der Ölindustrie und dem Granit, der leuchtet, wenn ausnahmsweise mal die Sonne scheint, aber meistens regnet es. Hafenszenarien, spießige Interieurs, kuriose Gestalten. Die Polizeiromane von Stuart MacBride sind Romane „von unten“ – er interessiert sich für den alltäglichen Wahnsinn der mittleren und unteren Dienstgrade. Freie Tage werden grundsätzlich gestrichen, die schmutzigsten Aufgaben werden von den Ranghöheren gnadenlos und manchmal süffisant grinsend verteilt, die Observationsschichten in schrottreifen Autos sind lang und öde.
Logan McRae ist zweiflerisch, klug und ein bisschen unbeholfen. Er hat Angst vor Schmerzen und Angst vor dem Versagen, und Frauen sind ihm ein Rätsel – was bei den Damen, mit denen er es zu tun hat, allerdings auch kein Wunder ist. Sehr moralisch ist er auch, im Gegensatz zu einigen seiner Kolleginnen. Seine Beziehung zu Isobel MacAlister, der kühlen, schönen Pathologin, ist aus ungeklärten Gründen gescheitert. Auch die Liaison mit seiner impulsiven, chaotischen und widerborstigen Kollegin Detective Constable Jackie Watson verläuft, gelinde gesagt, prekär.
DC Watson ist gemein, aufbrausend und potenziell gewalttätig. Es kommt vor, dass sie kräftig in den Kaffee spuckt, bevor sie ihn dem Verdächtigen im Vernehmungszimmer kredenzt. Sie prügelt einen brutalen Vergewaltiger ins Koma, dem seine Verbrechen nicht nachgewiesen werden können, und ihre Faust landet auch mal in Logans aus anderen Gründen ohnehin schon lädiertem Gesicht.
Logans Vorgesetzter Detective Inspector Insch ist fett, cholerisch und ungerecht – seine Untergebenen schließen Wetten darauf ab, ob er im Laufe der kommenden Woche einem Herzinfarkt erliegen wird oder ob er nur einem seiner Mitmenschen die Fresse polieren wird. Und er ist passionierter Laienschauspieler – zum Leidwesen seiner Kollegen, denn deren Anwesenheit bei den Premieren ist Dienstpflicht.
Unerreicht aber ist und bleibt Detective Inspector Steel – eine um die vierzigjährige, kettenrauchende Lesbe, die der „Loserbrigade“ vorsteht, der Abteilung, in der alle Strafversetzten und Unfähigen versammelt sind. Steel beutet ihre Untergebenen permanent nach Strich und Faden aus, sie flucht was das Zeug hält, und ihr graut davor, ihrer Lebensgefährtin Susan das Ja-Wort zu geben und ihre promiske Lebensweise aufgeben zu müssen.
Nicht alles ist schön …
Die Fälle, die dieses Panoptikum zu bearbeiten hat, sind haarsträubend, MacBrides Affinität zum Horror-Genre ist nicht zu übersehen. Pädophilie, Kannibalismus und Serienmord werden in makabren Settings inszeniert. Roadkill zum Beispiel, ein städtischer Angestellter, der die Kadaver von auf den Straßen verendeten Tieren in einer Baracke am Stadtrand aufhäuft und sich an dem Frieden dieser morbiden Szenerie freut.
Oder die Szene, in der einem (zugegebenermaßen aufdringlichen und skrupellosen, aber trotzdem sympathischen) Journalisten die Finger mit einer Geflügelschere abgezwickt werden, als er einem prominenten Vertreter des lokalen Organisierten Verbrechens in die Hände fällt – er muss die abgeschnittenen Fingerglieder essen, bevor er auf einem entlegenen Parkplatz aus dem Auto der Gangster befördert wird.
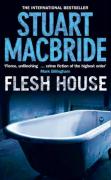 Oder der neueste Logan McRae-Roman Flesh House, der noch nicht auf Deutsch erschienen ist: Ein Serienmörder schlachtet seine Opfer und bereitet sie nach allen Regeln der Kunst zu – und sagen Sie jetzt nicht, das kennen wir schon von Hannibal Lecter. Denn so einfach wie Thomas Harris macht es sich MacBride nicht. Hier wird nicht das charismatische Böse besungen, und es werden auch keine psychoanalytisch verwertbaren Konstellationen zwischen der Schönen und dem Biest konstruiert, sondern der kannibalische Wahnsinn ist und bleibt grauenhaft kontingent. (und da ist er wieder, der homo ludens: MacBride hat Flesh House mit fingierten Titelseiten aus der Boulevardpresse ausgestattet, eben ein bisschen mit Photoshop gespielt, gutwillige Verwandte als Schwerverbrecher und Mordopfer posieren lassen und der Herstellung damit den letzten Nerv geraubt…).
Oder der neueste Logan McRae-Roman Flesh House, der noch nicht auf Deutsch erschienen ist: Ein Serienmörder schlachtet seine Opfer und bereitet sie nach allen Regeln der Kunst zu – und sagen Sie jetzt nicht, das kennen wir schon von Hannibal Lecter. Denn so einfach wie Thomas Harris macht es sich MacBride nicht. Hier wird nicht das charismatische Böse besungen, und es werden auch keine psychoanalytisch verwertbaren Konstellationen zwischen der Schönen und dem Biest konstruiert, sondern der kannibalische Wahnsinn ist und bleibt grauenhaft kontingent. (und da ist er wieder, der homo ludens: MacBride hat Flesh House mit fingierten Titelseiten aus der Boulevardpresse ausgestattet, eben ein bisschen mit Photoshop gespielt, gutwillige Verwandte als Schwerverbrecher und Mordopfer posieren lassen und der Herstellung damit den letzten Nerv geraubt…).
Dichtung und Wahrheit
Das Bemerkenswerte an MacBrides Romanen ist die groteske Überzeichnung von Figuren und Szenarien. Seine unverhohlene Lust am Splatter ist virtuos, aber nie geschmackloser als die Wirklichkeit selbst – ekelhafter als Roadkills Kadaversammlung ist nämlich, wie ein aufgebrachter Mob rechtschaffener Bürger den schizophrenen Außenseiter durch die Straßen treibt.
MacBride informiert sich genau über seine Sujets. Die Recherchen für Flesh House führten ihn beispielsweise auf einen Schlachthof – und er überlebte den Recherchetermin nur knapp: der an den Hinterläufen aufgehängte Kadaver einer Kuh geriet in postmortale Konvulsionen und verpasste MacBride einen Tritt an den Kopf, der ihn zu Boden warf. Das echte Leben kann es also ohne weiteres mit seinen absurden Szenarien aufnehmen. Typisch für sein situationskomisches Gespür: Er kaufte anschließend in einer dem Schlachthof angeschlossenen Fleischerei zwei ordentliche Steaks und ließ es sich schmecken – anders als die meisten Besucher, die nach einem Tag im Schlachthaus zumindest für einige Zeit zu Vegetariern werden.
Schriftsteller wollte er eigentlich nie werden, sagt MacBride, er versuchte sich trotzdem in verschiedenen Genres und Crossovers zwischen Comedy, Science Fiction und Thriller, und irgendwann hatte er dann einen Agenten. Der war es auch, der ihn anflehte: „Could you just try a straight crime novel, please!” In welchem Gewand er seine Geschichten präsentiert, ist für MacBride prinzipiell also eher zweitrangig. „Writing is not about plots, it is about character“, sagt MacBride während eines nachmittäglichen Telefonats zwischen der Casa MacBride nahe Aberdeen und einer südniedersächsischen Kleinstadt, und das ist es auch, was er als „typisch schottisch“ durchgehen lässt. Leute, die dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags anheimfallen, zeichnet MacBride mit tiefschwarzem Humor und einem unvergleichlichen Gefühl für Dialoge. Je größer der Druck in der Teamarbeit, desto düsterer und sarkastischer der Humor – das ist die eigene Erfahrung, die er in die Darstellung des Polizeialltags überträgt. Die Polizisten unter seinen Lesern und Freunden geben ihm Recht: „That’s exactly how it is“, bestätigen sie ihm.
MacBrides Vertrag mit Harper Collins sieht nur noch einen weiteren McRae-Roman vor, und er lebt merklich auf, wenn er nach seinem neuesten Buch gefragt wird: Sawbones
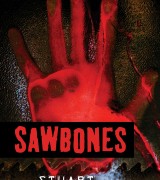 Sawbones ist nicht nur die schriftstellerische Emanzipation von seiner Erfolgsserie, sondern auch das erste Buch, das MacBride selbst wirklich mag, sagt er. Die Geschichte von einem Serienkiller, der sich das falsche Opfer aussucht – nämlich die Tochter eines Mafiabosses, dessen Schergen dem Killer nun auf den Fersen sind – spielt in den USA. Im Vergleich zu den backsteinstarken McRea-Romanen ist es mit ca. 15.000 Wörtern schlank – und das programmatischerweise. Interessant an Sawbones ist nämlich nicht nur das neue Setting, das neue Format und der Umstand, dass ein befreundeter Rezensent dem geschätzten Kollegen bescheinigt hat, nun habe er sich endlich einmal wirklich gehen lassen können. Wenn Russel McLean sagt, Sawbones sei ein Buch für Erwachsene, meint er damit nicht nur MacBrides drastischen und keineswegs jugendfreien Humor. Sawbones ist eine Auftragsarbeit: Der schottische Verlag Barrington Stoke gibt seit dem vergangenen Jahr in der Serie Most Wanted Bücher heraus, für die namhafte Autoren relativ kurze Texte schreiben. Diese Texte sollen ‚emergent readers‘ zum Lesen bringen – Erwachsene, deren Lesekompetenz unter der eines durchschnittlichen Sechstklässlers liegt (und davon gibt es nach Angaben des Verlags allein im Vereinigten Königreich um die 11 Millionen). Sawbones entstand, gemäß der Programmatik des Projekts, interaktiv. Eine Skizze des Buches ging an Testleser, die einerseits die Verständlichkeit der Texte aus der Perspektive von ‚emergent readers‘ kommentierten und andererseits Ideen einbrachten.
Sawbones ist nicht nur die schriftstellerische Emanzipation von seiner Erfolgsserie, sondern auch das erste Buch, das MacBride selbst wirklich mag, sagt er. Die Geschichte von einem Serienkiller, der sich das falsche Opfer aussucht – nämlich die Tochter eines Mafiabosses, dessen Schergen dem Killer nun auf den Fersen sind – spielt in den USA. Im Vergleich zu den backsteinstarken McRea-Romanen ist es mit ca. 15.000 Wörtern schlank – und das programmatischerweise. Interessant an Sawbones ist nämlich nicht nur das neue Setting, das neue Format und der Umstand, dass ein befreundeter Rezensent dem geschätzten Kollegen bescheinigt hat, nun habe er sich endlich einmal wirklich gehen lassen können. Wenn Russel McLean sagt, Sawbones sei ein Buch für Erwachsene, meint er damit nicht nur MacBrides drastischen und keineswegs jugendfreien Humor. Sawbones ist eine Auftragsarbeit: Der schottische Verlag Barrington Stoke gibt seit dem vergangenen Jahr in der Serie Most Wanted Bücher heraus, für die namhafte Autoren relativ kurze Texte schreiben. Diese Texte sollen ‚emergent readers‘ zum Lesen bringen – Erwachsene, deren Lesekompetenz unter der eines durchschnittlichen Sechstklässlers liegt (und davon gibt es nach Angaben des Verlags allein im Vereinigten Königreich um die 11 Millionen). Sawbones entstand, gemäß der Programmatik des Projekts, interaktiv. Eine Skizze des Buches ging an Testleser, die einerseits die Verständlichkeit der Texte aus der Perspektive von ‚emergent readers‘ kommentierten und andererseits Ideen einbrachten.
Einer von MacBrides Vorgängern bei Most Wanted war sein Kollege Allan Guthrie, ein weiterer sogenannter „Tartan Noir“-Schriftsteller. Auch wenn MacBride von dem Marketinglabel nichts wissen will: es fällt ihm leicht, Kollegen zu nennen, die er schätzt. Selbstverständlich Val McDermid, aber auch Ray Banks, und außerdem John Rickards und Mark Billingham aus England. Nett, diese Schotten. Sollte man im Auge behalten, jenseits aller Gruppenbildungen und ohne alle über einen Kamm zu scheren. Stuart MacBrides Romane – ob schwarzkariert oder nicht – sind jedenfalls äußerst lesenswert.
Nele Hoffmann
Special thanks für unbürokratisches, freundliches und kostenloses Zurverfügungstellen eines Radiostudios in Fachwerkambiente für Dokumentationszwecke an: www.stadtradiogoettingen.de
Stuart MacBride: Die dunklen Wasser von Aberdeen (Cold Granite, 2005). Roman. Aus dem Englischen von Andreas Jäger. Goldmann 2007. 542 Seiten. 7,00 Euro.
Stuart MacBride: Die Stunde des Mörders ( Dying Light 2006). Aus dem Englischen von Andreas Jäger. Goldmann 2007. 474 Seiten, 8,95 Euro.
Stuart MacBride: Der erste Tropfen Blut (Broken Skin 2007)Aus dem Englischen von Andreas Jäger. Goldmann 2008. 512 Seiten. 8,95 Euro.
Stuart MacBride: Flesh House. HarperCollins Publishers 2008. 467 Seiten. 29,99$.
Stuart MacBride: Sawbones. Barrington Stoke 2008. Erscheint im Juli 2008.











