 More of the Same
More of the Same
– In einem Interview mit mir stellte kürzlich der Moderator zufrieden fest, dass ich keinen Kriminalroman geschrieben habe, sondern einen Roman. Er wollte wissen, ob es mich nicht störe, dass ich trotzdem als Krimiautorin wahrgenommen werde. Er hat eine sehr klare Vorstellung davon, was ein Kriminalroman ist. Ich nicht. Woanders las ich „Spannungsroman“. Und ich erinnere mich noch lebhaft an die Diskussionen darüber, ob meine letzten x Bücher nun Thriller seien oder Krimis oder was.
Das Krimigenre ist ja nun sehr schnell immer vielfältiger geworden und bietet deutlich mehr als nur Söhne und Töchter von Agatha Christie oder Dashiell Hammett. Begrifflich hingegen schlägt sich diese Vielfalt nicht wirklich nieder, da bleiben erst mal der Kriminalroman und der Thriller. Diese Begriffsarmut wäre an sich nicht schlimm, wenn sich Menschen darunter nicht sehr viel klarere Dinge vorstellen würden wie unter dem Begriff „Roman“. Natürlich operiert man noch mit Adjektiven: politischer/psychologischer … Thriller; heiterer/skandinavischer/klassischer … Kriminalroman. Um ein bisschen eine Richtung vorzugeben. Aber auch da sind die Kategorien vor allem eins: klar vorgegeben.
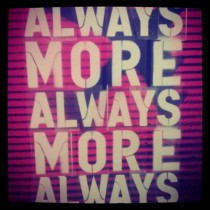 Auf dem Markt sieht das dann so aus: Wenn Bücher im Bereich Spannung verlegt werden, sollten sie einer dieser Kategorien entsprechen. Schreibt man Kriminalroman oder Thriller drauf? Und was sagt man dann dem Vertrieb: lustig, blutig, politisch, psychologisch? Prima. Im Lektorat sieht man, dass man an bekannte Muster anknüpft: Sind gerade weibliche Hauptfiguren mit Asperger in, oder gehen doch gerade eher die mit Liebeskummer und Katze? Wenn das alles schön zusammengeschnürt ist, weiß der Buchhandel, was auf ihn zukommt, in welches Regal oder auf welchen Stapel das Gelieferte gehört und welcher Kundschaft es sich verkaufen lässt.
Auf dem Markt sieht das dann so aus: Wenn Bücher im Bereich Spannung verlegt werden, sollten sie einer dieser Kategorien entsprechen. Schreibt man Kriminalroman oder Thriller drauf? Und was sagt man dann dem Vertrieb: lustig, blutig, politisch, psychologisch? Prima. Im Lektorat sieht man, dass man an bekannte Muster anknüpft: Sind gerade weibliche Hauptfiguren mit Asperger in, oder gehen doch gerade eher die mit Liebeskummer und Katze? Wenn das alles schön zusammengeschnürt ist, weiß der Buchhandel, was auf ihn zukommt, in welches Regal oder auf welchen Stapel das Gelieferte gehört und welcher Kundschaft es sich verkaufen lässt.
Der Wunsch nach diesen klaren Vorgaben kommt ja direkt aus dem Buchhandel. Dort hört man den Menschen, die Bücher kaufen, nämlich genau zu. Und was man dort hört („Bitte mehr von diesen skandinavischen Aspergerfrauen mit Katze und einem lustigen bayerischen Lebensgefährten, der schon zwölf Frauen gehäutet hat und danach immer Knödel isst, und am Ende war alles nur ein Traum“, zum Beispiel), wird an die Vertreter respektive die Verlage weitergegeben. Die geben es an die Autorenschaft weiter. „Schreiben Sie doch mal was mit Asperger. Und Knödeln. Und häuten Sie dabei Katzen. Das Blut muss spritzen.“ Die Autorenschaft schreibt, was verlangt wird. Alle sind glücklich, weil alle entweder Geld damit verdienen oder genau das Buch bekommen, das sie sich gewünscht haben. Schön.
Hinten runter fällt genau das, was nicht in diese eng gesteckten Kategorien passt. Damit sind jetzt nicht die Warengruppen des Buchhandels gemeint, in die passt ja alles nebeneinander, von Rita Falk bis Dennis Lehane, sondern die sehr klaren Vorstellungen, was und wie ein Krimi/Thriller/Dings zu sein hat. Es wird sich im Alltagsgeschäft nicht lange damit aufgehalten, ob da jemand zwischen den Stühlen sitzt. Ein Krimi muss sich rasch verkaufen. „Haben Sie was mit Knödel fressenden Katzen, die Frauen häuten? Das fand ich letztens so toll. Davon will ich mehr.“ – „Aber natürlich, der Stapel liegt gleich hier.“ Und nicht etwa: „Äh nein, aber es werden Männer gehäutet, obwohl nicht richtig, und Katzen kommen auch nicht vor, eigentlich nicht mal Knödel, trotzdem ist das ein sehr …“ Und schon ist die Kundschaft weg.
So hab ich es mir nun jahrelang erklären lassen. So scheint es zu stimmen.
 Warum ich das denke? Weil eben wirklich immer nach mehr desselben gerufen wird. Zunächst absolut verständlich. Lieblingsserie, Lieblingsmusik, das soll bitte für immer so weitergehen. Bis man sich selbst daran sattgesehen/-gehört/-gelesen hat und alles anders ist. Dann vom nächsten bitte wieder so viel, dass man sich damit vollstopfen kann, immer mehr davon, danke. Sieht man sich an, was im Selfpublishing erfolgreich ist, dann sind es die klaren Genretexte, die mit den gängigen Schlüsselreizen arbeiten. Der Bereich, der sich so wunderbar für Experimente, für Abseitiges, für Ungewöhnliches anbietet, spiegelt letztlich die analoge Bücherwelt. Eindeutige Warengruppen. Eindeutige Subgenres. Der Mainstream eroberte den Indiemarkt in kürzester Zeit.
Warum ich das denke? Weil eben wirklich immer nach mehr desselben gerufen wird. Zunächst absolut verständlich. Lieblingsserie, Lieblingsmusik, das soll bitte für immer so weitergehen. Bis man sich selbst daran sattgesehen/-gehört/-gelesen hat und alles anders ist. Dann vom nächsten bitte wieder so viel, dass man sich damit vollstopfen kann, immer mehr davon, danke. Sieht man sich an, was im Selfpublishing erfolgreich ist, dann sind es die klaren Genretexte, die mit den gängigen Schlüsselreizen arbeiten. Der Bereich, der sich so wunderbar für Experimente, für Abseitiges, für Ungewöhnliches anbietet, spiegelt letztlich die analoge Bücherwelt. Eindeutige Warengruppen. Eindeutige Subgenres. Der Mainstream eroberte den Indiemarkt in kürzester Zeit.
Gefährlich an dieser Entwicklung, an diesem In-Auftrag-Geben von Literatur, ist die Verwirrung, die bei nicht wenigen Autor*innen immer größer wird. Viele sind eigentlich nur noch Auftragsschreiber*innen und quälen sich sogar so weit, dass sie auf Facebook oder ihrer Homepage ihr Publikum fragen: „Was soll ich euch denn als Nächstes schreiben? Wie hättet ihr’s denn gern?“ Der Mut zu eigenen Geschichten geht dadurch verloren. Der Mut, etwas zu wagen, etwas anders zu machen. Neues auszuprobieren. Grenzen zu überschreiten. Für sich selbst weiterzukommen und – große Worte – das Genre voranzubringen. Mehr große Worte, diesmal von Henry Ford: „Hätte ich damals die Leute gefragt, was sie wollen, sie hätten gesagt: schnellere Pferde.“
Am Ende steht ein Krimibegriff, der eben Rita Falk und Dennis Lehane vereinen soll, und das ist nicht möglich. Selbst wenn man auf das eine Buch Kriminalroman und auf das andere Thriller draufschreibt. Irgendwie hinkt es, und irgendwie wird von außen doch wieder so draufgeschaut, als sei es alles eins, nämlich Krimi, und damit Genre, und damit na ja, was zum Entspannen, bestenfalls. Der Begriff Kriminalroman umfasst so viel Unterschiedliches wie der Roman, der Schund und Kitsch und Weltliteratur und Schönheit sein kann.
Wahrscheinlich gibt es zwei Herangehensweisen ans Lesen. Bei der einen wird immer mehr vom immer Selben gefordert. Erwartungen sollen erfüllt werden. Autor*innen haben dann die Funktion, diesen Service auszuführen. Bei der anderen soll etwas Neues entdeckt werden, überrascht werden, gefordert werden. In dem Fall haben Autor*innen die Aufgabe, dieses Neue zu erschaffen.
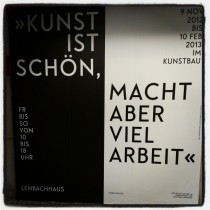 Ich habe Angst, dass der Raum für Neues, für anderes im Krimi immer kleiner wird. Dass Genreliteratur zur Dienstleistungsliteratur verkommt, eigentlich sogar zu formula fiction. Jahrzehntelang kämpften Krimibegeisterte dafür, dass der Kriminalroman nicht als billig oder zweitklassig gilt, neben der echten, wahren, schönen Literatur, sondern dass sein Platz mitten in dieser echten, wahren, schönen Literatur ist. Immer gab es Autor*innen im Kriminalroman von literarischem Weltniveau, aber der Ruf des Genres bleibt schmuddelig. Krimis sind doch die Dinger mit dem lustigen/besoffenen/depressiven Kommissar, der geschieden ist und in jedem Band einen psychopathischen Serienkiller jagt? Und Thriller sind doch die Dinger, in denen wir aus der Perspektive des psychopathischen Serienkillers bzw. der des Opfers des psychopathischen Serienkillers die Geschichte mitverfolgen?
Ich habe Angst, dass der Raum für Neues, für anderes im Krimi immer kleiner wird. Dass Genreliteratur zur Dienstleistungsliteratur verkommt, eigentlich sogar zu formula fiction. Jahrzehntelang kämpften Krimibegeisterte dafür, dass der Kriminalroman nicht als billig oder zweitklassig gilt, neben der echten, wahren, schönen Literatur, sondern dass sein Platz mitten in dieser echten, wahren, schönen Literatur ist. Immer gab es Autor*innen im Kriminalroman von literarischem Weltniveau, aber der Ruf des Genres bleibt schmuddelig. Krimis sind doch die Dinger mit dem lustigen/besoffenen/depressiven Kommissar, der geschieden ist und in jedem Band einen psychopathischen Serienkiller jagt? Und Thriller sind doch die Dinger, in denen wir aus der Perspektive des psychopathischen Serienkillers bzw. der des Opfers des psychopathischen Serienkillers die Geschichte mitverfolgen?
Die Begrifflichkeit ist so spezifiziert, so eng geworden, dass gern in der Presse von Kriminalromanen gesprochen wird, die „mehr als nur ein Krimi“ sind. Was Quatsch ist. „Nur Krimi“ ist schon falsch. Und was ist dann „mehr als“? Wenn es politisch wird, gesellschaftlich, familiär, lustig, romantisch? Gehört alles zum Kriminalroman. Alles ist möglich im Kriminalroman. Auch der Thriller ist Kriminalroman. Und wäre es nicht schön, die Geschichten danach zu beurteilen, was sie sind, und nicht danach, was wir an diesem Tag gern gelesen hätten? Wenn der eine Kollege mit seinem unerwarteten Ende überrascht (der Betroffene wird sich hier wiedererkennen, ohne dass ich Namen nennen muss) – warum ihn fertigmachen? Warum nicht mal sagen: Okay, so hat er sich entschieden, gefällt mir oder nicht, aber so hat er seine Geschichte erzählt? Statt zu sagen: Ich will aber, dass es soundso ausgeht?
 Das, wovor alle Angst haben, wenn Amazon das Leseverhalten via eBooks auswertet, nämlich maßgeschneiderte Texte für das Publikum, ist längst da. Wobei natürlich unklar ist, ob die Leute wirklich immer dasselbe lesen wollen. Man bietet ihnen eben nur immer dasselbe an, bis sie es gar nicht mehr wollen. Man lässt im Buchhandel den Alternativen zu wenig Zeit. Verkauft sich ein Titel nicht in den ersten drei, vier Wochen, dann war’s das. Die ganzen Abläufe sprechen dagegen, dass dieser Titel noch eine Chance bekommt. Es kommen neue Bücher, die Buchhandelsregale müssen leer geräumt werden. Weg damit, her mit etwas, mit dem wir auf der sicheren Seite sind.
Das, wovor alle Angst haben, wenn Amazon das Leseverhalten via eBooks auswertet, nämlich maßgeschneiderte Texte für das Publikum, ist längst da. Wobei natürlich unklar ist, ob die Leute wirklich immer dasselbe lesen wollen. Man bietet ihnen eben nur immer dasselbe an, bis sie es gar nicht mehr wollen. Man lässt im Buchhandel den Alternativen zu wenig Zeit. Verkauft sich ein Titel nicht in den ersten drei, vier Wochen, dann war’s das. Die ganzen Abläufe sprechen dagegen, dass dieser Titel noch eine Chance bekommt. Es kommen neue Bücher, die Buchhandelsregale müssen leer geräumt werden. Weg damit, her mit etwas, mit dem wir auf der sicheren Seite sind.
Wie lange wird das wohl noch weitergehen? Wie lange werden Genrebegriffen noch misshandelt und fehlgedeutet und zurechtgeschrumpft, um mehr Kopien von einem Erfolgstitel zu produzieren? Es ist ja nicht nur beim Kriminalroman so. Ehrlich, so macht das auf Dauer keinen Spaß. Ich wünsche mir: mehr Mut bei den Autor*innen, mehr Entdeckerfreude bei Leser*innen. Und mehr den Blick nach vorn bei all den Stationen zwischen Autorin und Leserin, nicht immer nur nach hinten.
Zoë Beck
Zoë Beck ist Autorin (hier geht es zu ihrem Blog und zu ihrer Homepage hier) und Verlegerin des Digitalverlags CulturBooks (mehr hier). Porträtfoto: © Victoria Tomaschko. Fotos: © Zoë Beck.











