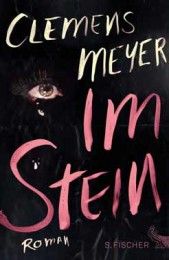Willkommen
Willkommen
zum CM-Jahresrückblick, Teil II (G–M): Der kaleidoskophafte Rückblick, der andere Rückblicke überflüssig macht! Also nehmen Sie sich Zeit, verproviantieren Sie sich, halten Sie Bleistift und Papier für letzte Einkäufe, Geschenke und Belohnungen für sich selbst bereit und freuen Sie sich mit uns, spotten Sie mit uns und vor allem: Amüsieren Sie sich gut! (Zu Teil I und Teil III).
 Tobias Gohlis
Tobias Gohlis
Die grandiose Entdeckung des Jahres: James Carlos Blake: „Böses Blut“. Kein Kriminalroman im engeren Sinn, Epos. Ein Grimmelshausen der USA, nur dass Simplizius sich im Brüderpaar John und Edward verdoppelt hat und sie nie eine Sprache finden für das, was ihnen geschieht. Es herrscht eine Passivität, die an Büchners Fatalismus erinnert. Die Brüder machen, was ihnen diktiert wird, um zu überleben. Vom Vater lernen sie: „Egal, worum ihr kämpft, seid immer bereit, dafür zu sterben. Das ist der Trick dabei, Jungs.“ Und das machen sie. Ein Epitaph auf alle Jungs, die im Krieg verheizt wurden.
Sehr instruktiv dazu Alf Mayers Hintergrundpanorama bei Culturmag.
Unvergesslich: die blauen Pantoffeln Charyns. Jerome trug welche, als er mir die Türe öffnete. David Pearl trägt auch welche, der ewige Gangsterjude, der im Dienstmädchenstockwerk des Ansonia haust, Sidel zum Präsidenten machen und die Bronx an die Army verticken will. Ach, das Ansonia! Flure, in denen man Volleyball spielen könnte, die Rohrpost, die Fenster, aus denen man die Nachbarn beobachten kann, die Millionäre gegenüber. Verschwunden das Bassin mit den Robben und der Swingerclub Plato’s Retreat. Drei Tage New York – eine Dienstreise fürs Leben.
Erstaunlich, erfreulich: KRIMIS MACHEN 1! Sie schienen alle drauf gewartet zu haben: Autoren, Lektoren, Agenten, Buchhändler, Kritiker. Der Laden-Saal des Brechthauses knackevoll, freundliche Diskussionen, keine Aufschreie der Unterdrückten, Zukurzgekommenen und vermeintlich Verachteten – gute Krimis machen wollen alle. So sehr, dass ich von jetzt an immer „Kriminalroman“ von Krimi (oder von „Grimmi“, wie Wörtche mannheimerisch mümpfelt) unterscheiden werde. Ein grandioser Anfang, der sehr wahrscheinlich im Juni 2014 seine Fortsetzung haben wird. Aber da wird es – wieder auf Augenhöhe, diese Errungenschaft geben wir nie mehr her – härter zur Sache gehen müssen. „Cashcow oder Literatur?“ Die Lage spitzt sich zu: Das Dumpfbackige, kommerziell Flache wächst, beansprucht immer mehr Raum, und das gefällt dem erschöpften Publikum. Die Klugen müssen raffinierter werden! Besser gefallen, schöner einleuchten, klarer denken, subtiler navigieren!
In jüngster Zeit habe ich mehrmals von LeserInnen gehört, die Empfehlungen der KrimiZEIT-Bestenliste seien „anstrengend“.
Snowden – der Held. Tapferer, entschlossener, kluger Mann, hockt jetzt nicht ganz im selben Loch (mehr Cola, mehr Freigang, mehr Luft) wie die Pussy-Riot-Frauen. Erstaunlich, bewundernswert, dass es solche Leute noch und immer wieder gibt.
Zu den CM-Beiträgen von Tobias Gohlis. Foto: Marco Grundt
 Frank Göhre
Frank Göhre
Mein Jahresrückblick
Januar. Thalia Theater, Hamburg:
Jeder stirbt für sich allein
nach dem Roman von Hans Fallada.
Eine beispielhafte Inszenierung von Luk Perceval
über moralische Verantwortung. 4 ½ Stunden äußerst intensives Bühnenspiel.
März. Casino Kampnagel, Hamburg:
Als Kleindarsteller beim Dreh des ältesten Jungfilmer Hamburgs,
Torsten „Stickel“ Stegmann, Krasser Move (Premiere 18. Januar 2014).
Mit Timo Jacobs, Lenka Arnold, René Chambalu, Reverend Christian Dabeler u.a.
April. Hamburg:
Die Jagd. Ein Film von Thomas Vinterberg („Das Fest“).
Ein Lehrer wird (zu Unrecht) bezichtigt, sich vor einem kleinen Mädchen
entblößt zu haben. In der dänischen Provinzstadt wird die Jagd auf ihn
eröffnet. – Beklemmend.
Mai. Amsterdam:
Neu gelesen: Die McCorkle/Padillo- und die
Artie Wu/Quincy Durant-Romane von Ross Thomas.
Juni. Theater in der Josefstadt, Wien:
Aus Liebe von Peter Turrini.
Momentaufnahmen, Szenen eines Tages, den Stunden vor der Tat:
Ein 40-jähriger Mann erschlägt Frau und Kind mit einer Axt.
Mit dem Autor himself auf der Bühne.
Juli. Prince Charles, Berlin:
Präsentation des neuen Albums 2Raumwohnung, Achtung Fertig.
Eine Reise durch Raum & Zeit. Elektropop zum Abheben.
Einen Spätnachmittag lang in anderen Welten.
September. Insel Samos, Griechenland:
Neu gelesen 12 Elmore Leonhard Romane.
Und: Clemens Meyer, Im Stein. Der ultimative Roman über die
Sex-Arbeit in Leipzig.
Oktober. Hansa Theater, Hamburg:
Eröffnung der neuen Varieté-Spielzeit.
Georg Schramm nimmt sich die feine Hamburger Gesellschaft vor.
Was sie mit ihrem Geld (sozial) alles machen könnte. Einer seiner letzten
Auftritte als renitenter Rentner Dombrowski.
November. Hamburg:
Meine KEINE Familie. Ein Dokumentarfilm von Paul-Julien Robert.
Der Regisseur ist in der Otto Mühl-Kommune aufgewachsen,
geht auf eine Reise in seine Vergangenheit, spürt auch seinen leiblichen Vater auf.
Erstmalig gezeigt: Archivmaterial über den Alltag in der Sekte – Horror, Horror, Horror!
Platz 1, Christian Geissler: „Wird Zeit, dass wir leben“
Neuauflage mit einem ausführlichen Nachwort von Detlef Grumbach über die wahre Geschichte des Widerstands der Hamburger Kommunisten gegen die Nazis. (360 Seiten, 22 Euro, Verbrecher Verlag, Berlin).
Platz 2, Clemens Meyer: „Im Stein“
Puffbonzen, Luden & Nutten in Leipzig und anderswo oder auch: Kohle schnappen.
560 Seiten, 19.99 Euro, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main
Platz 3, Wolfgang Herrndorf: „Arbeit und Struktur“
Notizen und Reflektionen aus den Jahren vor dem Selbstmord.
448 Seiten, 19.95 Euro, Rowohlt Verlag, Berlin
Platz 4, Wolf Wondratschek: „Mittwoch“
Allein schon wegen der großartigen Passage über das Rauchen lesenswert (S. 151 ff).
244 Seiten, 22 Euro, Hund und Jung Verlag, Salzburg/Wien
Platz 5 Ernest Hemingway/F. Scott Fitzgerald: „Wir sind verdammt lausige Akrobaten“
Eine Freundschaft mit Briefen. Herausgegeben von Benjamin Lebert (gut) und mit einem Vorwort von ihm (gar nicht gut, weil geschwätzig und selbstverliebt).
Zu den CM-Beiträgen von Frank Göhre.
 Lutz Göllner
Lutz Göllner
Juutet Ding: Es wäre ja zu schön, wenn Elmore Leonard fester Bestandteil der sogenannten „Suhrkamp-Kultur“ – die sich soooo gerne selbst beweihräuchert – wird, aber ich bin da eher skeptisch.
Robert B. Parkers „Spenser“-Romane – mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Und es fehlen immer noch Bände, die die Lücke zwischen Rowohlt und Pendragon schließen. Dafür kommen jetzt Parkers „Jesse Stone“-Bände etwas schneller, in diese Serie hatte der Alte vor seinem Tod viel mehr Herz und Seele gelegt, als in den zum Schluss doch etwas redundanten Spenser. Und dann gibt es da noch den Schweizer Europa-Verlag, der langsam aber sicher die Western um „Hitch & Cole“ aufarbeitet.
William Boyd hat mit „Solo“ den besten „Bond“-Roman vorgelegt, seit die Fleming-Erben den Texaner Raymond Benson gefeuert haben. Derweil zieht Cross Cult seine Neu-Edition von Ian Flemings „James Bond“ präzise wie ein Uhrwerk durch. Gute Übersetzung und tolle Cover. Angekündigt wurde jetzt, dass es mit Kingsley Amis‘ (gut!) und John Gardners (naja) Bänden weiter geht.
Meckern: Seit zehn Jahren hat jetzt James Lee Burke keinen deutschen Verlag mehr. Max Allan Collins bringt es auf 14 Jahre, Loren D. Estleman sogar auf 23 Jahre Absenz vom deutschen Markt. Schande!
Film: Ich kann es nicht mehr hören: Tom Cruise kann aber nicht Jack Reacher spielen, der ist einen Kopf zu klein, laberlaberrunterschalt. Das ist mir komplett Wumpe! Auch wenn der alte Scientologe glaubt, der liebe Gott wäre eine Hutablage aus dem Weltall, ist er eben doch ein guter Schauspieler. Und hat die Attitüde von Jack Reacher genau auf den Punkt getroffen. Ich jedenfalls fühlte mich von Christopher McQuarries Film prima unterhalten, gute altmodische Action, hart und mit ganz viel Humor.
Auch eher in die Kategorie Jungensfilm stieß der Isländer Baltasar Kormákur mit der Comicverfilmung „2 Guns“. Denzel Washington und Mark Wahlberg sind zwei Undercover-Agenten, die nichts von einander wissen. Wird wohl demnächst „Last Boy Scout“ in der Liste meiner liebsten No-Brainer ersetzen.
TV: Alle – wirklich alle – loben „Homeland“ über den grünen Klee. Jaja, gut geschrieben, toll gespielt, trotzdem ist die israelische Urfassung „Hatufim“ viel düsterer, böser, realistischer. Und mein Herz fliegt dann doch eher anderen US-Serien zu.
Elmore Leonards „Justified“ etwa ist auf ironische Art so Macho, hat so viel schwarzen Humor und mit Walter Goggins einen so kotzbrockigen Schurken, da wachsen mir schon aus reiner Sympathie büschelweise die Brusthaare. Der aus dem Jahr 1997 stammende TV-Film „Pronto“, der immerhin von Martin Scorseses Kommilitonen Jim McBride („The Big Easy“) stammt, könnte übrigens eine Art Pilotfilm für „Justified“ sein. Hier spielte James Le Gros den Marshall Raylan Givens, der hinter Peter Falk her ist. In der kommenden fünften Staffel von „Justified“ bekommt Le Gros, der bereits seit Season 2 mal auftauchte, nun eine ständige Gastrolle. Und auch Karen Sisco aus „Out Of Sight“ taucht in „Justified“ auf. Ich liebe solche Ostereier für Fanboys.
Für mich der beste Neustart: „Ray Donovan“ ersetzt bei Showcase den ausgelutschten „Dexter“. Liev Schreiber, der sich immer mehr zu einem meiner Lieblingsschauspieler entwickelt, als Ausputzer für Hollywoods Reiche und Schöne. Der alte „Asphalt Cowboy“ Jon Voight als sein krimineller Vater, der Rache will. Dazwischen eine dysfunktonale Familie, die langsam aber sicher aufgerieben wird. Mal sehen, wie sich das entwickelt…
Und obwohl ich kein Freund des Serienmörder-Genres bin, muss ich gestehen: „Hannibal“ sieht wahnsinnig gut aus, hat einen ganzen Arsch voll toller Schauspieler und ist verdammt gruselig. Ich persönlich hätte lieber das vorherige Projekt von Bryan Fuller, seine Version der „Munsters“, weiter gesehen, aber „Mockingbird Lane“ kam ja leider nicht über einen Pilotfilm hinaus.
Stephen King hatte in den letzten Jahren zumindest künstlerisch ein Comeback (kommerziell war er ja immer da), „Die Arena“ und „Der Anschlag“ waren tolle Schmöker. Die TV-Serie „Under The Dome“ fand ich persönlich zwar doof, viele andere Zuschauer aber nicht.
Musik: Und dann gab es da noch das Projekt „Ghost Brothers Of Darkland County“, ein Southern-Gothic-Musical, das King gemeinsam mit John Mellencamp und T Bone Burnett schrieb. Im Sommer ist nun die CD-Version dazu erschienen, voll mit Gaststars wie Elvis Costello, Sheryl Crow, Kris Kristofferson und hastenichjesehn. Und hier lebt, was bei Tom Waits zuletzt nur noch geklebt hat, hier wird das Musical rehabilitiert. Irgendwo zwischen Blues, Folk und Americana angesiedelt und ziemlich unheimlich.
Zu den CM-Beiträgen von Lutz Göllner.
 Birgit Haustedt
Birgit Haustedt
Fünf Minuten mit Don Giovanni und sechs Stunden im „Haus Lebensbaum“ – die ungewöhnlichsten Erfahrungen habe ich in diesem Jahr im Theater gemacht: in „Don Giovanni. Letzte Party“ des Hamburger Thalia-Theaters (Regisseur: Antù Romero Nuntes“) und bei der Theater-Performance „Schwarze Augen, Maria“ der dänischen Gruppe Signa.
Als „Don Giovanni“ als blöde Mitmachübung startete – das Publikum sollte „blablablas“ nach der Melodie von „La ci darem la mano“ intonieren, dachte ich zwar erst, das war’s mit Mozarts schönster Oper. Am Schluss aber stand ich selbst mit auf der Bühne und sang genau diese Arie mit. Dazwischen lag die beste Theaterpause, die ich je erlebt habe.
Don Giovanni hatte geladen: Hundert Frauen aus dem Publikum, die sich trauten. Für jede eine weiße Maske plus ein Glas Sekt und die Pausen-Party auf der Bühne begann, hinter geschlossenem Vorhang natürlich. Statt Mozart spielte eine Frauen-Combo Dancefloorhits, irgendwann flog ein schwarzer BH durch die Luft, jeder flirtete jede an, allen voran Don Giovanni (Sebastian Zimmler mit hippeliger Rockstarerotik). Dass Zerlina in der Oper für fünf Minuten mit ihm ihr ganzes Leben aufgeben will, einfach nur weil sie sich begehrt fühlt – davon bekam frau mehr als eine Ahnung bei dieser „Backstageparty“.
Irgendwann ging der Vorhang wieder hoch, plötzlich fand man sich auf der Bühne, immerhin maskiert, wieder. Als Don Giovanni längst zur Hölle gefahren war, standen wir als letzte Partygäste noch auf der Bühne und summten „La ci darem la mano“ mit. Erstaunlicherweise fühlte sich das gut an. Selten bin ich so beschwingt aus einer Oper herausgegangen.
 Ganz anders, sehr verstörend: „Schwarze Augen, Maria„, mit der Karin Beier die Saison des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg eröffnete. Spielort: eine verlassene Schule in Wandsbek, ausstaffiert als psychiatrische Klinik „Haus Lebensbaum“, die wir Zuschauer besuchten. Wie bei einem richtigen „Tag der offenen Tür“ wanderte man durch die verschiedenen Zimmer, landete mal in der Sprechstunde von Heimleiter Dr. Mittag (Motto: „Hier ist keiner behindert, nur besonders“) oder beteiligte sich an therapeutischen Mal- und Singaktionen. Vieles ging an Grenzen, wie die Wohnungen der Insassen: überall Zeugs, Puppen, Klamotten, Abfall. Man saß auf einem schmuddeligen Sofa, die Kaffeetassen hatten Schmutzränder. Am Anfang waren alle verlegen – bis man sein Ekelgefühl und seine Abwehr überwand, die Bewohner akzeptierte, ihnen zuhörte, mit ihnen sprach. Überraschenderweise mochte man sie dann auch: die apathischen jungen Mütter, Maria-Maria mit den unterdrückt aggressiven Gesten oder Mindy, für die ich schließlich sogar fetten Speck schnippelte.
Ganz anders, sehr verstörend: „Schwarze Augen, Maria„, mit der Karin Beier die Saison des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg eröffnete. Spielort: eine verlassene Schule in Wandsbek, ausstaffiert als psychiatrische Klinik „Haus Lebensbaum“, die wir Zuschauer besuchten. Wie bei einem richtigen „Tag der offenen Tür“ wanderte man durch die verschiedenen Zimmer, landete mal in der Sprechstunde von Heimleiter Dr. Mittag (Motto: „Hier ist keiner behindert, nur besonders“) oder beteiligte sich an therapeutischen Mal- und Singaktionen. Vieles ging an Grenzen, wie die Wohnungen der Insassen: überall Zeugs, Puppen, Klamotten, Abfall. Man saß auf einem schmuddeligen Sofa, die Kaffeetassen hatten Schmutzränder. Am Anfang waren alle verlegen – bis man sein Ekelgefühl und seine Abwehr überwand, die Bewohner akzeptierte, ihnen zuhörte, mit ihnen sprach. Überraschenderweise mochte man sie dann auch: die apathischen jungen Mütter, Maria-Maria mit den unterdrückt aggressiven Gesten oder Mindy, für die ich schließlich sogar fetten Speck schnippelte.
Als wir „Gäste“ uns dann nach vielen Stunden für die Abschlussfeier aus Papptellern, Wollfäden und Luftballons Hüte basteln sollten, kam uns das auch nicht mehr seltsamer vor als andere Partyrituale. Bis zum Schluss hielten alle Akteure ihre Rollen, ihre Macken, ihre speziellen Symptome durch. Erst am Ausgang erfuhr man die Namen der Schauspieler. Da aber hatte man sie bereits mit ihren Spitznamen aus dem Stück ins eigene Leben mit aufgenommen. Nicht als Witzfigur oder Karikatur, sondern als besondere Menschen, tragische Existenzen.
Weit nach Mitternacht setzten sich wildfremde Theaterbesucher in der U-Bahn zueinander und redeten noch lange über das, was ihnen da wiederfahren war.
Tipp: Don Giovanni. Letzte Party. Thalia-Theater Hamburg. Nächste Vorstellung: 31. Dezember 2013.
Schwarze Augen, Maria, ehemalige Elise-Averdieck-Schule Hamburg, Vorstellungen vom 15.-27. Januar 2014.
Zu den CM-Beiträgen von Birgit Haustedt.
 Brigitte Helbling
Brigitte Helbling
ZUM NIEDERKNIEN: „Schmythologie“ von Jochen Schmidt, wegen der Schmuggelware aus Comic und bildender Kunst in den wunderbaren Bildtafeln von Line Hoven.
ZUM VERLIEBEN: Greta Gerwigs Erfindung/Darstellung von Frances Ha in Noah Baumbachs Film „Frances Ha“.
ZUM WIEDERENTDECKEN: „Mr. Wilsons Wunderkammer“ von Lawrence Weschler von 1998 (leider vergriffen), über Sammeln, Staunen, und die Postmoderne als Prämoderne im Museum.
LANGWEILIG: Die Kulturredaktion der SZ: Lässt in ihrer Umfrage unter deutschen Künstlern und Intellektuellen zum „Buch des Jahres“ (10. Dezember 2013 ) 50 Männer und gerade mal 11 Frauen zu Wort kommen. Mehr relevante Damen sind den Blattmachern nicht eingefallen? Wenn’s ein Kabinett-Vorschlag wäre… ich würd die Partei nicht wählen wollen.
Zu den CM-Beiträgen von Brigitte Helbling.
 Jan Karsten
Jan Karsten
Spannend fand ich 2013 die sich neu entwickelnde eBook-Verlagsszene (mit u.a. Frohmann, Mikrotext und, hüstel, unserem kleinen CulturBooks-Verlag). Hier werden neue Formen und Formate ausprobiert und eigenständige eBooks gemacht – mit viel kreativer, künstlerischer und literarischer Energie. Bleibt für 2014 zu hoffen, dass eine immer breitere Öffentlichkeit erkennt, dass sich der eBook-Markt langsam aber sicher von Shades-of-Grey-artigen Schwachsinnigkeiten emanzipiert und zunehmend Relevanz entwickelt. Ein aufregender Prozess, der noch viele (weitere) Perlen hervorbringen wird.
Etwas komplett Anderes: Große Freude über die enorme Energiedichte von George Carlins Highspeed-Paranoia-Spoken Word-Comedy, dem HBO-Special „Jammin‘ in New York“, das 1992 entstand und in diesem Jahr in voller Länge auf Youtube aufgetaucht ist. Erstaunlich, wie ziemlich gut das mehr als zwanzig Jahre später immer noch funktioniert.
 Joe Paul Kroll
Joe Paul Kroll
Aus dem letzten Jahr weit ins nun ebenfalls schon ausklingende hineingeragt hat Michael Chabons Roman „Telegraph Avenue“, der hoffentlich auch bald ins Deutsche übersetzt wird. Ganz davon abgesehen, dass man gerne noch viel mehr Zeit zwischen Oakland und Berkeley, zwischen Blaxploitation-Nostalgiewelt und alternativer Hebammenpraxis zugebracht hätte: Das Buch hat für Enge in meinem Plattenregal gesorgt.
Denn den Soundtrack liefert die Musik an der Schnittstelle von Jazz, Funk und Soul, zu der nicht nur Miles Davis mit „Bitches Brew“ oder „On the Corner“ und Freddie Hubbard in seiner mittleren Periode beigetragen haben, sondern auch mir zuvor unbekannte Instrumentalisten wie Charles Kynard (mehr hier) und Lonnie Smith (beide Orgel), Melvin Sparks (Gitarre) oder Idris Muhammad (Schlagzeug).
Eine besonders glückliche Entdeckung war für mich der Gitarrist Grant Green, der schon in klassischen Blue Note-Ensembles mit Größen wie Herbie Hancock, Larry Young und McCoy Tyner spielte, seine Karriere um 1970 herum reaktivierte (leider nicht auf Dauer) und dessen Gesamtwerk hiermit nachdrücklich empfohlen sei. Nur auf die Platte „Redbonin“ (CTI, 1971) des von Chabon erschaffenen Cochise Jones, dem grantigen Hammond-Genie und kommunistischen Papageienfreund, wird man leider verzichten müssen.
Einen weiteren großartigen Roman hat Rachel Kushner mit „The Flamethrowers“ vorgelegt. Kunst, Terror, Motorräder, Sex – was will man mehr, zumal wenn die sprachliche und erzählerische Gestaltung so hervorragend gelungen ist. Auch hier lässt die deutsche Übersetzung noch auf sich warten. Bis dahin verweise ich noch auf die Besprechung durch James Wood.
2013 war, es wird niemandem entgangen sein, das Camus-Jahr. Ein bedeutendes Ereignis ist (und abermals kann ich nur an die deutschen Verlage, in diesem Fall wohl Camus’ Hausverlag Rowohlt, appellieren) die englische Übersetzung seiner „Chroniques algériennes“. Auch nach 50 Jahren hat es die Einsicht, dass man den Prozess der Entkolonisierung kritisieren kann, ohne dabei die Verbrechen des Kolonialismus zu relativieren, schwer. Camus gelang dies, trotzdem hat er sich damals nichts als Ärger eingehandelt. Als persönlichen Blick auf dieses Buch möchte ich noch Claire Messuds Essay in der New York Review of Books empfehlen. Das wichtigste deutschsprachige Buch zum Jubiläum hat Martin Meyer mit „Albert Camus: Die Freiheit leben“ geschrieben. Meyer gelingt das Kunststück, ein im Kern belletristisches Lebenswerk als Denkweg fasslich zu machen, ohne es in ein System zwängen zu wollen.
Mit Comics & Graphic Novels beschäftige ich mich nur am Rande, möchte aber doch die Neuausgabe von „Die Abenteuer von Hergé“ loben, dessen Autoren dem Stil des Meisters die Reverenz erweisen, ohne dabei bis zur Parodie zu gehen.
Wohl keiner weiteren Empfehlung bedarf „Warum ich kein Christ bin“ von Kurt Flasch, der beweist, dass man den Glauben ohne Rekurs auf platten Positivismus kritisieren und – noch viel überraschender! – es mit einem theologisch und philosophisch anspruchsvollen Buch auf die Bestsellerlisten schaffen kann. Als ergänzende Lektüre eignet sich hervorragend „Die Frage nach Gott“ von Norbert Hoerster.
Zu den CM-Beiträgen von Joe Paul Kroll.
 Anne Kuhlmeyer
Anne Kuhlmeyer
NUR Bücher, Bücher, Bücher … Es hat schlechtere Jahre gegeben als dieses. Barbarische, hungrige, eisige, trostlose, kulturlose. Jahre mit Bücherscheiterhaufen und welche, in denen die Bücher unter der Hand weitergegeben wurden wie Drogen. Im letzten ging es uns literarisch saugut. Bis Oberkante Unterlippe. Überflutet von Büchern in Pink und Himmelblau, mit Horror- und Erotiktrash, mit Ratgebern und Mimikrimibettlektüre. Unter den Bergen von Papier- und Elektronikunfugtexten lugen aber auch spannende Novellen wieder hervor, feine Gedichte, kluge Romane oder Grotesken.
Was also ist das für eine Zeit, die solche Bücher schreibt? Und wie herum ist das eigentlich? Wird angeboten, was gelesen wird? Oder wird gelesen, was angeboten wird?
In jedem Falle muss man aufpassen, was man in seinen Kopf hinein tut. 2013 fand ich Bücher, die sich in meinem Kopf verankert haben, haltbare Bücher, mit denen man noch ein Stück des Wegs gehen kann.
Jerome Charyn, Unter dem Auge Gottes, Kriminalroman, Diaphanes Zürich-Berlin, 2013; Aus der Reihe: Penser Pulp, Hrsg. Thomas Wörtche, S. 288, 16,95 Euro, zur Rezension.
Garry Disher, Dirty old Town, Kriminaroman, Pulp Master Verlag, Berlin, 2013, S. 322, 13,80 €, zur Rezension.
Zoë Beck, Brixton Hill, Thriller, Heyne Verlag, München, 2013, S. 384, TB 8,99 Euro, eBook 7,99 €, zur Rezension.
Carlo Schäfer, Der Tod dreier Männer, Roman, CulturBooks Hamburg, 2013, S.100, 5,99 €, zur Rezension.
Hans Zengeler, Das letzte Geheimnis, Roman, 2013, VAT Verlag André Thiele, Mainz, S. 203, Hardcover inkl. E-Book: 16,90 €, zur Rezension.
Gary Dexter, Der Marodeur von Oxford, Roman aus der Reihe „Penser Pulp“, Hg. Thomas Wörtche, Übersetzerin: Zoë Beck, Diaphanes Verlag Zürich-Berlin, 2013, S.304, 16,95 €, zur Rezension.
Alice Spogis, Burn out – für immer auskuriert, Kriminalroman, Sutton Verlag Erfurt, 2013, S. 380, 12,00 €, zur Rezension.
Lena Blaudez, Spiegelreflex, Kriminalroman, (Erstauflage: Unionsverlag 2006, Metro-Reihe) Longplayer, CulturBooks, Hamburg, 2013, S. 250, 5,99 €, zur Rezension.
Katia Fouquet, Albert Camus, Jonas oder der Künstler bei der Arbeit. Eine Graphic Novel, Edition Büchergilde, Berlin, 2013, S. 160, 24,95 €, zur Rezension.
Jan Lindner, Der Teddy mit den losen Kulleraugen, Lyrik, Periplaneta-Verlag, Berlin, 2013, S.83, beiliegende CD, 12,50 €, zur Rezension.
Zu den CM-Beiträgen von Anne Kuhlmeyer.
 Stefan Linster
Stefan Linster
Jahresende, was bleibt vom gesehenen, gelesenen … Manch Hervorragendes, bei näherer Betrachtung. Etwa die brillante Ausstellung im Kunstmuseum Bonn „HEIMsuchung (sic). Unsichere Räume in der Kunst der Gegenwart“.
Überwiegend Installationen führten vor Augen, wie unheimlich das oft so gar nicht traute Heim, wie bedroht oder selbst bedrohlich dieses Refugium sein kann, ja untergründig ist, mit der Folge einer materiellen wie ontologischen Unbehaustheit, deren wir uns so eindringlich vielleicht nicht bewusst waren. Ein bestens ausgestattetes Expeditionszelt beispielsweise, Sämtliches darin jedoch von einer feinen weißen Schicht (Schnee?) überzogen; eine Miniaturansiedlung mit in rätselhaften Tätigkeiten erstarrten Figuren. Videoarbeiten: ein Haus, innen wie außen zentimeterdick in Eisschichten gepackt; ein Mann in einem dunklen, stillen Wohnzimmer mit flimmerndem TV (?) und flatternder Gardine, der ständig lautstark auf kräftigem Bayrisch z.B. „Wenn jetzt nicht bald a‘ Ruh‘ is‘!“ schreit; während in einer anderen schließlich ein ganzer Raum allmählich in Brand gerät. Vor allem aber ein beängstigendes, surreal zerfließendes Spiegelkabinett mit sich selbständig bewegenden Möbeln und, auf dem Museumsvorplatz errichtet, ein vollständiges, in der Breite jedoch auf eineinhalb Meter gestauchtes Haus, in dessen atemraubender Enge das Inventar natürlich ebenfalls geschrumpft ist. Allesamt unwirtliche Orte, welche doch ein Zuhause sein sollten …
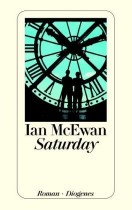 Eine sehr späte Lektüre, die unerwartet das Thema vertiefte: Denn wie prekär und aleatorisch unser ganzes Dasein ist, kommt eingehend in Ian McEwans „Saturday“ (übersetzt von Bernhard Robben. Zürich 2005) zur Sprache, einem am 15. Februar 2003, dem Tag der größten Friedensdemonstrationen aller Zeiten spielenden Roman, der nach dem Muster Ein Tag im Leben des … konstruiert nicht von ungefähr auch an „Ulysses“ erinnert. Durch die morgendliche Beobachtung eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes nachhaltig erschüttert, gerät ein erfolgreicher Londoner Neurochirurg ungeplant mitten in die Kundgebung, wodurch es zu einem folgenschweren Unfall mit einem an Chorea Huntington erkrankten Psychopathen kommt …
Eine sehr späte Lektüre, die unerwartet das Thema vertiefte: Denn wie prekär und aleatorisch unser ganzes Dasein ist, kommt eingehend in Ian McEwans „Saturday“ (übersetzt von Bernhard Robben. Zürich 2005) zur Sprache, einem am 15. Februar 2003, dem Tag der größten Friedensdemonstrationen aller Zeiten spielenden Roman, der nach dem Muster Ein Tag im Leben des … konstruiert nicht von ungefähr auch an „Ulysses“ erinnert. Durch die morgendliche Beobachtung eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes nachhaltig erschüttert, gerät ein erfolgreicher Londoner Neurochirurg ungeplant mitten in die Kundgebung, wodurch es zu einem folgenschweren Unfall mit einem an Chorea Huntington erkrankten Psychopathen kommt …
Ganz abgesehen von seinem enormen seherischen Scharfsinn, reflektiert McEwan in dieser vierundzwanzigstündigen Achterbahnfahrt des Protagonisten meisterhaft über die ungerechte Verteilung unserer historischen, sozialen und vor allem biologisch-genetischen Dispositionen, die einen vielleicht noch abänderlich und durch eigene Anstrengungen überwindbar, sofern man nicht ohnehin auf der berühmten „Sonnenseite” geboren wurde, während andere (wie die o.g. tödliche degenerative Erkrankung) unweigerlich in Armut und frühzeitigen Untergang führen.
Und noch einmal ging es um die „normative Kraft” des Zufalls, Fortunas unergründliche (Um)Wege, wenn auch heitererer als kulinarisch-amouröse Tragikomödie, nämlich in dem Film „Lunchbox“ der Inderin Ritesh Batra (Ind/Dtl/Fr 2013). Was bei dem einzigartigen Transportsystem der Dabbawala („Henkelmannbringer“) angeblich nur einmal pro 16 Mio. Lieferungen vorkommt, geschieht nun eines Tages in Mumbai und ruft arge Verwicklungen hervor: Statt dem Gatten bringt der Bote die mittäglichen Köstlichkeiten, mit denen die hinreißend schöne Gemahlin ihren ehemüden Mann eigentlich zurückgewinnen möchte, einem völlig Fremden, einem einsamen Witwer, woraus sich zunächst ein Zwiegespräch mittels Speisen und kassiberähnlichen Zetteln und schließlich eine zarte, im Grunde unmögliche Liebe – wenngleich mit offenem Ausgang, ja einem blassen Hoffnungsschimmer! – entspinnt. Eine sinnliche Reise in ein unbekanntes Land der Eventualitäten.
Zu guter Letzt sei die wunderbare, noch laufende Ausstellung „Geheimnisse der Maler – Köln im Mittelalter” über die hohe Kunst der Altar- und Tafelmaler, im besonderen Stephan Lochners erwähnt: Spannend lehrreich!
Zu den CM-Beiträgen von Stefan Linster.
 Carl Wilhelm Macke
Carl Wilhelm Macke
Irgendwann in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts muss es gewesen sein, dass ich in die Lektüre dieses Buches hineingestolpert bin. Von dem Autor Christian Geissler hatte ich damals überhaupt noch nie etwas gehört, geschweige denn gelesen. Aber der Titel des Buches hat mich sofort gepackt: „Wird Zeit, dass wir leben“. Endlich hatte da mal ein Autor genau die Stimmung auf den Punkt, besser in eine Titelzeile gebracht, die auch ich genauso empfand. Ja, endlich leben und sich nicht immer nur durch die Jahre treiben lassen, sich vorschreiben lassen, was man zu tun und zu lassen hat. „Wird Zeit, dass wir leben“…
Aber wovon handelte das Buch überhaupt, das ich mich nur wegen eines verführerischen Titels gekauft hatte? Ganz zu Beginn seines Romans beschreibt Christian Geissler den historischen Ausgangspunkt seiner Recherchen: „In einer Veröffentlichung der ‚Vereinigung der Antifaschisten und Verfolgten des Naziregimes ) aus dem Jahre 1971 gibt es den Hinweis auf einen Hamburger Polizisten, der, 1933/34 eingesetzt, als Wachmann für das Untersuchungsgefängnis, versucht hat, politische Gefangene zu befreien. Ich fand diesen Hinweis so wichtig, die Vorstellung von einem Schließer, der es lernt aufzuschließen, so bespielhaft, daß ich hier weiterarbeiten wollte.“ Also es geht in diesem Buch um den alltäglichen Widerstand von Menschen aus der Hamburger Arbeiterklasse gegen die Nazis, die Bonzen und alle ‚da oben’, die nicht zulassen wollten, dass ‚die da unten’ auch mal etwas zu sagen haben.
Das klingt zunächst mal alles schön einfach gestrickt und lässt eine linke Heldengeschichtsschreibung erwarten. Bücher, in denen vom guten Kampf der Antifaschisten gegen die ‚braunen Machthaber’ erzählt wird, müssen ja nicht gleichzeitig auch einen besonderen literarischen Wert haben. Aber wie Geissler hier die Story vom kommunistischen Untergrundkampf in den Anfangsjahren der Nazi-Diktatur erzählt, ist mitreißend, aufwühlend, radikal modern in seiner Sprache, umwerfend gut. Wie er den Jargon der kämpfenden Arbeitergenossen findet, ohne sich aufdringlich anzubiedern, wie er manchmal nur mit der Aneinanderreihung von Substantiven und extrem kurzen Sätzen das Milieu des Widerstands beschreibt, ist einfach ganz große Klasse. „Wird Zeit, dass wir leben“ gehört für mich ohne „wenn und aber“ zu den wichtigsten literarischen Verarbeitungen des antifaschistischen Widerstands in Deutschland.
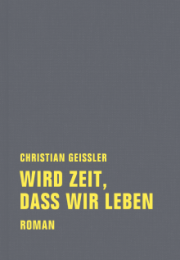 Der 2008 gestorbene Christian Geissler hat aus seiner radikal linken politischen Gesinnung bis hin zu missverständlichen Sympathien mit Aktionen der RAF nie einen Hehl gemacht. Vielleicht, nein sicherlich war das ein Grund, dass seine Bücher von der vorherrschenden Literaturkritik immer mit spitzen Fingern angefasst wurden. Jetzt hat der Berliner Verbrecher Verlag (starker Name!) das Buch von Geissler in einer fast schon edlen Hardcover-Version und mit einem umfangreichen Nachwort wieder neu ediert. Für mich ein literarisches Top-Ereignis des Jahres 2013. Ein Buch, das in die Schulen gehört – aber den Kultusminister möchte ich sehen, der diesen Vorschlag unterbreitet…
Der 2008 gestorbene Christian Geissler hat aus seiner radikal linken politischen Gesinnung bis hin zu missverständlichen Sympathien mit Aktionen der RAF nie einen Hehl gemacht. Vielleicht, nein sicherlich war das ein Grund, dass seine Bücher von der vorherrschenden Literaturkritik immer mit spitzen Fingern angefasst wurden. Jetzt hat der Berliner Verbrecher Verlag (starker Name!) das Buch von Geissler in einer fast schon edlen Hardcover-Version und mit einem umfangreichen Nachwort wieder neu ediert. Für mich ein literarisches Top-Ereignis des Jahres 2013. Ein Buch, das in die Schulen gehört – aber den Kultusminister möchte ich sehen, der diesen Vorschlag unterbreitet…
Nicht vom kommunistischen Widerstand in der norddeutschen Tiefebene handelt das Buch, das mich in diesem Jahr auch ganz besonders berührt hat. Aber die zentrale Figur des neuen Buches von Erich Hackl ist auch eine ‚einfache Frau’, die weniger heroisch als die kämpfenden Kommunisten bei Geissler versucht hat, Würde und Anstand in düsteren Zeiten zu zeigen. Erich Hackl, dem wir eine Reihe von Romanen und Erzählungen verdanken, in denen er immer mit einer bewundernswerten Empatie das Schicksal von Menschen in Worte fasst, die in der ‚großen Geschichte’ nie beachtet werden. Die, wie es in einem Gedicht von Antonio Machado heißt, „arbeiten, wandern und träumen/ und eines Tages dann, /irgendwann, ausruhen unter der Erde.“
Mit dem Porträt seiner Mutter, das Hackl nicht in Form eines durchlaufenden prosaischen Textes, sondern einer Art poetischen Langgedichts geschrieben hat, ist ihm ein bewegendes, aber niemals rührseliges, kitschiges, nostalgisierendes Gedenkbuch gelungen. Die Bücher von Geissler und Hackl habe ich hintereinander gelesen. Und irgendwie spürt man hier eine tiefe Gemeinsamkeit zwischen dem älteren, bereits verstorbenen norddeutschen Christian Geissler und dem in Wien und Madrid lebenden Erich Hackl. Beide waren bzw. sind sie Einzelgänger in einem Literaturbetrieb, der mit den Idealen der von ihnen geschilderten Figuren nichts anfangen kann. Vom Mainstream der heute gelesenen und in gigantischen Marketingkampagnen in die Bestseller-Listen gepuschten Neuerscheinungen sind die Bücher von Geissler und Hackl meilenweit entfernt. Wird Zeit, dass wir sie lesen…
Zu den CM-Beiträgen von Carl Wilhlem Macke.
 Tina Manske
Tina Manske
Alben des Jahres: Ohne viel Rumgemache und Rumgeschwurbel: Den Titel des „Albums des Jahres“ teilen sich Arcade Fire („Reflektor“) und Daft Punk („Ramdom Access Memories“). Die Erinnerung an Arcade Fires herausragendes Konzeptalbum sind noch frisch, mit Melodien, die an ihr ebenso übergroßes Werk „Suburbs“ erinnern, aber ungleich tanzbarer sind, der Produktion von James Murphy sei Dank. Aber als ich dann vor ein paar Tagen Daft Punks „Random Access Memories“ wieder hörte, wurde mir
*zum ersten Mal klar, welch toller Plattentitel ihnen da gelungen war („Ich wünsch mich dahin zurück wo’s nach vorne geht/ ich hab auf Back to the Future die Uhr gedreht“, würden Ja, Panik dazu sagen)
*zum wiederholten Mal klar, welch großes und die Jahre ganz sicher überdauerndes Werk da vorgelegt wurde. Allein der Track mit Giorgio Moroder – Hammer!
Außerdem lieferten Daft Punk natürlich auch den
Song des Jahres: Daft Punk: Get Lucky
Exclu Daftworld : Daft Punk – Get Lucky… von daftworld
 Wiederveröffentlichung des Jahres: Cabaret Voltaire: Collected Works 1983-1985. Cabaret Voltaire waren – mit Bands wie Human League, Fad Gadget oder Throbbing Gristle – Speerspitze der UK-Electronica-Szene der 80er-Jahre. Außerdem waren sie ihrer Zeit weit voraus, was man nun wieder verschärft nachhören kann. „#8385 (Collected Works 1983 – 1985)“ versammelt – remastered – vier Alben: „The Crackdown“ (1983), „Micro-Phonies“ (1984), „Drinking Gasoline“ (1985) und „The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord“ (1985) sowie sämtliche zwischen 1983 und 1985 auf 12-Inch erschienenen und zwölf bislang unveröffentlichte Stücke. Warum keine aktuelle Elektroband behaupten kann, von Cabaret Voltaire nicht beeinflusst zu sein, hier kann man’s hören. Die „Collected Works“ sind schweres Geschütz und kommen als 6 CDs, 2 DVDs und ein 40-seitiges Buch.
Wiederveröffentlichung des Jahres: Cabaret Voltaire: Collected Works 1983-1985. Cabaret Voltaire waren – mit Bands wie Human League, Fad Gadget oder Throbbing Gristle – Speerspitze der UK-Electronica-Szene der 80er-Jahre. Außerdem waren sie ihrer Zeit weit voraus, was man nun wieder verschärft nachhören kann. „#8385 (Collected Works 1983 – 1985)“ versammelt – remastered – vier Alben: „The Crackdown“ (1983), „Micro-Phonies“ (1984), „Drinking Gasoline“ (1985) und „The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord“ (1985) sowie sämtliche zwischen 1983 und 1985 auf 12-Inch erschienenen und zwölf bislang unveröffentlichte Stücke. Warum keine aktuelle Elektroband behaupten kann, von Cabaret Voltaire nicht beeinflusst zu sein, hier kann man’s hören. Die „Collected Works“ sind schweres Geschütz und kommen als 6 CDs, 2 DVDs und ein 40-seitiges Buch.
Buch des Jahres: Jedes, das ich auf meinem neuen elektronischen Lesegerät las. Ganz besonders hervorzuheben aber Stephen Kings „11/22/63“ (dt.: Der Anschlag), das mir diesen als Horrormeister verunglimpften und damit reichlich unterschätzten Autor nach langer Zeit wieder – nein, eigentlich zum ersten Mal näher brachte.
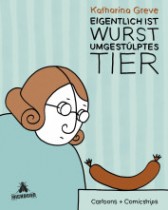 Cartoon des Jahres: „Katharina Greve: Eigentlich ist Wurst umgestülptes Tier“. Wenn Sie in diesem Jahr nur ein Buch mit Cartoons gekauft haben, dann ja wohl diese erste Soloveröffentlichung der großartigen Katharina Greve. Und aus gutem Grund – schließlich hat sie und nur sie den Rücktritt des Papstes Benedikt vorhergesagt! Aber auch sonst bleibt der hymnischen Lobhudelei von Ex-Titanic-Chefredakteur Leo Fischer im Vorwort recht wenig hinzuzufügen.
Cartoon des Jahres: „Katharina Greve: Eigentlich ist Wurst umgestülptes Tier“. Wenn Sie in diesem Jahr nur ein Buch mit Cartoons gekauft haben, dann ja wohl diese erste Soloveröffentlichung der großartigen Katharina Greve. Und aus gutem Grund – schließlich hat sie und nur sie den Rücktritt des Papstes Benedikt vorhergesagt! Aber auch sonst bleibt der hymnischen Lobhudelei von Ex-Titanic-Chefredakteur Leo Fischer im Vorwort recht wenig hinzuzufügen.
Symptomatisch für Greves Witz sind ihre gänzlich von Menschen befreiten Strips. Wasserhähne, Stuhlbeine und Blumenvasen werden in diesen Beispielen zu Protagonisten, die ziemlich genau dieselben abstrusen Probleme haben wie wir auch. Ihre menschlichen Figuren dagegen sind „voll krasser Grausamkeit und übler Ignoranz“ (Fischer) und kommen uns daher auch nicht gerade unbekannt vor. Comic(s)trips, die man mit wachsender Begeisterung immer wieder anschauen kann.
Zu den CM-Beiträgen von Tina Manske.
Zu Teil III des großen CM-Jahresrückblicks: hier (zu Teil I hier).