
Ivy Pochoda –
Markus Pohlmeyer –
Andreas Pflüger –
Robert Rescue –

Ivy Pochoda
Hands down the most exciting book and surprising book I read this year was The Godmother by Hannelore Cayre—a French novel, recently published in America. It’s a razor sharp, witty, informative novel about a single mother who is Tunisian / Jewish and works as an Arabic translator for the Parisian drug squad. It’s rare to see a middle aged woman at the forefront of a crime novel in which she is treated as as well-rounded person, an active participant, possessed of insight and interiority.
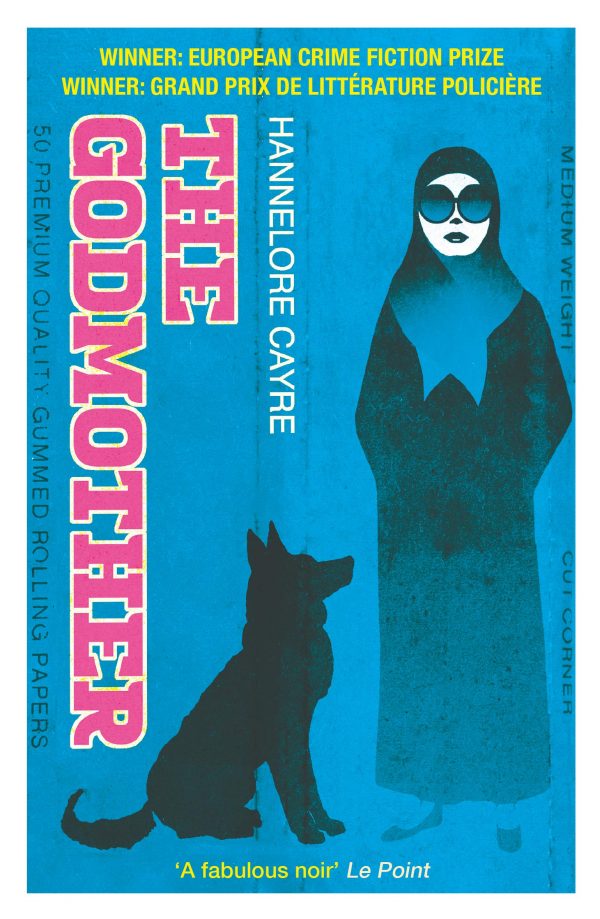
In its scant 180 or so pages The Godmother will make you laugh, it will drag you to the edge of your seat, and it will teach a great (and important) deal about the treatment of immigrants in Parisian suburbs, as well as the indelible and surprising link between the French drug trade (economics and all) and the village politics back in Morocco and elsewhere.
Ivy Pochodas Wonder Valley, out to glowing reviews in the States, was published in February 2019 in Germany by ars vivendi. Andrea O’Brien has interviewed her for her website Krimiscout (the Interview is in German). Ivy’s website.

Markus Pohlmeyer
CrimeMag (inklusive Specials) war wie immer ein Highlight in 2019! Mein Dank gilt dem Redaktionsteam für all die Mühe und Arbeit und für die Bebilderungen: schlichtweg gelungen! Danken möchte ich Dr. Thomas Wörtche für seinen Besuch in einem meiner Seminare: grandioso! Und danken Alf Mayer für seine Gesprächsführung – Markus: Ich schaffe es diesen Monat nicht! Mayer (flexibel): Bis Dienstag halten wir einen Platzhalter offen. Markus: Ich schaffe es diesen Monat nicht! Mayer (pastoral): Ich möchte alle meine Schäfchen zusammen haben! Markus: Ich schaffe es diesen Monat nicht! Mayer (motivierend): Ist es nicht schön, über seine Grenzen … (T. Wörtche: „Röchel!“). Und danken muss ich Alf Mayer für den Hinweis: die Jenny Aaron-Romane von Andreas Pflüger lesen! Auch als Trost, was wir alles trotz und mit einer Schwerbehinderung zu leisten vermögen. Die Romane gemahnen daran, dass wir alle irgendwo ein bisschen „super“ sein können, ohne gleich als Superheld/in durch den Kosmos zu fegen. Diese Romane schaffen aber auch einen gigantischen Sog, weiter und weiter zu lesen, und zwar durch ihre Sprache. Und da gibt es die harten Jungs (der härteste hört heimlich Schlager) und eine noch härtere Damenwelt, wo wirklich kaum ein Bösewicht auch nur den Hauch einer Chance hätte. Politik, Geld, Macht, Mafia, global durcheinander gewirbelt. Krimi, Action, Thriller – und immer wieder musste ich unterbrechen, Luft schnappen, weil ich herzlich lachen konnte: so frech, so gut, so irre formuliert. Kurz: literarisch. „Er sagt kein Wort und ist so gelassen wie Obelix angesichts einer römischen Schildkrötenformation. […] Sie stößt sich ab und kippt mit dem Stuhl nach hinten. Obelix greift ins Leere. Im Fallen zeigt ihr Tritt ihm, wie ein Mann zum Mädchen wird.“[1]Hätte ich jemals die Saiten meines Cellos so gespannt wie diese Sätze, dann wäre die Kiste in einer Singularität implodiert. Aber in diesen Roman findet sich etwas, was den Kollaps verhindert: eine herzliche Menschlichkeit, die selbst in der absoluten Dunkelheit leuchten kann.
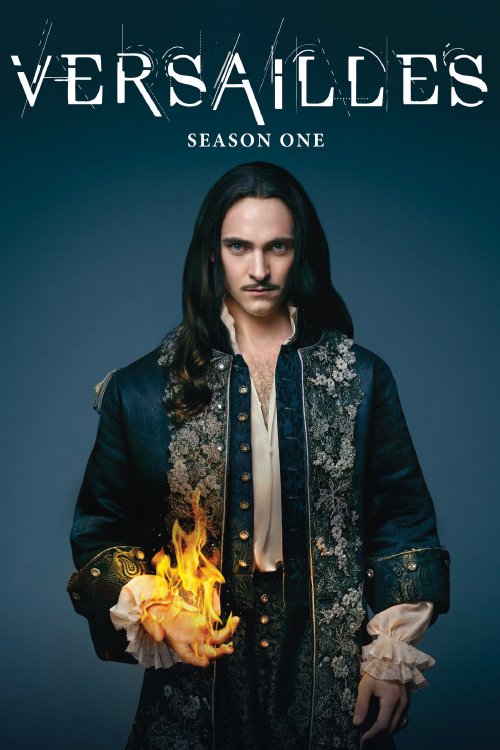
„Versailles“ (Staffel 1): ein Design-, Klamotten- und Architekturdrama mit viel Beziehungshinundher. Staffel 2: der schönste Schuppen der Welt verwandelt sich in eine Horrorbude: Giftmorde, Intrigen und Schwarze Magie (inklusive Ritualmorden). Sterben am laufenden Band. Der Sonnenkönig hat eine Hölle geschaffen. Staffel 3: Der allmächtige Sonnenkönig wird demaskiert als Illusion: durch seine Herkunft, nur ein Spielball des Vatikans und seiner Geliebten, die im Grunde Frankreich regiert, im schönsten Glanze nur ein Schatten seiner sonnenhaften, eingebildeten Göttlichkeit. Dazu die Vertreibung von Protestanten: Bibelverbrennungen und ein Fluchthelfer, der sich bereichert. Intoleranz überall. Ausbeutung der Untertanen: in Paris ist eigentlich schon die Französische Revolution im Gange. Stichwort Hölle: Der Science Fiction-Roman „Die Silizium-Insel“ (HEYNE 2019) von Quifan Chen schockiert durch das Nachwort. Science Fiction wird nicht irgendwo in der Zukunft angesiedelt, sie ist hier, nebenan. Es gibt zu viele Menschen, die schon in einer ökologischen Hölle leben.

Auch wenn mir das episodische Erzählen gefehlt hat, weil „Star Trek Discovery“ (2. Staffel) wie ein einziger Film konzipiert wurde und obwohl es ein wenig zu viel Pathos, zu viele Tränen gab, kann ich nur schwärmen. Captain Pike verkörpert Offenheit, Witz, Ironie und heroische Tragik; er ist kein solistischer Egomane, sondern lässt zu: andere Meinung und Blickwinkel. Wahnsinn, als der Universalübersetzer ausfällt und auf der Brücke Babylonische Sprachverwirrung ausbricht, die nur noch Saru kompensieren kann, der mit der Kenntnis von 94 Sprachen genervt anmerkt: habe sich denn keiner die Mühe gemacht, eine Fremdsprache zu lernen? Mit Pike, Spock und der Enterprisewird der Bogen zur Kirk-Ära geschlagen. Aber das Finale lässt meiner Meinung nach alles von „Avengers“ bis „Terminator „hinter sich: dramatisch steigernd sich steigernd, gigantisch, gigantischer, hyperbolisch, ikonisch, atemraubend, strategisch-subtil, ikonisch, klingonisch-grobmotorisch, mind-blowing, titanisch, absurd groß, allergrößt und großartig absurd, und dazu noch überall in der Raum-Zeit – der absolute Megahammer! Man hätte mich fast von meinem Flachbildschirm weglasern müssen … Und während die Discovery und Enterprise fast auseinanderzubrechen drohen, weil eine KI die Galaxie beherrschen möchte, behält Spock den Überblick und die Klingonen haben einfach nur … Spaß. Hochemotional, wie Burnham in die Rolle eines Messias hineinwächst; und wow, wie die böse, unkaputtbare Imperatorin aus dem Paralleluniversum der noch böseren KI zeigt, wo die Hamster tanzen.
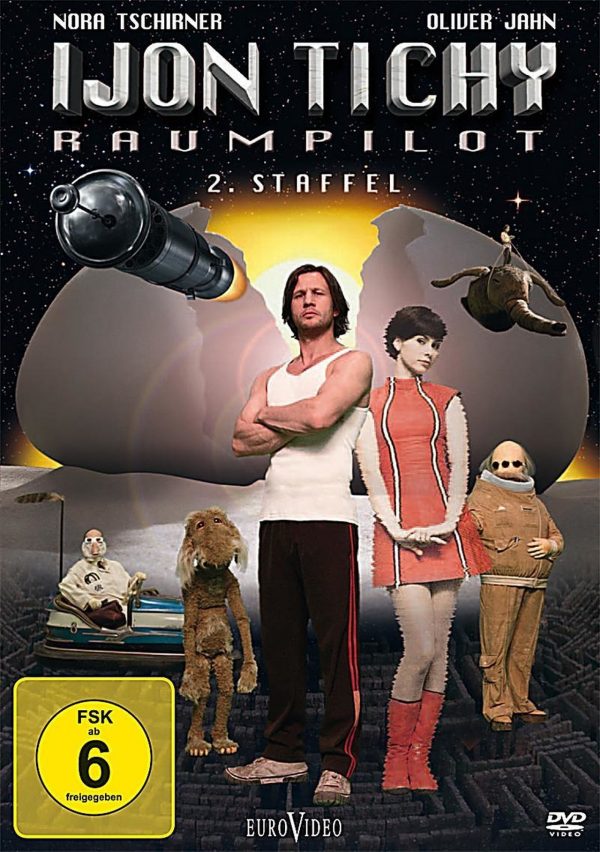
Eine so ganz andere Art von Science Fiction war in 2019 meine Entdeckung von „Ijon Tichy: Raumpilot„. Muss nicht jede Science Fiction auch eine eigene futuristische Sprache generieren, denn Sprachen verändern sich ja? Ich mache also kurz in Verknappung hier die Versuchung, so zu sprechen wie Held von das ganze Kosmos hemmungslos. Die einzig fast Normale (Personifikation von Verstand und Vernunft – wie Mr. Spock?) in diesem durchgeknalltenliebevollfreakshowmäßigen Universum ist die Analoge Halluzinelle (im Grunde eine modifizierte Spülmaschine). Wunderbar das Mainzelmännchen neben dem Küchentürrahmen (Welcher Charakter von „Game of Thrones“ würde so weit gehen?) oder die Druckerpatrone als Diskobeleuchtung für das haushaltsgerätmäßige Raumschiff, das – so im Making of – „Altbauwohung im Brenzlauer Berg von Innen, und von Außen ne Kaffekanne“[2] sei. Das erinnert mich ein wenig an meine Kindheit, wo problemlos der Blick durch ein Fenster den Blick in die Galaxie eröffnete, wo alle möglichen Einrichtungsgegenstände durchaus die Brücke eines Raumschiffes sein konnten. Und der Teddy ein roboterfressendes Monster. Warum nicht? Eine Dusche als Transporter, eine Spülmaschine als Supercomputer. „… hätte ich Schwäche für Alkohol, die ich auf Erde heimlich mache, aber wenn ich bin auf lange Raumfahrt, dann hemmungslos. Gott allein weiß, was gibt für Gerüchte.“[3] Drehen wir’s einmal gesellschaftlich-politisch: wie oft erleben wir, dass die Namensgebung mit der Sache vertauscht wird? Was bei Ijon Tichy Klamauk, scheint jenseits des Bildschirms eine gängige Normalität: vielleicht sollte ich auch mal so tun, als ob meine Tafel und Kreide das Nonplusultra der Digitalisierung wären?
Markus (ohne Schlaf, mitten in der Prüfungszeit, nur noch mit einer Hand an der kältesten Wand des Mount Everests, wo es das letzte Stück Sachertorte auf dem Planeten geben soll, verzweifelt hängend, balancierend mit der anderen einen Brontosaurus): Ich schaffe es diesen Monat nicht! Mayer (tiefenpsychologisch): Hihihi!
Auf jeden Fall wünsche ich CrimeMag alles, alles Gute, Wahre, Schöne und Freche für 2020!
[1] A. Pfüger: Niemals. Thriller, Berlin 2019, 338.
[2] Zitiert nach: Ijon Tichy. Raumpilot© 2011 Kosmische Kollegen / sabotage films. (Welt-)Allumfassende Halluzination-Analog-3-Zimmer-Box.
[3] Zitiert nach: Ijon (s. Anm. 2)
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei Culturmag hier. Im Jahr 2019 hat die Zahl seiner Essays für uns die 50er-Marke überschritten.

Andreas Pflüger
Überraschung des Jahres
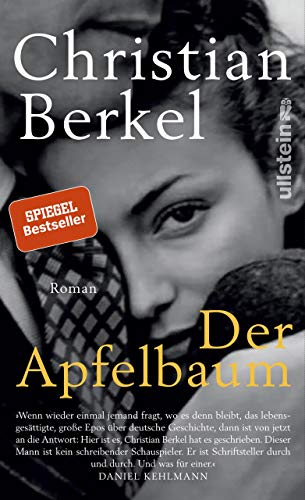
Ich werde in die Büchersendung »Fröhlich lesen« eingeladen und erfahre, dass Christian Berkel mit seinem Roman Der Apfelbaum der zweite Gast ist. Mein erster Reflex: Warum, zum Teufel, müssen Schauspieler Romane schreiben, ich käme ja auch nicht auf die Idee, King Lear spielen zu wollen. Man schickt mir Berkels Roman zu, schon auf den ersten Seiten lese ich diesen Satz: Fremd wurzeln wir im Verborgenen, greifen unter der Erde um uns und dehnen uns aus. Da war klar: Das wird ein Erlebnis. Auf virtuosen vierhundert Seiten erzählt Berkel die aberwitzige Odyssee seiner jüdischen Familie durch die Wirren eines maßlosen, weltzertrümmernden Jahrhunderts, die verzweifelte Suche Berkels nach seiner Identität im Anus Mundi der Moderne. Ein Roman hat Kraft, wenn man anfängt, starke Sätze anzustreichen. Solche wie diesen: Oben und unten rauschte das Leben, dazwischen gähnte der Abgrund. Oder den: Der Mensch mag es ertragen, nicht erwünscht zu sein, aber nicht begehrt zu werden, bedeutet verdammt zu sein. Und dann hört man damit auf, weil man mit dem Anstreichen nicht mehr hinterherkommt. Zu selten hat man das Glück, einem solch geborenen Erzähler zu begegnen. Guter Vorsatz fürs nächste Jahr: mit Vorurteilen sparsamer umgehen.

Enttäuschung des Jahres
Es gibt eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, einen Actionhelden in Bewegung zu setzen. Ich dachte, sie alle zu kennen, aber dass Keanu Reeves in „John Wick 1“ zu einem Rachefeldzug startete, nachdem man seinen Hund getötet hatte, war schönste Ironie und hatte Charme. Ich mochte auch die rohe, rotzige Erzählweise des Films, die Old-school-Kampfszenen, den Stoizismus der Hauptfigur. Die Entwicklung, die John Wick seitdem genommen hat und dieses Jahr im dritten Teil zu begähnen war, lässt sich simpel zusammenfassen: immer sinnloseres Geballer, immer mehr Leichen, eine immer überdrehtere, immer unglaubwürdige Handlung. Es gibt ja einen Begriff für solche Streifen, »Over the Top Action«, dazu muss man sein Hirn ausschalten, aber den Knopf habe ich nie gefunden. Der Film atmet nicht eine Sekunde, man ist versucht, ihn blutleer zu nennen, aber das wäre angesichts dieser Blutorgie grob daneben. Wenn Quantität zu negativer Qualität wird, ist das falsche Dialektik. Was nützt technische Perfektion, die zu einem seelenlosen Ergebnis führt? Bei der Arbeit an meinem neuen Roman beschäftige ich mich mit Albert Einstein. Er sagte: »Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele.« Das würden die – vier! – Autoren, die für das Drehbuch von „John Wick 3“ verantwortlich zeichneten, wohl nicht verstehen. Ihre Namen zu verschweigen, sowie auch den des Regisseurs, der bis zu den Wick-Filmen Stunt Coordinator war, gebietet die Höflichkeit. Vorsatz fürs nächste Jahr: meine Frau mehr Filme aussuchen lassen.
Andreas Pflüger ist Autor der bei Suhrkamp erschienenen, mehrfach preisgekrönten Jenny-Aaron-Trilogie. Nach Endgültig und Niemals erschien Geblendet, der Band 3 der Trilogie, im Sommer 2019. Eine Doppelbesprechung von Constanze Matthes und Alf Mayer hier: „Der beste Thrillerautor der Welt.“ Texte von und mit Andreas Pflüger bei uns hier.

Robert Rescue: Schwester Anuschka – Rufe in der Nacht
„Hilfe“, hörte ich es aus einem anderen Zimmer. Ich konnte nicht schlafen. Diese ungewohnte Umgebung und die fremden Menschen im Zimmer waren nichts für mich. Erneut hörte ich es rufen. Oh Mann, der musste Schmerzen haben.
Ob ich aufstehen und nachschauen sollte? Ging nicht, ich trug einen Blasen-Katheter, der mich ans Bett fesselte. Wieder und wieder hörte ich es rufen, aber niemand schien darauf einzugehen. Was war mit der Nachtschicht? Standen die alle draußen und zogen sich was rein, was ihnen den Job erleichterte? Was war mit den Zimmergenossen? Er machte einen Heidenlärm. Hatte er ein Einzelzimmer? Regte er sich einfach nur über irgendwas auf oder lag ein Notfall vor?
„Hilfe Anuschka“, hörte ich es jetzt von ihm.
Wer war Anuschka? Eine der Schwestern? Seine persönliche Leibschwester, weil er Privatpatient war?
„Hilfe Polizei“, schrie er jetzt. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Geschah da ein Mord? Standen die Pfleger um ihn herum und durfte jeder mal auf das Kissen drücken? Passierte das hier öfter? War der Garten, den der Klinikprospekt so poetisch als „Oase der Ruhe“ anpries, ein einziges Massengrab? Wurde den Angehörigen erzählt, der Patient habe einfach so das Krankenhaus verlassen und mehr wisse man nicht? War das hier etwa ein sogenanntes Mordkrankenhaus?
Ich schluckte und beschloss, es mir mit dem Pflegepersonal nicht zu verderben.
Sonst war ich der Nächste mit einem Kissen im Gesicht.
Ich steckte mir Ohropax in die Ohren und drehte mich zur Seite. Ich würde die Pfleger morgen früh bei der Visite loben, nahm ich mir vor.
Die Liebe in den Zeiten von Zu- und Ableitung
Das Einzige, woran man nicht dachte, während man einen Blasen-Katheter trug, war Sex. Man machte sich Gedanken, wie man hierher gekommen war, was man hätte anders machen sollen, um zu verhindern, dass man hier lag, man sinnierte, wie lange man das verdammte „Ding“ tragen musste und vor allem fixierte man in einer Mischung aus Schauern und Faszination die infusionsartige Zuleitung und Ableitung. An einem Gestänge hing ein Beutel mit einer klaren, wässrigen Substanz. Vielleicht war es destilliertes Wasser, das Tropfen für Tropfen in die Blase sickerte, vielleicht Spüli oder irgendetwas toxisches, das dem, weshalb man eine OP ertragen hatte, den Garaus machen sollte. Das, was aus dem Ableitungsschlauch herauskam, war in den ersten acht Stunden blutig und man fragte sich, was der Blase während der OP zugemutet worden war und was die Harnröhre jetzt erleiden musste. Aufmerksam betrachtete man den Kreislauf der Flüssigkeiten durch die Plastikschläuche und suchte nach Anzeichen, dass die ableitende Flüssigkeit klarer wurde. Der Beutel, der seitlich am Krankenbett hing, wurde vom Pflegepersonal „Einkaufsbeutel“ genannt.
Zunächst erschloss sich mir nicht, wie die auf diese Bezeichnung gekommen waren. Nach etwa 16 Stunden Durchspülung wurde die künstliche Zuleitung getrennt.
Dann konnte ich den „Einkaufsbeutel“ mit mir herumtragen und auch das Bett verlassen. Ich verließ das Zimmer, bekleidet mit dem Patientenkittel und den Badelatschen aus dem 1-Euro-Laden. Angeblich Größe 46, aber tatsächlich Größe 43, weshalb die Ferse überstand, was mir das Gehen erschwerte. In der rechten Hand hielt ich den „Einkaufsbeutel“, in dem sich noch immer blutiger Urin sammelte. Jetzt bekam ich eine Ahnung, warum er „Einkaufsbeutel“ genannt wurde. Ich taperte in den Wartebereich der Urologie-Station und schockierte die dort Sitzenden, die ihre OP in ein paar Tagen oder Wochen noch vor sich hatten.
Am Abend verspürte ich aber ein Aufkeimen der Libido, als Schwester Anuschka gemeinsam mit ihrem Kollegen das Zimmer betrat, um routinemäßig die Inhalte der „Einkaufsbeutel“ aller Patienten in einen blauen Eimer zu entleeren. Wahrscheinlich die meist gehasste Arbeit auf der Station und sicherlich der denkbar ungeeignetste Moment, um sich näherzukommen. Ob Schwester Anuschka wirklich so hieß, wusste ich nicht. Aber sie hatte so ein slawisches Aussehen und ich malte mir aus, sie sei als Kind mit ihren Eltern aus Sibirien nach Berlin gekommen und im märkischen Viertel aufgewachsen. Deshalb nannte ich sie Anuschka. Jetzt löste sie sich von ihrem Elternhaus, hatte die Ausbildung zur Krankenschwester begonnen und träumte von einem Studium. Ich sah ihr zu, als sie neben Herrn Birgers Bett in die Hocke ging. Plötzlich hatte ich den Gedanken, aus dem Bett aufzuspringen, den Patientenkittel zu lüften und „Tara“ zu rufen. Meine Güte, wie kam ich denn darauf? Ich schaute zur Decke und versuchte, den Gedanken zu vertreiben. Was war, wenn sich in dem Moment der Blasen-Katheter löste, weil ich vergessen hatte, den „Einkaufsbeutel“ von seiner Halterung zu lösen. Ich würde vor Schmerz aufschreien und schlimmstenfalls musste Anuschka den Katheter wieder in die Harnröhre und Blase schieben. Nein, nein, an diesem Gedanken war nichts schönes, nichts sinnliches. Das durfte niemals passieren, ich würde vor Scham augenblicklich sterben wollen.
Der Kollege kam an mein Bett und machte sich an dem Beutel zu schaffen. Anuschka stand neben ihm. Ich hatte nur Augen für sie. Ich stellte mir vor, ich würde sie in ein Steakhouse in Reinickendorf ausführen, danach in die Spätvorstellung vom Cinestar Borsighallen und schließlich würde sie mich fragen, ob wir im Mustis Quick Kebap in der Quickborner Straße noch ne Runde kickern wollen. Fiebrige Wahnvorstellungen, dachte ich mir, vor allem das mit der Runde Kickern. Anuschka war nicht die Typin Frau, die gerne kickerte. Oder doch? Der Kollege lüftete die Bettdecke und Anuschka wurde des schrumpligen Elends angesichtig, aus dem ein Schlauch in den „Einkaufsbeutel“ führte. Sie ließ sich nichts anmerken, aber für mich war jegliche Schwärmerei in dem Moment abrupt beendet. Ich war nur ein Patient, nur ein Name am Bett oder in der Akte. Morgen war ich weg und Anuschka würde jemand anderen attraktiv finden.
Am nächsten Morgen war es ihr Kollege, der den Katheter entfernte. Er tat es schnell und verbunden mit einem kurzen, heftigen Schmerz. Dann zeigte er mir das Ding vor, als hätte er ein Alien entfernt. Vorne dran der Ballon, der für die Verankerung in der Blase sorgte. Verankerung war das Stichwort. Er hatte keinen Stift gezogen, er hatte nirgendwo Luft rausgelassen, keinen Mini-Schalter gedrückt. Einfach rausgezogen. Den Ballon durch die Harnröhre rausgezogen. Ohne Empathie, kalt, abgestumpft auf die Ausübung einer Tätigkeit.
Anuschka hätte das anders gemacht.
Wir hätten uns in die Augen geschaut und ich hätte mir vorgestellt, was nach dem Kickern in Mustis Quick Kebap passiert wäre.
Ich hätte mich gefreut.
Über die Handynummer auf der Serviette.
Die nächste Einladung zum Kickern.
Diesmal im Wedding.
Nichts übereilen, hätte sie gesagt und mir den Katheter vorgezeigt.
Oder das Kissen?
Robert Rescue ist Autor und Vorleser. Er wohnt in Berlin, genauer gesagt, im Problembezirk Wedding, und gehört zahlreichen Gruppierungen des organisierten Vorlesens an, u.a. der Weddinger Lesebühne „Die Brauseboys“ und der Lesebühne „Vision und Wahn“. Seine Texte bei uns hier. 2019 ist von ihm erschienen Das Leben hält mich wach.












