Interessante Literaturzeitschriften gibt es viele – „Am Erker“-Redakteur Andreas Heckmann sorgt dafür, dass wir den Überblick behalten; er berichtet regelmäßig über spannende Hefte. Diesmal: poet und Text + Kritik.
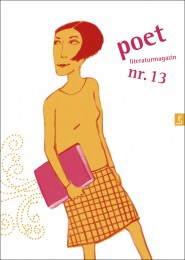 poet Nr. 13
poet Nr. 13
Während manche Zeitschrift sich verschlankt, treibt es den poet auch im 13. Anlauf auf die hohe See der Seitenzahlen. Und erneut gelingt dank starker Beiträger ein starkes Heft, das bspw. eine neue Folge der Braun-Buselmeierschen Deutungen zeitgenössischer Gedichte enthält, darunter Norbert Hummelts „dunst“, Rainer Malkowskis „Bist du das noch?“, Wilhelm Lehmanns „Auf sommerlichem Friedhof (1944)“ und Jörg Burkhards „in gauguins alten basketballschuhen“, Gedichte und Interpretationen, die als zeitschrifteninterne Eichstelle gelten dürfen, da sich an ihnen die übrigen Beiträge zu messen haben.
Hoch zu loben sind auch zwei Autorengespräche zum Thema Literatur und Alltag: Jan Kuhlbrodt spricht mit Jayne-Ann Igel, und Carola Gruber unterhält sich mit Sabine Peters so geistesgegenwärtig, konzentriert, klug und empathisch, dass ich die beiden sofort auf einer Doppellesung mit Gespräch erleben möchte und es unbegreiflich finde, dass mir „Feuerfreund“ bisher entgangen ist. Gruber, frisch promovierte Germanistin, Stadtschreiberin von Ranis und nach drei Monaten als Journalistin in Namibia nun wieder im Lande, beschenkt ihre Gesprächspartnerin abschließend mit einem Joker: „Vielleicht gibt es eine Frage, auf die Sie gern noch geantwortet hätten?“
Und Sabine Peters erwidert: „Wahrscheinlich ist das, was mir jetzt noch einfällt, zu groß: Warum schreiben Sie überhaupt, Frau Peters? / Aus Langsamkeit; weil es mir oft schwer fällt, spontan auf ‚Welt‘ zu reagieren. Aus Ohnmacht und Empörung. Aus Ratlosigkeit und Unverständnis und im Wunsch, die Dinge besser zu verstehen. Aus Lust an Sprache, Form und Spiel. Um die Welt schöner zu machen; wobei man das auch mit einem anständigen Risotto kann. Um glücklich zu sein. Um lebenden und toten Leuten ‚danke‘ zu sagen.“
poet Nr. 13. 9,80 Euro. Mehr hier.
 Text + Kritik 196
Text + Kritik 196
Wer ohne Bungeejumping einen tiefen Fall erleben will, gehe von den Autorengesprächen im poet direkt zur Ausgabe „Literatur und Hörbuch“ der oft so verdienstvollen Text + Kritik über und erleide am eigenen Hirn, wie staubtrockenes und redundantes Dozieren über Banalitäten den Brägen rösten kann. Immerhin der einleitende Text „Literatur lesen, Literatur hören – Versuch einer Unterscheidung“ von Johannes F. Lehmann liest sich mit Gewinn, jedenfalls für literarische Übersetzer, die oft genug vor dem Problem stehen, dass ihre Texte sich eindeutiger lesen als das Original.
Wer aber Uneindeutigkeiten in Übersetzungen erhalten will (und damit meine ich nicht die großen, kunstvoll angelegten Ambivalenzen, bei denen das Ehrensache ist, sondern die punktuellen Unschärfen, die mitunter auch unbewusst in den Text gelangen und ihm den Charme einer gewissen Schnoddrigkeit geben), steht häufig vor dem Dilemma, dass solche Unschärfen im übersetzten Text ungekonnt oder undurchdacht wirken oder nach Flüchtigkeit klingen, tendenziell also dem Übersetzer als Fehler angelastet werden, was der tunlichst vermeidet, indem er diese Stellen unter der Hand und in Kenntnis des Gesamttextes zurechtrückt, also suggestiv und interpretativ übersetzt – eine Analogie zum Phänomen des inneren Sprechens oder der „Subvokalisation“, das Lehmann (mit Klaus Weimar) auch beim stillen Lesen als für die Lektüre unentbehrlich ausmacht und das „im Kopf des Lesers auf stumme Weise laut wird“.
Wenn aber Stimmgebung Sinngebung ist, wie Lehmann an der „Judenbuche“ der Droste zeigt (einmal liest Gert Westphal die Stelle „Du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten“ beschwörerisch, das andere Mal Martina Gedeck sehr zurückgenommen), dann gilt: „Im Hören liefert sich der Hörer einer stimmlich artikulierten Sprechhandlung aus und verwickelt sich so – nicht wie der Leser in einen Prozess von eigenen Entscheidungen im Verlaufe der eigenen Informationsverarbeitung und Sinngebung – sondern in den (affektiven) Nachvollzug von Sprechhandlungen und Sprechsituationen, mit denen die Stimme, die er hört, ihn konfrontiert.“
Das macht den Hörer zum Objekt: „Alle Kritik am Ohr und an der Passivität des Hörens, der ‚Hörigkeit‘ und des Ge-horchens etc., wie sie besonders stark Derrida formuliert hat, kann hier bruchlos anschließen.“ Eine Überlegung, die analog für literarische Übersetzungen gilt und die deren Verfertiger nicht in den Wind schlagen sollten – auch wenn sie in der Praxis gerade der Übertragung von Genreliteratur auf solche Feinsinnigkeiten selten werden Rücksicht nehmen können.
Andreas Heckmann
Text + Kritik 196: Literatur und Hörbuch. 19,80 Euro. Mehr hier.
Diese Zeitschriftenschau ist zuerst in unserem Partnermedium „Am Erker“ erschienen.











