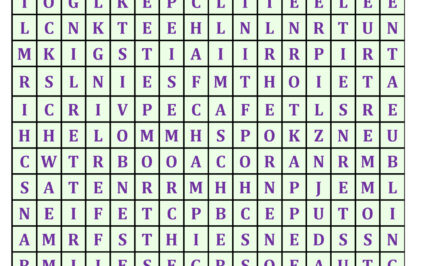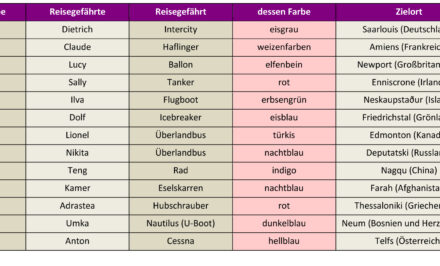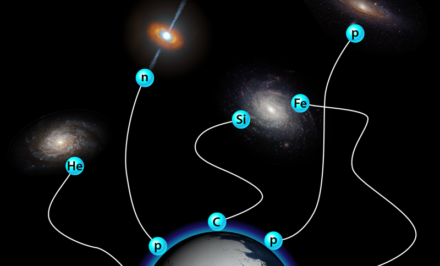Die Hand meiner Mutter
Von Christiane Nitsche
Es gibt Sprachbilder, die mich zur Verzweiflung bringen. Der Schicksalsschlag als „schwere Prüfung“, zum Beispiel – den Tod eines geliebten Menschen mit einer Stunde Schwitzen unter den strengen Blicken des Fahrlehrers zu vergleichen, das will mir bis heute nicht gelingen. Fakt ist: Der Tag, an dem ich meiner Mutter die Hand hielt, während sie schmerzhaft langsam in den Tod hinüberging, war einer der härtesten meines Lebens. Einer, unter dessen Last man in die Knie gehen kann. Und das nicht nur bildlich.
Es gibt nicht viele solcher Tage in meinem bisherigen Leben. Sie alle haben mit Tod und/oder Trennung zu tun. Auf meiner persönlichen Richterskala gehört dieser – genau wie der Tag ihrer Beerdigung – zu denen, die jenseits alles Messbaren liegen. Ein Tag, von dem man sich nur schwer und langsam erholt. So weit, so normal. Aber: Er war auch ein schöner Tag. Und er war ein Tag, für den ich heute dankbar bin.
Die Sonne schien schon früh und scherte sich wenig darum, dass es November war. Eigentlich war ich auf dem Weg zu Mamas alter Wohnung, um etwas für sie dort abzuholen. Bloß eben reinschauen in ihr Zimmer, dachte ich, einen schönen Tag wünschen. Bis abends würde ich wieder da sein.
Meine Mutter hatte nach einer so lebensgefährlichen wie zunächst lebensrettenden Operation eine Querschnittslähmung erwischt und zur Krönung auf der Intensiv-Station noch eine MRSA-Infektion. Sie erlebte ihren Tod auf Raten bei vollem Bewusstsein und klarem Verstand – bis hin zur völligen Isolierung in einer Rehaklinik, die so weit entfernt lag, dass sie kaum jemand besuchen konnte. Und wenn jemand kam, erkannte sie ihn nicht, weil jeder wegen der Keime bis zur Unkenntlichkeit vermummt war.
Sie wollte nie in ein Pflegeheim. In ihren eigenen vier Wänden wollte sie ihr Leben beenden, so wie das vermutlich die meisten von uns wollen. Nun gab es keine Alternative. Dass sie nach langem Hin und Her zu mir nach Gronau ins Antonius-Stift kam, war dann aber ein Segen. Eigene Möbel im Zimmer, täglich Besuch und nicht zuletzt die kaum zu fassende herzliche und liebevolle Zuwendung durch das Pflegepersonal dort – sie war dankbar und beinahe glücklich.
Sogar den folgenden leichten Schlaganfall mit der Lähmung ihrer linken Hand nahm sie noch mit Fassung. Dann kam der Morgen des 21. November 2014, der Tag, dessen Datum ich komischerweise immer wieder nachgucken muss. Ich kann es mir einfach nicht merken. Um ihr Bett herum standen ihre Lieblingspflegerin, mein Lieblingspfleger und ein paar andere, außerdem eine, wie mir schien, riesenhafte Gasflasche auf einem fahrbaren Gestell. Mama hatte akute Atemnot. „Wasser in der Lunge“, sagte jemand. Verzweifelt bemühten sich alle, ihr mithilfe der eilig herbeigeschafften Apparatur Linderung zu verschaffen. Es war etwa 9 Uhr.
Der Tod ist kein schwarzer Mann mit Sense, der sich unter Donnergrollen oder im Dunkel der Nacht hereinschleicht. Aber egal, wenn er sich ankündigt, macht er uns Angst. Auch wenn wir längst wissen, dass er uns schon eine Weile umschlichen hat. Auch denen, die beruflich damit zu tun haben.
Das erklärt vielleicht, dass eine uns bis dahin unbekannte Pflegerin darauf bestehen wollte, meine Mutter ins Krankenhaus bringen zu lassen. Sie war offenbar nicht über die Gesamtsituation und die ausdrücklichen Wünsche meiner Mutter informiert. Vielleicht war sie auch mit der akuten Situation kurzzeitig überfordert, sonst hätte sie nicht im Beisein meiner Mutter diesen Disput mit mir ausgefochten. Unschön, wenn die betreffende Person nicht für sich selbst sprechen kann, weil ihr die Luft fehlt.
Als ich die Auseinandersetzung mit der Dame erfolgreich im Sinne meiner Mutter beenden konnte, fühlte ich mich wohl einen Moment so wie Mama damals, wenn sie in unserem Dorf zum Hofbauern marschierte, weil dessen missratenes Blag eines ihrer Kinder malträtiert hatte. Der Rotzlöffel hatte sich gefälligst zu entschuldigen. Meine Mutter war ziemlich genau eineinhalb Meter lang – oder kurz. Aber sie wurde zur Löwin, wenn es um ihre Kinder ging. Egal, dass der Hofbauer zwei Köpfe größer war als sie und einen scharfen Hund hatte.
Meine Mutter war keine Heilige. Keine Mutter ist das. Ich auch nicht. Es sind nicht nur schöne Bilder, die ich mit ihr verbinde. Ich hatte viel Zeit an diesem Tag, mich solcher und anderer Bilder zu erinnern. Bilder, die ihr gerecht wurden. Bilder, die ich dann auch in ihrer Grabrede verwenden würde. Dass ich die selbst schreiben würde, war mir sofort klar, nachdem ich mit der Bestatterin ein erstes Gespräch geführt hatte. Genauso klar, wie ich am Morgen des 21. November wusste: Ich gehe hier nicht weg. Egal, wie lange es dauert.
Es dauerte bis zum Abend, etwa zehn Stunden. Sie hielt mir die Hand bis zuletzt – die Hand, die sie noch kontrollieren, mit der sie meine noch spüren konnte. Zwischendurch schlief sie ein, dann erwachte sie wieder und heftete ihren Blick auf das Spiel aus Licht und Schatten draußen im Garten. Sprechen konnte sie nicht mehr, nur noch vage signalisieren: Ja, bitte den Sauerstoff höher einstellen. Ja, bitte anrufen. Mein Bruder sollte kommen.
Der Tag war strahlend und sonnig, genau wie der ihrer Beerdigung. Er war bei allem Schmerz gespickt mit guten Momenten, auch mit guten Begegnungen, mit tröstlichen Erfahrungen, mit dem Wissen, dass es möglich ist, dem Tod mit Würde und Respekt zu begegnen und dabei so etwas wie Frieden zu finden. Ganz unabhängig von religiösen Überzeugungen, übrigens. Mama und mir half kein Glaube an diesem Tag. Uns half Aufklärung: Wissen. Uns half es zu wissen: Das hier, das wird jetzt furchtbar schwer, aber da müssen wir durch.
Uns half auch die Fürsorge der Pfleger, die bis auf den einen Ausrutscher mehr als vorbildlich war. Uns half die kluge und aufmerksame Zuwendung unseres Arztes, der für uns beide im richtigen Moment die richtigen Spritzen zur Hand hatte – für Mama die, die ihr die letzten Atemzüge und die Schmerzen erleichterten und für mich die für den schmerzenden Rücken nach Stunden des Sitzens an ihrem Bett in der immer gleichen Haltung. Und uns half der geschützte Raum, in dem wir den Tag verbrachten: Ihr Zimmer im Antonius-Stift mit Blick in den sonnenüberfluteten Garten.
Wir wussten, was uns bevorstand, wir waren vorbereitet. Wir hatten Zeit genug gehabt, das alles zu besprechen. Warum mir das so wichtig ist, erklärt zugleich, warum ich das alles erzähle: Meine Mutter war nicht der erste mir sehr nahe Mensch, von dem ich mich für immer verabschieden musste. Ich wusste, was es bedeutet, wenn einem Sterbenden die letzte Freiheit genommen ist, weil er im Unklaren über sein bevorstehendes Ende bleibt. Wenn er das bisschen Leben, das ihm bleibt, nicht mehr gestalten kann, weil er einfach nicht weiß, wie viel Raum er dafür hat – oder eben nicht. Wenn er mit ungeklärten Fragen gehen muss – oder offene Fragen hinterlässt.
Darum war dieser Tag auch ein Geschenk. Ich konnte ihr die letzte Sorge nehmen, nämlich die um ihre Kinder und ihre Enkel. Ich konnte ihr sagen: „Mama, wir werden zurecht kommen, wir werden es gut haben.“
Als ich ihre Grabrede schrieb, war mir vor allem dies wichtig: Ich wollte keine falschen Bilder. Sie sollte mit den Bildern in Erinnerung bleiben, die ihr gerecht werden. Eines davon ist die kleine, tapfere Löwin, der auch schon mal der Schalk im Nacken sitzt. Nach ihrer Operation, als klar war, dass sie gelähmt bleiben würde, sagte sie scheinbar leichthin: „Sterben ist nur schwer für die, die übrigbleiben.“ Das ist vermutlich nicht ganz richtig, aber richtig ist wohl, dass es leichter ist, wenn man dabei nicht allein und möglichst vorbereitet ist. Für beide Seiten.
Christiane Nitsche
Christiane Nitsche wurde 1964 in Köln geboren, hat ’nun ach‘ Geschichte, Philosophie und Germanistik studiert, bevor sie auswanderte. Heute liest, schreibt, spricht und träumt sie in Deutsch und in Englisch alles, was sich zwischen Buchdeckel packen ließe. Sie hat für die Süddeutsche Zeitung, die Westfälischen Nachrichten, die Münsterland Zeitung, den Kölner Express und diverse Magazine gearbeitet, literarische Reiseführer veröffentlicht und lebt heute nach Lehr- und Wanderjahren in England, Griechenland und Bayern im Westmünsterland, wo sie als freie Journalistin, Autorin, Bildjournalistin, Übersetzerin und Dozentin tätig ist. Zu den CULTurMAG-Beiträgen von Christiane Nitsche.