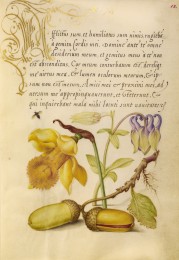 Auf dem Weg zum Essay. Ein Essay
Auf dem Weg zum Essay. Ein Essay
In einem schönen Nachtrag zu unserm Special Essay Special einige Gedanken von Markus Pohlmeyer, überaus produktiver Essayist bei Culturmag, zur Verfertigung des Essay an sich.
Wir leben in einem intertextuellen Zitaten-Multiversum – das ist schön und anstrengend zugleich (man könnte ja jemanden überlesen, überhört, übersehen haben)! Aber ich, der Einzelne, freue mich, daran partizipieren zu können. Ohne mühselig durch Europa auf der Suche nach Handschriften zu reisen, um diese dann in Bibliotheken abzuschreiben. Cicero und Seneca gibt es heute einfacher. Dennoch und wie auch immer medial vermittelt: mein Geist lebt vom stillen Gespräch mit diesen Fernen und Toten. Und schon seit vielen Jahren meditiere ich über eine Beobachtung des Sprachwissenschaftlers Eugenio Coseriu, die mich nicht mehr loslässt, mich, den Dichter, aber auch mich, den Wissenschaftler:
„Die dichterische Sprache kann folglich nicht als Reduzierung der Sprache auf eine sog. ‚dichterische Funktion’ interpretiert werden und auch nicht als Sprache + einer sog. dichterischen Funktion. Einerseits stellt die dichterische Sprache keine Reduzierung der Sprache dar, andererseits wird eigentlich keine Funktion hinzugefügt, da die verschiedenen Möglichkeiten, die in ihr aktualisiert werden, auch schon bei der Sprache schlechthin festgestellt werden. […] Man kommt damit zum Schluß, daß die dichterische Sprache die volle Funktionalität der Sprache darstellt […].“[1]
Im Grunde scheint mir der Essay mit der Dichtung zutiefst verwandt. Die selbst-auferlegten oder durch die Tradition vorgegebenen, überkommenen, auch problematisierten Formen der Dichtung bändigen meine ungebändigte Alltagssprache in festen Mustern; gleichzeitig wird dadurch der Gebrauchsgegenstand Alltagssprache aufgesprengt, erweitert, durchgestrichen oder macht sich selbst zum Thema. (Vielleicht wäre die vollkommenste Poesie ein Naturgesetz – als reine Form?) Anders: ich entdecke meine Sprache, aber auch Sprache entdeckt mich. Während im Gedicht Subjektivität und persönliche Imagination im Vordergrund zu stehen scheinen, beugt sich scheinbar die harte Wissenschaft der Illusion reiner Objektivität: sie ist allgemein, hat aber eine formale Strenge, die noch strenger ist als die der Dichtung. (Form in der Dichtung ist nicht nur beispielsweise Metrum oder Reim, sondern auch eine innere, ein Geheimnis, unsichtbar, das danach drängt, nach Außen hin sichtbar zu werden: Ekstase!) Während das Gedicht, auch wenn es den Leser/die Leserin impliziert, oft mit sich selbst spricht, sucht Wissenschaft Gemeinschaft.
Der Essay steht zwischen beiden: er ist Experiment mit Gedanken, Gefühlen und Gesellschaft. Der Essay ist bescheidener als die Wissenschaft und irgendwie ehrlicher, indem er die Masken der Objektivität fallen lässt: alles ist von Menschen gemacht, selbst dieser Kosmos! Der Essay lotet die Grenzen der Sprache aus – so wie ein Gedicht – und will wie die Wissenschaft ständig in einer Gemeinschaft sprechen. Unsere Leser/Leserinnen sind unsichtbar: wir stehen nicht mehr redend-gestikulierend auf dem Forum Romanum oder auf einem Athener Marktplatz: wir sitzen mit Stift und Papier oder mit einem Computer in einem Büro, in einem Restaurant, in einem Zug oder in einem gemütlichen Zimmer. Dies schreibend, schaue ich gerade aus dem Fenster, der Frühling naht,
Amseln durchwühlen das noch
Herbstliche Laub. Goldglänzende
Osterglocken: zu künden vom
Sommer, von des Lebens
Wiederkehr und seinen Liedern.
Aufgeplustert halten die
Amseln plötzlich inne –
Da! … Ein Motorrad knattert
Über die Straße … und
Schon wieder rascheln
Sie, und: Bewunderung der
Osterglocken.
Erläuternder Exkurs: unsere kleinen, gefiederten Dinosaurier bemühen sich aufgeregt um ihre Damenwelt! (Vögeln kommt eine besondere evolutionäre Stellung zu!)
Wir hoffen auf Leser/Leserinnen, die wir uns schon vorgestellt haben: wir wollen mit ihnen reden, d.h. zu ihnen schreiben. Manchmal hindert die Schwere der Wissenschaft, ihre Gravität, dass wir zu den Sternen eilen; und wir bleiben im Sumpf der Anmerkungen stecken und hängen zappelnd im weltweiten Netz der Fußnoten. Aber nur mit Wissenschaft fliegen Flugzeuge, fliegen Raumsonden! Manchmal, manchmal möchten wir zur Sonne stürmen, aber unsere ikarischen Flügel schmelzen, da sie nur aus Poesie bestehen. Unsere Phantasie baut Schiffe, die zum Meere passen, und das Meer passt wundersam zu ihnen – und wir entdecken unbekanntes Land, welches in unseren Träumen schon immer da war. Es ist schon seltsam, wie Physik und Phantasie, wie Phantasie und Dichtung harmonieren: alle möglichen Wege gehen zu können, vorwärts und rückwärts in der Zeit. Und eine einzige Formel (z.B. E = mc²) sagt mehr über den Kosmos als alle Religionen der Welt. Alles hat dieser Kosmos geschaffen! Dass aber in einem Vers der Veden oder der Evangelien so viel über Gott und Mensch gesagt wird, wie es keine Formel je zu sagen vermag!
Der Essay verbindet beides – in ihm vermischen sich unvermischt beide Naturen: die der Wissenschaft und die der Poesie. Es ist immer ein Ich, das schreibt. Es ist immer ein Ich, das forscht. Ich werde Text. Aber wir brauchen ein Du, um zu erzählen, um vorzulesen, um zu diskutieren. (Und Ich werde auch von einem Du erzählt!) Ich will auch aber ein anderes Du oder Wir anschreien und anschreiben dürfen, wenn es blind in eine Diktatur hineinläuft, wenn es feige seine Freiheit aufgibt, wenn es zu faul, zu bequem ist, nicht aufhören zu wollen, dumm zu sein. Mein Ich muss aufstehen dürfen, klagen und schreiben dürfen, ganz ruhig und gelassen ekstatisch, wenn andere bestimmen, es gäbe nicht viele Geschichten, sondern nur noch die eine, die ihrige, die einzige. Wenn andere behaupten, die Erde wäre eine Scheibe: dann schützt uns Wissenschaft. Wenn andere mit ihren Texten lügen: dann erhebt Poesie ihr Veto. Wenn Geld unseren Planeten frisst: dann muss ein Gedicht absichtslos sein, unbezahlbar und unverkäuflich.
Der Essay verbindet beides: er ist bescheidener als Poesie und Wissenschaft, gibt ihnen aber ein Zuhause und Wohnrecht; er ist Kosmopolit in einem Dorf; ein Eremit, der auf Freunde hofft; ein Asket, der sprachliche Orgien feiert! Ein Essay muss flirten, Muse sein, Gentleman sein, verrückt sein. Er sagt Ich und meint immer Mich, Du und Wir; er ist hier und immer dort; er ist konkret an einem Nicht-Ort (utopisch) und ist vor allem gastfreundlich: er hofft auf eine Einladung zum Gegenbesuch und freut sich auf die Gegenrede – in Würde und Menschlichkeit. Und: ein Essay gibt niemals auf, schon gar nicht Wissenschaft und Poesie. Kurz, ein Essay ist zutiefst demokratisch.
Markus Pohlmeyer /29.6.17
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg
[1] E. Coseriu: Thesen zum Thema ‘Sprache und Dichtung’, in: Beiträge zur Textlinguistik, hg. v. W.-D. Stempel, München 1971, 183-188, hier 184 f. Es gibt so viele Poetologien wie Gedichte. Logisch. Vgl. dazu auch P. von Matt: Was ist ein Gedicht? Stuttgart 2017.











