
Frank Göhre
Georg Büchner – radikal revolutionär
Der Siebzehnjährige verteidigt in einer Rede auf der Schulfeier den Freitod Catos, der sich am Ende seines vergeblichen Kampfes gegen die Methoden Julius Cäsars das Leben nahm:
„… als der Altar der Freiheit zerstört war, war Cato der einzige unter Millionen, der einzige unter den Bewohnern einer Welt, der sich das Schwert in die Brust stieß, um unter Sklaven nicht leben zu müssen; denn Sklaven waren die Römer, sie mochten in goldenen oder ehernen Fesseln liegen – sie waren gefesselt.“
Der Zwanzigjährige Student der Medizin schreibt an seinen Vater:
„Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zu fronenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gesetz, unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, dies Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan mit dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann.“

Bildnis eines jungen Mannes, Verdacht auf Büchner.
Es ist das Jahr 1833.
Es spricht und schreibt Georg Büchner, geboren in Goddelau (Hessen-Darmstadt), aufgewachsen in Darmstadt, im Großherzogtum Hessen.
Es herrschen fast unverändert die Zustände der Feudalzeit. Zwar ist die Leibeigenschaft abgeschafft, aber die Bauern sind zu Abgaben an den Standesherrn verpflichtet. Die Bewölkerung nimmt rasch zu, die Leinewebereien zahlen immer niedrigere Löhne. Eine Doppelbesteuerung wird eingeführt. Verelendung und verstärkter Alkoholismus sind die Folge. Wer die Möglichkeit hat, wandert aus. Von denen, die bleiben, formieren sich einige zum Widerstand. Vereinzelt kommt es zu Revolten und Aufständen.
1834 schreibt und veröffentlicht Georg Büchner die Flugschrift „Der hessische Landbote“: „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ Er hat noch drei Jahre zu leben. In dieser Zeit entstehen die Bühnenstücke „Dantons Tod“ – „Wir wissen wenig voneinander“, sagt der Revolutionär Danton zu seiner Frau Julie. „Einander kennen? Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren“; „Leonce und Lena“ und „Woyzeck“.
„Ich geh“, verabschiedet sich Woyzeck von der Welt, „Es ist viel möglich. – Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehn Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel; man könnte Lust bekommen, ein Kloben hineinzuschlagen und sich dran zu hängen, nur wegen des Gedankenstrichels zwischen ja und wieder ja – und nein. Herr Hauptmann, ja und nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will drüber nachdenken.“
Auch die Übersetzungen der beiden Dramen von Victor Hugo „Lucretia Borgia“ und „Maria Tudor“ beendet Büchner noch. Vor allem aber den Prosatext, der zur Pflichtletüre all derer gehören sollte, die über die Möglichkeiten und Grenzüberschreitungen der Literatur debattieren und/oder selbst kreativ schreibend tätig sind: Die Novelle „Lenz“ –
„Es war ihm alles so klein, so nahe, so naß, er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen, er begriff nicht, dass er soviel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunter zu klimmen, einen fernen Punkt zu erreichen; er meinte, er müsse Alles mit ein paar Schritten ausmessen können.“
Georg Büchner wird 24 Jahre alt.
Schwer an Typhus erkrankt stirbt er am 19. Februar 1837 in Zürich.
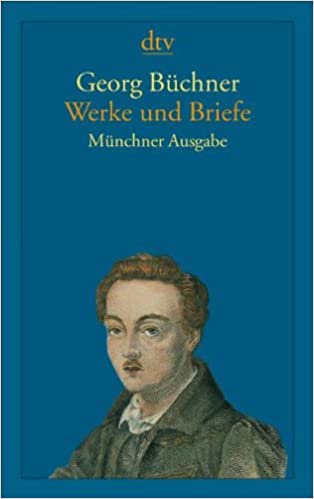
Georg Büchner
Werke und Briefe. Münchner Ausgabe Herausgegeben von Karl Pörnbacher
DTV, München 1997, 784 Seiten, € 15.90
Frank Göhre, Autor, lebt in Hamburg.











