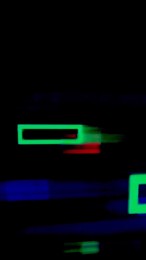
Gunnar Kaiser: Das Tabu der Freiheit
Ich stelle mir den bisherigen Ablauf der Menschheitsgeschichte als eine dunkle Höhle vor, deren Wände eng, allzu eng beieinanderstehen. Und der Mensch, nein, nicht nur „der“ Mensch, sondern jedes einzelne Individuum in dieser langen Kette von Leben, schritt eingeengt und einsinnig in eine Richtung: eingeengt von den abweisend kalten Wänden der Sippe, des Stammes, des Volkes, der Gesellschaft. Einsinnig gemacht durch Stammesdenken, Kollektivmoral, Anstandsregeln. In die ewig gleiche Richtung getrieben durch religiöse Vorschriften, den Zugriff weltlicher Autoritäten und ihrer ehernen Gesetze. Und was sie vorgaben, war der Weg, den wir zu beschreiten hatten, und die Richtung, in die wir ihn gehen sollten; ein Schritt vom Wege, wo er sich dann doch einmal bot, war schärfstens sanktioniert. Irgendwann nämlich hat sich der Höhlenschacht des gesellschaftlich Erlaubten ein wenig erweitert; die unüberwindbaren Wände wurden abgelöst von Etikette und Erziehung. Schwerer sichtbar zwar, aber dafür nicht weniger disziplinierend. Am Wegesrand warnten vor der Abweichung noch für unsere Eltern Schilder, auf denen stand: „Das haben wir immer so gemacht“ oder „Das ziemt sich nicht.“
Natürlich sind auch heute noch unsichtbare Verhaltensregeln überall dort am Werk, wo staatliche Gesetze (noch) nicht nötig sind. Doch die gesellschaftlichen Werte, die diese Normen begründen, sind längst nicht mehr so sakrosankt wie einst. Wo es vor Generationen noch undenkbar war, dass Liebende sich auf der Straße küssen, kräht heute kein Hahn mehr danach. Wo früher ein kurzer Rock als unschicklich galt und der Trägerin den Ruf der Liederlichkeit einbringen konnte, gilt er heute als sexy, höchstens ein bisschen situationsunangemessen.
Die Arten und Weisen, sein Leben zu gestalten, sind in westlichen Gesellschaften ins Unüberschaubare angewachsen. Auseinandersetzen muss sich der Nonkonforme zwar immer noch mit den abschätzigen Blicken von Passanten und Nachbarn, aber die Zahl seiner Wege, dem Zwang zu entgehen und etwa in einer Großstadt mit Gleichgesinnten sein Leben relativ ungehindert und frei von sozialen Erwartungen zu leben, ist deutlich gestiegen. Unsere Gesellschaft ist permissiver geworden, was den Menschen Freiheit, Individualität und Glück, oder zumindest den Ausweg aus dem Unglück ermöglicht.
Deine Freiheit endet dort, wo die der anderen beginnt, heißt es. Das ist ein recht angenehmes Postulat, schafft es doch einen weiten Raum zum Atmen und eine Erlaubnis, so zu sein, wie man eigentlich ist. Wo die Freiheit der anderen beginnt, muss zwar Schluss sein … aber keinen Zentimeter vorher! Darauf kommt es nämlich an: Mit der Begrenzung der individuellen Freiheit geht in dieser liberalen Maxime eine starke Ausweitung der Verhaltensweisen und Lebensmöglichkeiten einher. Du kannst alles tun, was niemand anderem direkt schadet. Du kannst diese Religion wählen oder gleich gar keine, kannst deinen Körper verkaufen oder nicht, kannst alleine leben, gleichgeschlechtlich oder in einer Hippie-Kommune, und du kannst dir auch einen Ring durch die Nase ziehen, wie meine Großmutter zu sagen pflegte. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Die Menschheit hat ihren Ausgang aus der beengenden Höhle der Selbstbeschränkung gefunden, der Platz vor der Höhle ist groß, hell und weit und für alle da. Hier soll jeder nach seiner Façon glücklich werden.
Ist das nun aber nur ein weiteres Tabu, das wir nicht zu hinterfragen wagen? Ist es verboten, die Frage nach der Berechtigung von Lebensweisen zu stellen, die niemandem schaden? Die Philosophin Rahel Jaeggi hat in ihrem Buch „Kritik von Lebensformen“ im Jahr 2013 gefragt: Lassen sich Lebensformen kritisieren? Lässt sich über Lebensformen sagen, sie seien gut, geglückt oder gar rational? Darf man überhaupt über die Entscheidungen von Menschen streiten, die dieses oder jenes Leben führen? Ist es nur eine Geschmackssache, wie wir leben, zu der Staat und Gesellschaft sich neutral zu verhalten haben? Sind Lebensformen nicht weiter hinterfragbare Präferenzen oder einfach Aspekte der persönlichen Identitätsfindung, in die niemand reinzuquatschen hat?
Diese Fragen hören sich vielleicht weniger tabubehaftet an, als es scheint. Vor kurzem hatte ich eine interessante Diskussion auf Instagram (ja, das ist möglich), die verdeutlichen kann, wo das Skandalon liegt. Sinngemäß hieß es dort: Es ist dir nicht erlaubt, dich darüber zu äußern, wie sich andere in der Öffentlichkeit kleiden oder wie ihr Körper beschaffen ist. Die Richtung des Geäußerten war mir mehr als verständlich. Es ging darum, die zu schützen, die von anderen wegen ihrer „unnormierten“ Äußerlichkeit beschämt werden – sei es körperlicher Auffälligkeiten oder ihres extravaganten Kleidungsstils wegen. Wie ich mich kleide, wie ich aussehe, ist none of your business. Erstaunt war ich allerdings über die Formulierung: „Es ist dir nicht erlaubt …“, die ein Gesetz zu verlangen schien, dass anderen den Mund verbietet. Aus dem verständlichen „Wenn du andere willentlich wegen ihrer Individualität beschämst, bist du nichts weiter als ein Arschloch“, wurde ein reglementierendes „Du hast kein Recht auf die Äußerung deiner Meinung.“ Nun mag man sagen: Jemand anderen zu beschämen, ist keine Meinung, zumindest nicht nur. Und in den weitaus meisten Fällen mag das so zutreffen. Das Posting war gerichtet gegen die Praxis des Bodyshamings, das einige Menschen selbst in unserer permissiven Gesellschaft noch gewärtigen müssen, weil sie einer vermeintlichen Norm nicht genügen. Was aber, wenn jemand eine Nazi-Uniform oder eine ISIS-Flagge trägt? Ein Thor-Steinar-Outfit, wie es kürzlich bei Bauarbeitern an der Uni Köln gesichtet und vom dortigen AStA öffentlich gerügt wurde? Natürlich war das in dem Instagram-Posting nicht gemeint, sondern es ging um die, die einfach friedlich ihre Individualität ausleben und nach ihrer Façon glücklich sein wollen. Vielleicht aber ist es problematisch, diese Permissivität zu weit auszudehnen: Wer mit den Symbolen von Terror und Diktatur seine Individualität ausdrücken möchte, sollte sich durchaus der kritischen Meinung und der Beschämung der anderen stellen müssen. Auf einer anderen Ebene: Was ist, wenn Kinder anwesend sind? Darf ich in der Öffentlichkeit jeden Fetisch ausleben und zur Schau stellen, oder müssen Kinder vor Nacktheit und Pornographie geschützt werden – und vor den gesetzlichen Maßnahmen dann eben durch die gerechtfertigte Empörung des gesunden Menschenverstandes?
Was aber, wenn das sogar noch weiterginge? Die Philosophien Svenja Flaßpöhler überlegt in ihrem Essay „Die potente Frau“, ob es einen moralischen Wert von Lebensformen gibt. Auch Aristoteles hat ja schon die bloß karrieristische Lebensform der politischen und diese der „theoretischen“ entgegengestellt – wertend: die höchste Lebensform ist die, in der der Mensch zur Betrachtung, zur philosophischen Reflexion befähigt ist.
Und heute? Ist es eben nicht bloß Geschmackssache, ob ich mich als Frau objektivieren lasse und dies in meinem Lebensstil manifestiere, wie Flaßpöhler es an dem Fall Gina-Lisa Lohfink veranschaulicht? „Was bitte ist heldinnenhaft an einer Frau, deren oberstes Ziel darin besteht, Männern zu gefallen?“, fragt Flaßpöhler mit Verweis auf Lohfinks Mitwirkung an Germany’s Next Topmodel. Lohfink verkörpere eine rückschrittliche, regressive Lebensform. Und fallen uns nicht auf Anhieb weitere Exponenten solcher regressiven Lebensformen ein, die wir kritisieren sollten, bevor sich die Jugend an ihnen ein Beispiel nimmt? Frauen, die sich früher für Kinder statt Karriere entschieden haben, wurden kritisiert, dass sie das Spiel des Patriarchats mitspielen – heute gilt es im Vergleich gesehen eher wieder als Privatsache. Materialismus und Konsumismus wurden früher als schädlich kritisiert – auch heute ist das eben wieder jedem selbst überlassen. Vielleicht sollten wir in der Lage, ja, sollten wir sogar verpflichtet sein, individuelle Lebensweisen – auch wenn diese selbst nicht konkret jemandem Schaden zufügen – zu kritisieren, wenn wir der Ansicht sind, dass sie die gesellschaftlichen Verhältnisse mit solcherart Vorbildern nicht verbessern. Ist das Kritikverbot am friedfertigen Ausleben der jeweiligen Individualität das letzte Tabu der permissiven Gesellschaft?
Gunnar Kaiser ist Schriftsteller und Lehrer. Sein Debütroman „Unter der Haut“ erschien 2018 im Berlin Verlag. Er betreibt den Blog und YouTube-Kanal KaiserTV, in dem er Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, literarische Klassiker und Philosophie bespricht. Gunnar Kaiser lebt in Köln.
Homepage: gunnarkaiser.de
Kultur-Blog: kaisertv.de











