 Heinz Helle, 1978 in München geboren, liest am 4.Februar auf der HAM.LIT 2016. In seinem zweiten Roman verbringt eine Gruppe junger Männer ein Wochenende auf einer Berghütte. Als sie ins Tal zurückkehren, sind die Ortschaften verwüstet, die Menschen sind tot oder geflohen, die Häuser und Geschäfte geplündert, die Autos ausgebrannt. Ein Endzeitszenario in 69 Einzelbildern, das gnadenlos und doch wehmütig ist. Karsten Herrmann hat sich mit Heinz Helle unterhalten.
Heinz Helle, 1978 in München geboren, liest am 4.Februar auf der HAM.LIT 2016. In seinem zweiten Roman verbringt eine Gruppe junger Männer ein Wochenende auf einer Berghütte. Als sie ins Tal zurückkehren, sind die Ortschaften verwüstet, die Menschen sind tot oder geflohen, die Häuser und Geschäfte geplündert, die Autos ausgebrannt. Ein Endzeitszenario in 69 Einzelbildern, das gnadenlos und doch wehmütig ist. Karsten Herrmann hat sich mit Heinz Helle unterhalten.
Karsten Herrmann: Ihr neuer Roman ist ein knallhartes Endzeitdrama, in dem fünf junge Männer von einem Alpen-Berghütten-Trip in eine vom Krieg verheerte Landschaft ohne Leben zurückkehren. In kurzer Zeit fällt der dünne Mantel der Zivilisation von ihnen ab und archaische Gewalt tritt hervor. Sind tausende Jahre der Philosophie, Aufklärung, Humanismus und hochkultivierte Sublimationsstrategien ganz umsonst gewesen?
Heinz Helle: Unsere zivilisatorischen Errungenschaften sind fragil und abhängig von stabilen gesellschaftlichen Strukturen. Das bedeutet für mich keineswegs, dass sie sinnlos sind. Es bedeutet nur, dass sie in Gefahr sind, immer und überall. Ein mangelndes Bewusstsein ihrer Fragilität kann ihre Verteidigung erschweren. Das sieht man gerade sehr schön im öffentlichen Diskurs. Ob wissentlich oder nicht: wer sagt, man muss Grenzen schließen, meint, man muss Flüchtende erschießen. Und es ist naiv, daran zu zweifeln, dass genau das die Folge einer plötzlichen, konsequenten Grenzschließung sein wird. Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, Menschen zu bleiben. Solange wir können. Darum ging es mir in meinem Roman.
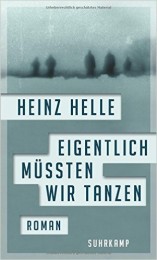 Ihr Buch hätte unter dem Motto „Wir halten bis zum bitteren Ende zusammen“ auch eine heroische Huldigung der Freundschaft unter Männern werden können. Ist es aber nicht, sondern Sie lassen fast mitleidlos einen nach dem anderen draufgehen. Warum?
Ihr Buch hätte unter dem Motto „Wir halten bis zum bitteren Ende zusammen“ auch eine heroische Huldigung der Freundschaft unter Männern werden können. Ist es aber nicht, sondern Sie lassen fast mitleidlos einen nach dem anderen draufgehen. Warum?
Als einer meiner Freunde vor einigen Jahren in der Südsee ertrank, waren wir Zurückbleibenden geschockt bis zur völligen Sprachlosigkeit. Einige Wochen später haben wir natürlich doch weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft stark unterscheidet von dem Umgang mit dem Tod in meinem Roman. Trauer ist ja sehr schwer zu versprachlichen und wird darum meist alleine erlebt, im Roman wie im echten Leben. Die, die noch leben, bleiben zusammen und lassen die Trauer hinter sich. Ich denke, mein Buch ist durchaus eine Huldigung an die Freundschaft. Aber eben keine heroische.
In kurzen Rückblenden erzählen Sie auch vom Davor und lassen die fünf aufstrebenden Jungakademiker sich erinnern. An einer Stelle sagt an einer von ihnen: „Ich meine, wir hätten es wissen müssen.“ Und an anderer Stelle: „Alles ist zu viel, zu kompliziert, zu egal. Die meisten wollen nur in Ruhe fernsehen und schlafen.“ Ist die Kriegsverheerung also eine Quittung für unseren Lebensstil im entfesselten globalen Kapitalismus?
Was die Zerstörungen ausgelöst hat, ist nicht Thema des Buches. Es ging mir darum, einen Zustand zu skizzieren, der einen maximalen Kontrast zu unserem relativ sicheren Alltag darstellt. Um vor diesem Hintergrund zu zeigen, dass eine andere Art der Verheerung bereits jetzt, in der materiell intakten westeuropäischen Gegenwart, eingesetzt hat: der Verlust von Bedeutung. Die Welt vor und nach der Katastrophe ist gleichermaßen leer, die immer gleichen Wörter dienen flexibel verschiedensten Gegenständen in unterschiedlichen Kontexten. Deswegen ist es auch so anstrengend, eine Meinung zu haben, ein Ziel oder einen Traum. Weil es so schwierig ist, herauszufinden, was man mit dem, was man sagt, eigentlich meint.
 In ihrem hochreflexiven Debüt „Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin“ haben sie von der zermürbenden Unmöglichkeit erzählt, das Leben im Hier und Jetzt zu erleben und zu lieben. In Ihrem Endzeitdrama bleibt nur der unbedingte Lebenswille ohne Ziel: „wir wissen nicht, worauf wir warten oder was wir zu finden hoffen auf unserem Marsch“ heißt es so. Ist der absoluten Sinn- und Orientierungslosigkeit einfach nicht zu entrinnen?
In ihrem hochreflexiven Debüt „Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin“ haben sie von der zermürbenden Unmöglichkeit erzählt, das Leben im Hier und Jetzt zu erleben und zu lieben. In Ihrem Endzeitdrama bleibt nur der unbedingte Lebenswille ohne Ziel: „wir wissen nicht, worauf wir warten oder was wir zu finden hoffen auf unserem Marsch“ heißt es so. Ist der absoluten Sinn- und Orientierungslosigkeit einfach nicht zu entrinnen?
Ich bin da etwas ambivalent. Einerseits glaube ich, dass es möglich ist, mit Sprache Bedeutung zu erzeugen, auch und gerade beim Denken. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu viel Nachdenken tödlich ist für das Erleben. Vielleicht darf man sich einfach nicht zu oft zusehen beim Denken. Einfach mal das Gehirn machen lassen und darauf vertrauen, dass einem im richtigen Moment das richtige Wort einfällt. Manchmal gibt es das doch: man beschäftigt sich mit einem Problem, kommt zu keinem Ergebnis, und irgendwann später formuliert man im Gespräch mit jemand anderem die perfekte Antwort, und man hat keine Ahnung, wo die herkommt. Dabei kommt sie natürlich aus einem selbst, konnte aber nur kommen, weil man nicht permanent nachgesehen hat, was da gerade passiert in einem selbst. Der Satz „Ich liebe dich“, zum Beispiel funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn er spontan kommt. Und er kann nur kommen, wenn man sich gedanklich darauf vorbereitet hat, ohne ihn explizit zu machen. Sobald man aber überlegt, ob man jetzt wirklich „Ich liebe dich“ sagen sollte, ist der richtige Zeitpunkt eigentlich schon verstrichen.
Ihre beiden Romane zeichnen sich durch eine absolut reduzierte, hoch intensive Prosa aus, mit der sie die Imaginations- und Assoziationskraft des Lesers anstacheln. Sehen Sie das auch als eine Art Gegenprogramm gegen die galoppierende Wort-Entwertung der Massenmedien?
Es wäre wunderbar, wenn meine Bücher bei einigen Menschen so wirken würden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Foto: © Jürgen Bauer. Der Autor liest am 4.Februar auf der HAM.LIT 2016, der langen Nacht junger Literatur und Musik in Hamburg.
Heinz Helle: Eigentlich müssten wir tanzen. Roman. Suhrkamp Verlag, 2015. 173 Seiten. 19,95 Euro.











