 Dies Haus des Kummers
Dies Haus des Kummers
Helen Garner macht in ihrem Gerichtsroman „Drei Söhne“ ihre Leser zu Angehörigen einer von Trauer geschlagenen Familie. Eine Kurzrezension von Alf Mayer – und dann Helen Garner selbst in einem Textauszug.
„Ich sah es in den Nachrichten. Nacht. Gebüsch. Wasser, verschwommene Lichter, ein Hubschrauber. Männer mit Warnwesten und Schutzhelmen. Hier war etwas Schlimmes passiert. Etwas Fürchterliches:
Lieber Gott, lass es einen Unfall gewesen sein.“
Das notiert die Australierin Helen Garner auf Seite zwei ihres True-Crime-Buches „Drei Söhne“ (This House of Grief), einem Meilenstein des Genres. Ein Mann in einer demütigenden Phase seines Lebens kommt nachts von der Fahrbahn ab, sein Auto rollt in ein großes Wasserloch, wie es die Farmen in Australien alle haben, läuft voll Wasser und versinkt. Er ist der Einzige, der lebend davonkommt. Seine drei Söhne, zehn, sieben und zwei Jahre alt, ertrinken.
Wie schuldig, ja gar wie vorsätzlich schuldig ist er? Wie sehr ist dieser Mann ein Mörder?
Der Unfall ereignet sich am Abend des 4. September 2005 südwestlich von Melbourne, auf dem Princes Highway zwischen Winchelsea und Geelong, der Teil des National Highway 1 ist, der auf 13.600 Kilometern den Kontinent umrundet. Sehr viel Weg legt auch Helen Garner zurück in ihrem Buch, sie erkundet die Schrecklichkeit der Herzen, die Territorien von Schuld und Scham, Urteil und Zweifel, schlimmen Gedanken und unklaren Taten ebenso wie die harte Seite des Gesetzes, die Mühlen der Justiz und die Bilder, die wir uns davon machen.
Oftmals scheint das Buch fast schlicht, eine Sprache ohne Brimborium, reduziert auf das Wesentliche, immer aber wieder irritierend. Poetisch durch die Resonanz kleiner Details, verstörend mit der Offenheit auch autobiographischer Details der Autorin und ihrem Eingeständnis des Nicht-Wissens. Helen Garner ist bekannt dafür, dass ihr Blick hart ist, ihre Berührung aber sanft. „Drei Söhne“ beginnt sie wie die Nacherzählung eines Country-und-Western-Songs:
Es war einmal ein schwer arbeitender Mann, der mit seiner Frau und seinen drei kleinen Söhnen in einer Kleinstadt in Victoria lebte. Sie schlugen sich mit seinem kargen Reinigerlohn durch und bauten mühsam an einem größeren Haus. Eines Tages teilte die Frau ihrem Mann aus heiterem Himmel mit, dass sie ihn nicht mehr liebe. Sie wollte die Ehe beenden und bat ihn, auszuziehen. Die Kinder sollten weiter bei ihr wohnen, aber er könne sie sehen, wann immer er es wolle. Er solle alles aus dem Haus mitnehmen, was er gerne wolle. Nur das neuere ihrer Autos solle er ihr lassen.
Der Mann tat das alles, zog ein paar Straßen weiter, zu seinem verwitweten Vater. Bald schon sah man die Frau in Gesellschaft des Betonarbeiters, der das Fundament des neuen Hauses gegossen hatte. Er war ein Evangelikaler, hatte mehrere Kinder aus einer kaputten Ehe, die Frau ging mit ihm zur Kirche. Und er fuhr das Auto, für das der Ehemann so lange geschuftet hatte. Bis er an jenem Vatertagsabend 2005 (der in Australien am ersten Sonntag im September begangen wird) verwirrt und nass auf der Straße stand, anscheinend nichts zur Rettung seiner Kinder unternommen hatte. Einen Hustenanfall habe er gehabt. So sei es zu dem Unfall gekommen. Wie schuldig macht ihn das? Und wie soll er – soll er? – dafür büßen?
Helen Garner ist Mitte 60, als sie anfängt, den Prozess von Robert Farquharson zu begleiten. Beim ersten Mal hat sie eine alte Freundin dabei. „Beide hatten wir den Schmerz und die Demütigungen einer Scheidung am eigenen Leibe erfahren, aber ihn auch selbst jemandem zugefügt.“ Analog des Fortschreitens im Verfahren macht sie uns mit dem Fall und seinen offenen Fragen, mit dem Angeklagten, dem Verteidiger, dem Richter, dem Staatsanwalt und den Ermittlern, der Ehefrau, verschiedenen Gutachtern und insgesamt über 40 Zeugen bekannt. Es wird die reichgesättigte Leinwand eines großen Dramas. Selbst die technischen Details, die Tauchtests der Polizei (wie ein mit Dummys besetztes, im Wasser versinkendes Auto sich bei offenen oder halbgeschlossenen Fenstern füllt), die Geometrie von Fahrspuren und Lenkwinkeln, eine Computersoftware namens „Car Crash“ zur Simulation des Unfalls, Aussagen von Psychologen und Sachverständigen, all die Bemühen um Sachlichkeit und Evidenz, all die Erklärungsversuche münden an der Wand, die der stumme Angeklagte ist. Er ist die Projektionsfläche. Auch für uns Leser. Denn auch uns stellt sich die Frage, wie ein Mann denn auszusehen und sich zu verhalten hat, dem alle drei Kinder gestorben sind – oder die er vielleicht umgebracht hat. Vielleicht sogar kaltblütig und vorsätzlich.
Und daneben geht das Leben weiter. Ein Nachbar, notiert Helen Garner, hat ein ausgebrochenes Pferd wieder eingefangen, der es mit einem Apfel in der einen und einer Karotte in der anderen beruhigte. Für die langen Stunden der Juryberatung nimmt sie ihr Strickzeug mit in den Gerichtssaal, der halbfertige grüne Schal fällt ihr aus der Hand, als das Urteil gesprochen wird. Zuhause spürt sie „das Bedürfnis, den Moment der Entscheidung irgendwie festzuhalten. Ich markierte ihn mit einer roten Masche. Dann strickte ich bis zum Ende der Reihe und kettelte ab.“
 Hier ein Textauszug aus „Drei Söhne“, ab Seite 205:
Hier ein Textauszug aus „Drei Söhne“, ab Seite 205:
Die Verteidigung hatte noch ein letztes Ass im Ärmel: einen Sozialarbeiter und Trauerberater namens Gregory Roberts aus Geelong.
Wie es der Zufall will, hat eine gute Freundin von mir jahrelang als Trauerbegleiterin im Peter MacCallum Krebszentrum gearbeitet. Sie ist eine feinfühlige und ernsthafte Person, und was sie mir über ihre Arbeit erzählt hat, hat mir klar gemacht, dass sie und ihre Kollegen da eine unentbehrliche und zutiefst barmherzige Aufgabe erfüllen. Doch Roberts, so sagte Morrissey, war anscheinend noch mehr als ein kluger Mann, der tröstete. Er würde bezeugen, dass Farquharsons unnatürlich erscheinendes Verhalten, nachdem er sich aus dem Wasser gerettet hatte, seine bizarren Reaktionen auf das Unglück, »durchaus im Spektrum der normalen Trauer- oder Traumareaktionen eines plötzlich seiner Kinder beraubten Elternteils« lägen.
Die einzigen Zeugen, die Meinungen vor einem Geschworenengericht sagen dürfen, müssen anerkannte Experten auf ihrem Gebiet sein. Bevor die Geschworenen an diesem Morgen in den Gerichtssaal traten und bevor Gregory Roberts aufgerufen wurde, befragte Richter Cummins Morrissey zu Roberts’ formalen Qualifikationen. Diese schienen nämlich, so sagte er, recht dürftig für einen Experten als Zeugen. Was ihm denn mehr Autorität verleihe als jedem anderen Mitglied der Gemeinde?
Ein normaler Mensch könne es vielleicht überraschend finden, argumentierte Morrissey, dass Farquharson sich vom Baggersee entfernt, Hilfsangebote ausgeschlagen und dauernd Leute um Zigaretten gebeten habe. ein normaler Mensch könnte leicht … abgestoßen sein von Farquharsons wiederholter Bitte, direkt zu seiner Exfrau gefahren zu werden. Doch Roberts schöpfe anscheinend aus einem großen Erfahrungsschatz mit Menschen, die einen plötzlichen Verlust erlitten hatten, und habe zwei Konzepte – »traumatische Trauer« und »Hyperfokus- sierung« –, durch die diese merkwürdigen Verhaltensweisen in den Bereich des Normalen zurückgerückt würden. »Traumatische Trauer« sei ein relativ neues Erklärungsmodell, und es gebe erst sehr wenig Forschung darüber, dennoch sei es bereits als diagnostizierbarer Zustand in das Diagnostic and Statistical Manual IV aufgenommen worden.
Richter Cummins blickte misstrauisch drein. Er erlaubte Morrissey, Mr Roberts aufzurufen, doch eine zweite Trauerberaterin, Leona Daniel, eine ältere Dame, die am Unfallabend um zweiundzwanzig Uhr an Farquharsons Bett in der Geelonger Notaufnahme gerufen worden war, ließ er nicht zu. Mrs Daniel hatte seine große Verzweiflung miterlebt und ihr Bestes getan, ihm Trost zuzusprechen.
»Die Staatsanwaltschaft«, so der Richter, »hat nie behauptet, dass ihr Klient keinen Kummer gezeigt habe. Er ist beschuldigt, seine Kinder ermordet zu haben. Er steht nicht unter Anklage, weil er nicht geweint hat.«
Farquharson lauschte, und sein Gesicht verdüsterte sich. Es passte ihm gar nicht, dass sein psychischer Zustand diskutiert wurde. er wirkte plötzlich viel älter; die Haare waren länger geworden und wurden grau. Von Zeit zu Zeit blickte er kurz zu seiner Familie hinüber, mit einem schiefen, empörten Stirnrunzeln.
Herein kam Roberts, ein kleiner, zerbrechlich wirkender Mann mit Vogelköpfchen und dunklem, sauber gestutztem Bart wie bei einem Renaissancehöfling. Er arbeite, so sagte er, für die Sozialstation für Hoffnung in Trauerfällen sowie für die SIDS-und-Kinder-Organisation in Geelong, einen Verband, der jedem Unterstützung anbiete, der von dem unerwarteten Tod eines Kindes betroffen sei. Als Morrissey die Worte »beraubter Vater« benutzte, fing Kerri Huntington leise an zu weinen und wischte sich mit den Fingerspitzen die Tränen aus den Augen. Ihre Schwester Carmen wurde blass und weinte ebenfalls, und Farquharson selbst holte sein Taschentuch hervor und blinzelte ununterbrochen, die Mundwinkel nach unten gezerrt. Direkt im Blickfeld der Schwestern faltete eine Journalistin ihre Zeitung zu einem Block und begann, ein Kreuzworträtsel zu lösen.
Vier Tage nachdem die Jungs im Wasser gestorben waren, war Gregory Roberts gebeten worden, Farquharson beizustehen. Morrissey bat den Trauerberater, alle Ereignisse der verhängnisvollen Nacht jetzt noch einmal durchzugehen, angefangen bei Farquharsons Flucht aus dem See bis hin zu dem Polizeiverhör in der Notaufnahme. Roberts nannte alle Stadien und interpretierte sie mit dem Vokabular der »traumatischen Trauer«, diesem neu aufkommenden Ansatz, zu dem er auch gerade promovierte.
Nachdem er es aus dem Wasser geschafft hat, sagte Roberts, ist der betreffende Mensch desorientiert. er steht unter Schock und der Grad der Angst ist sehr hoch. Sein Adrenalinspiegel steigt. Der Kampfmodus wäre gewesen, dass er versuchte, die Kinder aus dem Auto zu befreien. Da das nicht klappte, setzte der Fluchtmodusein – er versuchte zu fliehen.
Obwohl Rapke diese Beschreibung schon niedergemacht hatte, ließ Morrissey sie wieder auferstehen: Was es denn bedeute, dass Zeugen ausgesagt hatten, er habe »lauter wirres Zeug« geredet?
Das sei eine Folge der Desorientiertheit, vor allem wenn man bedenke, dass er ja bewusstlos gewesen sei. Wenn man vollgepumpt sei mit Adrenalin, sei man nicht besonders klar bei Verstand. Sogar falls man in der Lage sei, Angaben zu machen, könne man leicht roboterhaft und teilnahmslos wirken. Menschen, die auf diesem Gebiet erfahrung hätten, so erklärte der Trauerbegleiter, fänden es ganz und gar nicht merkwürdig, wenn eine Person klar und deutlich erkläre: »Ich habe gerade meine Kinder umgebracht.« Das sei Teil des Kapitulationsmodus, auch wenn die Wahrhaftigkeit der Aussage noch nicht ganz im eigenen Kopf angekommen sei.
Was es mit seinem dringenden Bedürfnis auf sich habe, zu Cindy gefahren zu werden?
Wenn ein Kind in Gegenwart nur des einen Elternteils stirbt, sagte Roberts, dann entsteht das sehr heftige Bedürfnis nach Kontakt mit dem anderen Elternteil, egal ob die beiden zusammen oder getrennt leben. Traumatisierte Menschen sind von einer Situation schnell überfordert. Dann setzt eine Hyperfokussierung ein. Die Person handelt dann sehr zielgerichtet. Alle anderen Informationen, mit denen sie konfrontiert wird, igno- riert sie. Geschultes Personal weiß, dass in solchen Situationen jemand anderes die Verantwortung übernehmen muss – einerseits um empathisch auf das zu reagieren, was die hyperfokussierte Person sagt, sie aber dennoch zuverlässig dazu zu bringen, was wirklich getan werden muss. Von Shane Atkinson und Tony McClelland, den beiden jungen Männern, die wegen Farquharson angehalten hatten, konnte man natürlich nicht erwarten, dass sie das wussten. Sie hatten seinen hyperfokussierten Forderungen nachgegeben.
Wie es mit der Tatsache stehe, dass Farquharson ihr wiederholtes Angebot, nach dem Auto zu tauchen, ausgeschlagen und auch nicht ihr Telefon verwendet habe, um den Notruf anzuwählen?
Farquharsons System sei bereits überlastet gewesen. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, irgendwelche weiteren Dinge auf- oder überhaupt nur wahrzunehmen. Als sie bei Cindy angekommen waren und er auf sie wie im Delirium gewirkt hatte, sei er bereits in das Stadium eingetreten, das in der Fachliteratur die Aufschrei-Phasegenannt wurde. ein Teil des Geschehens habe angefangen, ihm klar zu werden. Die Anwesenheit Cindys, einer »Schlüsselbezugsperson«, habe wahrscheinlich noch mehr Emotionen ausgelöst.
Farquharson Unfähigkeit, sich an den Rettungsversuchen am Baggersee zu beteiligen, zeigte, dass er bereits ziemlich am Ende seiner Kräfte war. Der Adrenalinspiegel bleibt nicht lange sehr hoch. er war in die Dissoziationsphase eingetreten, einen Zustand, in dem er einfach verdrängte, was passiert war, um sich von der Sache zu lösen und Abstand zu gewinnen.
Seine wiederholte Bitte um Zigaretten, die die anderen so erzürnt hatte?
Traumaexperten wüssten, dass der Körper in Stresssituationen nach Stimulanzien giere. Das geschehe weder willentlich noch bewusst. Es sei ein physiologischer Fakt, und Roberts sei davon viele Male Zeuge gewesen.
Wie konnte es sein, dass zwei zivile Augenzeugen Farquharson hätten weinen sehen, während einige Polizisten, besonders die beiden, die ihn in der Notaufnahme befragt hatten, verblüfft darüber waren, wie wenig Erschütterung er zeigte?
Das sei ebenfalls normal – gehörte zu der Bandbreite der normalen Trauma- und Trauerbewältigung. Die meisten Normalbürger fielen, wenn sie sich einem Polizisten, einem Sanitäter oder einem Arzt (Personen, die Morrissey Uniformierte nannte) gegenübersahen, in eine sehr respektvolle Sprechweise, und Menschen, die gerade zu viel zu verarbeiten haben, neigten dazu, sich vertrauter Verhaltensmuster zu bedienen. Außerdem würden die Menschen gefühlstaub, wenn sie sich in einem Stadium von »traumatischer Trauer« oder in dem, was Roberts von da an »komplexe Trauer« nannte, befanden. Ihre Stimmung schwanke dann. Sie seien nur noch eingeschränkt in der Lage, rational zu denken: ein Zustand, der sich »Kognitive Verengung« nenne. Was sie dann machten, könne Beobachtern unlogisch erscheinen…
Textauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags aus:
Helen Garner: Drei Söhne. Ein Mordprozess (This House of Grief, 2014). Aus dem Englischen von Lina Falkner. Berlin Verlag in der Piper GmbH, München/ Berlin 2016. 352 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen.
Siehe auch die CulturMag-Besprechung von Alf Mayer: Die Schrecklichkeit der Herzen. Helen Garners großes Gerichtsbuch „Drei Söhne. Ein Mordprozess.“
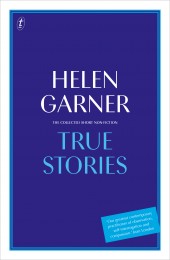
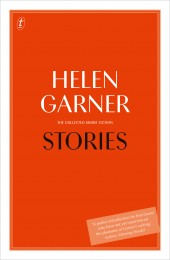 Helen Garners Werk umfasst Kurzgeschichten, Essays, Filmdrehbücher und Romane. Ihr Drehbuch für „Two Friends“ (Zwei gute Freundinnen) wurde 1986 zum Spielfilmdebüt von Jane Campion, die später mit „Das Piano“ (1993) die Goldene Palme in Cannes gewann und mit zwei Staffeln der TV-Serie „Top of the Lake“ glänzte (CM-Kritik hier). Kontrovers war das 1995 erschienene non fiction-Buch über einen Fall von sexueller Belästigung an der Universität von Melbourne, „The First Stone: Some questions about sex and power“ von 1995. Weithin mit positiven Kritiken begrüßt wurde ihr im Frühjahr 2016 erschienener Essayband „Everywhere I Look“.
Helen Garners Werk umfasst Kurzgeschichten, Essays, Filmdrehbücher und Romane. Ihr Drehbuch für „Two Friends“ (Zwei gute Freundinnen) wurde 1986 zum Spielfilmdebüt von Jane Campion, die später mit „Das Piano“ (1993) die Goldene Palme in Cannes gewann und mit zwei Staffeln der TV-Serie „Top of the Lake“ glänzte (CM-Kritik hier). Kontrovers war das 1995 erschienene non fiction-Buch über einen Fall von sexueller Belästigung an der Universität von Melbourne, „The First Stone: Some questions about sex and power“ von 1995. Weithin mit positiven Kritiken begrüßt wurde ihr im Frühjahr 2016 erschienener Essayband „Everywhere I Look“.
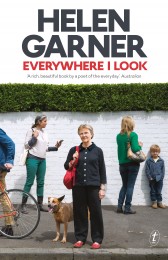
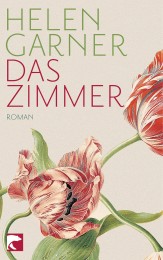 Auf Deutsch liegen, alle vom Berlin Verlag, von ihr vor:
Auf Deutsch liegen, alle vom Berlin Verlag, von ihr vor:
Das Zimmer (2010)
Das Haus an der Baker Street (2010)
Die Kinder anderer Leute (2011)
Ihr Verlag in Australien ist Text Publishing in Melbourne, wo auch Peter Temple, Garry Disher, Jock Serong und Stephen Greenall erscheinen. Von ihr sind dort im Oktober 2017 herausgekommen:
True Stories: The Collected Short Non-Fiction
Stories: The Collected Short Fiction
Ein Porträt von Helen Garner im Guardian
Ein großes Interview im Melbourner Monthly.












