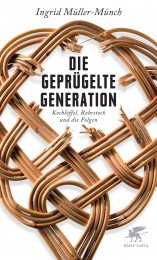 „Lakritzwasser, Nudelsalat und Kochlöffel – eine ganz normale Kindheit?“
„Lakritzwasser, Nudelsalat und Kochlöffel – eine ganz normale Kindheit?“
Jahrzehntelang galt in Deutschland der Rohrstock als adäquates Mittel der Erziehung, in vielen Familien, Kinderheimen und Erziehungsanstalten. Ingrid Müller-Münch fragt in ihrem Buch „Die geprügelte Generation“ nach dem Warum dieser unsäglichen Erziehungstradition und beschreibt die Folgen, die diese schwarze Pädagogik für die Betroffenen hatte. Christina Bacher hat sich mit der Autorin unterhalten.
Christina Bacher: Im Vorwort erzählst du, dass neben Lakritzwasser und Nudelsalat auch die Schläge durch den Vater zu deiner Kindheit gehörten. Ist das gerade erschienene Buch „Die geprügelte Generation“ somit dein bislang persönlichstes Buch?
Ingrid Müller-Münch: Es betrifft mich, anders als alle meine bisherigen Sachbücher, sicherlich ganz persönlich. Denn Ausgangspunkt meiner Recherche und meiner Kompetenz ist meine Erfahrung als ein geprügeltes Kind der 1950er und 1960er Jahre. Aber das, was ich als Kind erlebt habe, spielt nur am Rande eine Rolle. Eigentlich nur im Vorwort. Darin wollte ich deutlich machen, dass ich genau weiß, wovon die Rede ist. Ich bin sozusagen Expertin in Sachen Prügelstrafe. Das haben meine InterviewpartnerInnen sicherlich auch gespürt und sich mir gegenüber sehr geöffnet, vieles von sich preisgegeben.
CB: Was hat es mit dir gemacht, sich dem Thema jetzt – nach all den Jahren – auch auf einer sachlichen Ebene zu nähern?
IMM: Ich habe durch die vielen Gespräche mit einst geprügelten Kindern und mit Fachleuten noch einmal deutlich gespürt, dass ich damals mit meinem Kummer und später mit meinen daraus resultierenden Problemen nicht alleine stand. Das Gefühl, niemand war als Kind so unglücklich und alleingelassen wie ich, hat sich dadurch endgültig verflüchtigt.
CB: Du hast für das Buch viele eindrucksvolle Geschichten gesammelt, Interviews geführt und auch deinen Freundeskreis mit der Frage konfrontiert, ob sie Erfahrungen mit Schlägen in der Kindheit gemacht haben. Gab es auch Geschichten dabei, die für dich selbst neu und erschreckend waren?
IMM: Am Schlimmsten fand ich, dass es Eltern gab, die ihre Kinder vorsorglich schlugen. Also ohne direkten Anlass, sondern einfach nur weil sie glaubten, ihr Kind sei sowieso schlecht und verdorben. Und diese Verderbnis könne nur durch Schläge korrigiert werden. Außerdem hat mich die Systematik fassungslos gemacht, mit der in Familien zum Rohrstock gegriffen wurde. Sozusagen als alltägliches Beiwerk der Kindheit.
CB: Die Autorin Alice Miller behauptet, das Bewusstsein der Öffentlichkeit sei noch weit von der Erkenntnis entfernt, „dass das, was dem Kind in den ersten Lebensjahren passiert, unweigerlich auf die ganze Gesellschaft zurückschlägt“. Was ist denn aus den geprügelten Kindern geworden? Und mit welchen Auswirkungen haben wir da zu rechnen?
IMM: Die Experten, die ich für das Buch zu den Auswirkungen der erlittenen Misshandlungen befragt habe, sind sich einig: Gewalt gegenüber Kindern bleibt nicht folgenlos. Im späteren Erwachsenenleben, so erzählten mir Erziehungswissenschaftler, Kriminologen und Therapeuten, neigten derart malträtierte und dadurch traumatisierte Kinder oftmals zu Depressionen. Sie werden häufig ein leichtes Opfer sexueller Übergriffe oder gewalttätiger Partner. Dies wurde mir besonders deutlich am Beispiel der von mir interviewten Theresia, deren geliebter Vater sie immer schlug. Später, als erwachsene Frau assoziierte sie Schläge immer mit Liebe. Als ihre Partner sie ebenfalls schlugen, hat sie das als Ausdruck von Zuneigung interpretiert. Eine US-Studie hat ergeben, dass geprügelte Kinder aggressiver sind und sich langsamer entwickeln als andere Kinder. Und Unicef hat herausgefunden, dass geschlagene Kinder häufiger zu Risikoverhalten wie Alkohol- und Drogenkonsum, frühzeitigen sexuellen Beziehungen, Wahnvorstellungen, Depressionen und Aggressionen neigen. Außerdem kann man glaube ich, mit fug und recht sagen, dass zwar nicht jedes geprügelte Kind selbst gewalttätig wird, dass aber fast jeder gewalttätige Gefängnisinsasse als Kind geprügelt wurde.
CB: Du hast ja geschrieben, dass die meisten Menschen, die du getroffen hast und die heute über 50 und über 60 Jahre alt sind, Erfahrungen mit Prügel und Schlägen in der Kindheit gemacht haben. Du hast zahlreiche Menschen dazu interviewt, darunter auch den Schriftsteller Tilmann Röhrig. Alle anderen wollten anonym bleiben – warum?
IMM: Niemand spricht gerne darüber, wie brutal die eigenen Eltern mit dem inzwischen Erwachsenen früher umgegangen sind. Wie gerne hätte doch jeder Eltern, auf die man stolz sein kann. Außerdem schmerzt es sehr, sich zu erinnern. Wenn dann Vater oder Mutter noch leben, Geschwister da sind, traut man sich mit einem derart heiklen Thema, über das häufig familienintern nie gesprochen wurde, nicht einfach so an die Öffentlichkeit. Tilman Röhrig war da eine Ausnahme. Er hatte sich mit den erlittenen Prügeln schon in dem seit Jahrzehnten erfolgreichen Buch „Thoms Bericht“ auseinander gesetzt. Er brauchte deshalb auch niemanden mehr zu schützen.
CB: Ist das Buch auch als Botschaft an all diejenigen zu lesen, die entweder selbst zugelangt oder weggeschaut haben, wenn Kinder damals, in den 1950ern und 1960ern, geschlagen wurden? Könnte das Buch dazu führen, dass in den Familien hierüber diskutiert wird, sozusagen generationsübergreifend, zwischen den einst prügelnden Eltern und den geprügelten Kindern – soweit die Eltern noch leben?
IMM: Ich hoffe, dass die Eltern, die heute hochbetagt sein dürften, vielleicht durch dieses Buch dazu angeregt werden, mit ihren inzwischen ja auch schon über 50 Jahre alten Kindern hierüber zu sprechen. Ich hoffe außerdem, dass Eltern sich nicht dadurch aus der Bredouille ziehen, dass sie leugnen, ihre Kinder geschlagen zu haben. Das haben nämlich die wenigen alten Väter oder Mütter, mit denen ich versucht habe zu sprechen, mir gegenüber getan. Deshalb habe ich den Versuch auch aufgegeben, diese Generation zu Wort kommen zu lassen. Und Reue oder gar Entschuldigung – nein, das hat mir gegenüber keiner geäußert.
CB: Der erste alternative Kinderladen in Köln wurde 1965 gegründet, ähnlich wie in Berlin und anderen größeren Städten. Um 1968 sprossen Elterninitiativen bundesweit wie Pilze aus dem Boden. Kinder durften sich in den von ihren Eltern ins Leben gerufenen Einrichtungen frei entfalten, wachsen und gedeihen. Man war nach den autoritätsgeprägten 50/60-er Jahren begeistert von der Pädagogik Summerhills – das genaue Gegenteil als Heilmittel für ehemals zugefügte Wunden?
IMM: Um aus diesem dumpfen Milieu der kinderfeindlichen Kleinfamilien auszubrechen, bedurfte es eines radikalen Schnittes. Den haben die revoltierenden Studenten 1968 vollzogen. Gut, manches Mal gingen sie, gingen wir zu weit. Aber um wirklich mit der unseligen Tradition der sogenannten „Schwarzen Pädagogik“ zu brechen, bedurfte es eines kräftigen Donnerschlages. Gottseidank hat es ihn gegeben, auch wenn nicht alle damaligen Versuche gelangen. Aber sie führten immerhin dazu, dass heute gewaltfreie Erziehung bei 90 Prozent der Deutschen als Idealfall angesehen wird. Das war wirklich nicht immer so. Noch 1968, also dem Jahr des Aufbruchs, hielten 85 % aller westdeutschen Eltern die Prügelstrafe für eine angemessene Erziehungsmethode. Nur 2 % aller Eltern, so ergab damals eine Umfrage, schlugen ihre Kinder nie.
CB: Erst im Jahre 1973 wurde in der BRD „körperliche Züchtigung“ in pädagogischen Einrichtungen gesetzlich verboten. Vorher „schlug die Justiz kräftig mit“, denn Lehrer, Jugendfürsorger und auch Pfarrer hatten ja das Recht Watsch’n, Ohrfeigen oder Kopfnüsse zu verteilen. Heute hat in Deutschland jedes Kind den gesetzlich verbrieften Anspruch auf eine gewaltfreie Erziehung – theoretisch. Sind die Schläge aus deutschen Kinderzimmern dadurch tatsächlich verbannt?
IMM: Auch heute noch werden Kinder von ihren Eltern misshandelt, geschlagen, gequält. Aber heute muss dies heimlich geschehen. Heute können Vater und Mutter, wenn man sie dabei erwischt, angezeigt werden. Das Jugendamt mischt sich ein. Kinder haben Notrufe und Anlaufstellen, um sich zu beklagen, um Hilfe zu holen. Ärzte, die Verletzungen bei Kindern feststellen, sind sensibilisiert. Damals, vor 50 oder 60 Jahren, hätte kein geprügeltes Kind gewusst, an wen es sich mit einem Hilfeschreie hätte wenden können. Die Nachbarn guckten weg. Und das Beispiel von Ilka, die ich in meinem Buch beschreibe, zeigt ja, dass selbst die Polizei, an die sich das Mädchen damals wandte, nicht einschritt.
CB: Eine Befragung im Auftrag des Bundesfamilienministerium ergab, dass bei deutschen Eltern die Rate an regelrechten Kindesmisshandlungen inzwischen bei konstant unter 10 % liegt, bei türkischen Familien wird ein Wert von 18 % angegeben, bei Migrantenfamilien aus der früheren Sowjetunion 12 % und Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien 15 %.
IMM: Ja, das ist noch einiges an Aufklärung und Beistand nötig. Menschen aus anderen Kulturkreisen haben auch zur Prügelstrafe ein von uns inzwischen abweichendes Verhältnis. Da bedarf es der Mithilfe von Sozialarbeitern und Lehrern.
CB: Tatsächlich gibt es immer noch Pädagogen, die die These vertreten, dass „ein Klaps noch Niemandem geschadet“ hat oder die sogar so weit gehen zu behaupten, es sei gut, wenn gerade Eltern die Rolle der körperlichen Züchtigung übernehmen, bevor es Jemand anderer tut. Was kann man denen entgegen halten, die das heute noch behaupten?
IMM: Zum einen muss man einfach nur auf die zahlreichen Untersuchungen darüber verweisen, wie negativ und hemmend sich Prügel auf die Entwicklung eines Kindes, eines Menschen auswirken. Wie sehr diese Prügel schädigen, statt formen. Ich zitiere neuerdings immer die Politikerin, Juristin und Kinderrechtsexpertin Lore Peschel-Gutzeit, die mir folgendes erzählte: Als neulich wieder einmal Jemand, es war diesmal der Senatspräsident eines Oberlandesgerichts, im Gespräch über die Prügelstrafe äußerte: „Aber mir hat der Klaps doch auch nicht geschadet“, entgegnete sie ihm: „Was wissen Sie denn, was für ein bezaubernder Mensch aus ihnen geworden wäre, wären sie nicht geschlagen worden.“ Das ist ihrer Erfahrung nach ein sehr wirksames Mittel, um diesem blöden und dummen Satz zu begegnen.
CB: An die Autorin dieses Buches und gestandene Journalistin ebenso wie an die Mutter eines Sohnes die Frage: Gibt es ein Patentrezept, wie Kinder am besten gedeihen können? Und wenn ja, dann wüssten wir es gerne.
IMM. Liebe, Geduld, Lachen, Spaß, Zuwendung und sich manchmal ganz ganz klein machen. Sich auf die Ebene des Kindes begeben, ihm zuhören. Sich nicht als machtvoller Erzieher verstehen, der sich sein Kind zurechtbiegen will, sondern als ein Helfer ins Leben. Als jemand, der die Leiter aufstellt und vorm Kippen bewahrt, auf der das Kind sein Erwachsenwerden erklimmen kann.
CB: Vielen Dank für das Gespräch.
Ingrid Müller-Münch: Die geprügelte Generation. Kochlöffel, Rohrsock und die Folgen. Klett.Cotta 2012. 284 Seiten. 19,95 Euro. Mehr zum Buch finden Sie hier.











