 Glasperlenspiele im Blütenstaubzimmer
Glasperlenspiele im Blütenstaubzimmer
– Versuch einer Verteidigung aus aktuellem Anlass. Von Joe Paul Kroll.
Als ob man es nicht schon schwer genug hätte, als Kritiker. Parasitär verhalte man sich zum Werk, hallt es einem von pikierten Kunstschaffenden ebenso entgegen wie von Zeitgenossen, die das aus dem Sandkasten bekannte „mach’s doch erstmal besser“ für ein gültiges letztes Wort halten. Und dann noch Kritik zum Gegenstand der Kritik zu machen? Bibeltextlich nicht ganz zutreffende, aber der Tendenz nach unmissverständliche Hinweise auf die Sünde Onans muss man sich gefallen lassen. So auch, wenn ich mich statt der Verleihung des Büchnerpreises an Sibylle Lewitscharoff deren Kommentierung durch Georg Diez zuwende. Der Literatur-, Kultur- und Zeitgeistkritiker des Spiegel polemisierte aus diesem Anlass in seiner freitäglichen Online-Kolumne gegen die Autorin. Wie immer, wenn ich auf eine solche Polemik inmitten einhelligen Medienlobes stoße, freue ich mich zunächst am Gefühl, einen Verbündeten im widerspenstigen Geiste zu haben. Wenn dieser Verbündete aber Georg Diez heißt, währt die Freude nicht lange.
Frau Lewitscharoffs letzten Roman, „Blumenberg“, habe ich bei Erscheinen respektvoll-distanziert besprochen. Dass ich vielleicht etwas zu freundlich war, will ich einem Kommentator im Nachhinein zugestehen, aber manchmal bedarf auch der Ärger einer gewissen Latenzzeit. Übrigens muss ich, was die Kritik am philosophischen Gehalt des Romans angeht, vor Birgit Reckis hervorragender Auseinandersetzung im Merkur (Jg. 66, Nr. 4, 2012) den Hut ziehen. Dass ich wiederum so manches etwas anders sehe als Herr Diez, lässt sich an meiner Rezension von Christian Krachts Roman „Imperium“ ablesen. Wenn also Diez über Lewitscharoff schreibt, wird man mich wohl als einigermaßen interessierten Beobachter einstufen dürfen.
„Reden wir über Stil“, hebt Diez an, und das ist für ihn, der auch gerne mal direkt zum vermeintlichen ideologischen Kern eines ihm missfälligen Textes übergeht, schon eine löbliche Absicht. Diez zitiert einige Sätze aus Lewitscharoffs Roman „Apostoloff“ (2010), die er als Belege einer leerlaufenden, gegenstandslosen Sprachartistik wertet. Man habe es zu tun „mit einer Autorin, die ihre Worte wie Blumen behandelt, die sie auf der Wiese pflückt, trocken presst und dann in ihr Poesiealbum klebt, um sie immer und immer wieder anzuschauen und sich über sich selbst zu freuen, wie schön sie das wieder gemacht hat“.
Die fraglichen Romansätze möge jeder selbst nachlesen. Jenseits des allfälligen, unfruchtbaren Streits über den Geschmack scheint es mir jedoch, als hätte ich den Stil Lewitscharoffs in diesen Passagen falsch verstanden. Die stets etwas überzogenen Vergleiche – „Würdig wie eine Koryphäe des neunzehnten Jahrhunderts gibt er sich dem Studium der [Speise-]Karte hin“, – das etwas überkandidelte Vokabular, die manierierte, im Verhältnis zum Gegenstand übertrieben formelle Diktion, die Schachtelsätze, mit denen banale Vorgänge beschrieben werden, habe ich als versuchten Humor verstanden, ähnlich eher Max Goldt denn Durs Grünbein.
Wie dem auch sei, Diez hält sich nicht lange mit rein ästhetischen Verfehlungen auf. Der kürzeste Weg zur politisch-ideologischen Erledigung eines Schriftstellers führt noch immer über Auschwitz. Und was Diez über den Zusammenhang von Feuerbestattung, Schlankheitswahn und Vernichtungslagern zu zitieren weiß (diesmal aus der Autorin Poetikvorlesungen), liest sich in der Tat wunderlich bis hochnotpeinlich, aber mehr noch als bei stilistischen Anklagen ist Kontext hier alles. Und der fehlt. Stattdessen fragt Diez: „Jetzt mal im Ernst: Würden Sie dieser Frau Ihre Kinder anvertrauen? Würden Sie diese Frau zu sich nach Hause einladen? Würden Sie ihr ein Buch abkaufen?“
Die erste Frage würde ich verneinen mit Bezug auf zahlreiche mir persönlich unbekannte Autorinnen und Autoren, selbst solche, die nicht ohnehin schon tot sind und William S. Burroughs heißen. Sie tut ohnehin so wenig zur Sache wie die zweite (auch da: meistens nein, aber aus anderen Gründen). Die dritte Frage ist wohl in einer Zeit, da politische Stellungnahmen durch Konsumentscheidungen abgelöst werden, die scheinbar drängendste, aber nicht minder nichtssagend als die anderen beiden.
Nochmals Georg Diez: „Warum also bekommt Sibylle Lewitscharoff, diese Gegenwartslegasthenikerin, diese herrische Reaktionärin, diese Gottesanbeterin mit dem fatalen Hang zum Kunsthandwerk, den immer wieder sogenannten ‚wichtigsten‘ deutschen Literaturpreis im Namen des jungen, wütenden, traurigen, liebenden, rasenden Georg Büchner?!“
 Jung, wütend, traurig, liebend, rasend – das sind Eigenschaften, die sich der Kritiker Diez gerne wünscht und die er in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht ganz zu unrecht vermisst. Nur macht er dieser Stelle den Namen Büchners für sein eigens kritisches Programm nicht mit mehr Recht dienstbar, als er es der Darmstädter Akademie anlastet. Vor wenigen Jahren geisterte eine Debatte über „Gnostiker“ vs. „Emphatiker“ unter Autoren und Kritikern. Nicht ganz ohne Parteinahme schrieb damals Hubert Winkels: „Die Emphatiker des Literaturbetriebs, die Leidenschaftssimulanten und Lebensbeschwörer ertragen es nicht länger, dass immer noch einige darauf bestehen, dass Literatur zuallererst das sprachliche Kunstwerk meint […].“[1] Die Gnostiker hingegen bezögen ihren „Lustgewinn“ gerade aus „der Erkenntnis dieser Prinzipien“.
Jung, wütend, traurig, liebend, rasend – das sind Eigenschaften, die sich der Kritiker Diez gerne wünscht und die er in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht ganz zu unrecht vermisst. Nur macht er dieser Stelle den Namen Büchners für sein eigens kritisches Programm nicht mit mehr Recht dienstbar, als er es der Darmstädter Akademie anlastet. Vor wenigen Jahren geisterte eine Debatte über „Gnostiker“ vs. „Emphatiker“ unter Autoren und Kritikern. Nicht ganz ohne Parteinahme schrieb damals Hubert Winkels: „Die Emphatiker des Literaturbetriebs, die Leidenschaftssimulanten und Lebensbeschwörer ertragen es nicht länger, dass immer noch einige darauf bestehen, dass Literatur zuallererst das sprachliche Kunstwerk meint […].“[1] Die Gnostiker hingegen bezögen ihren „Lustgewinn“ gerade aus „der Erkenntnis dieser Prinzipien“.
Nun sitzt der damals zum kritischen Oberemphatiker ausgerufene Volker Weidermann an einflussreicher Stelle in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und schreibt dort bisweilen so staatstragend, dass man diese alte Debatte leicht vergessen könnte, wenn da nicht Georg Diez immer wieder eine Literatur einklagte, die es schafft, „die Welt zu fassen zu kriegen, sie aufzubrechen mit der Sprache“. Damit meint er eine Literatur, die mit literarischen Mitteln sich dem Wirklichen nähert, die nicht mehr Reportage ist oder Biografie, aber noch längst nicht Roman (geschweige denn, horribile dictu, ein „bürgerlicher“), die aber vor allem den Anschein erweckt, als seien ihr solche Unterscheidungen – mithin jene von Fakt und Fiktion – reichlich schnuppe.
Der „Sicherheit der Sprachspiele“ überdrüssig, wünscht sich Diez (diesmal mit David Shields’ copy/paste-Manifest „Reality Hunger“) „ein[en] Akt der Befreiung“. „Der Siegeszug des Romans hat zweifellos etwas Totalitäres“, wird der Romancier Jochen Schimmang zitiert. Zwar wäre es mir lieber, solche Begriffe würden nicht ganz so unpassend gebraucht, aber wenn sie schon im Raum stehen: In der Tendenz „totalitär“ ist, auf die Gefahr hin, banal zu klingen, freilich auch das Gegenteil, die Dichterschelte, die wohl schon Plato nicht erst erfinden musste. Auf jeden Fall hat Diez in den „öde[n] Schlachten […] wie die um den Realismus“, derer Müde zu sein er heuer behauptet, zuletzt wacker mitgekämpft.
Um noch einmal kurz zu Diezens Charakteristik Lewitscharoffs zurückzukehren: „Gottesanbeterin“ und „Kunsthandwerk“ kann ich als Leser nachvollziehen; „Reaktionärin“ – unvermittelt wird es politisch! – kann ich nicht ohne weiteres beurteilen, überraschte mich wenig, bedürfte aber des Belegs; doch „Gegenwartslegasthenikerin“? Wer auf dem hohen Ross der politischen Korrektheit zu sitzen beansprucht, sollte Behinderungen nicht als Schimpfwörter gebrauchen. Nicht minder befremdlich ist die in diesem Zusammenhang vollkommen unangebrachte Suggestion, Frau Lewitscharoff (eben als Frau) könne man keine Kinder anvertrauen, als ob sie sich schon durch einen unterstellten Mangel an mütterlicher Fürsorglichkeit ins moralische Off manövrierte. Das hätte die Autorin auch dann nicht verdient, wenn sie wirklich so bildungsbürgerlich borniert, voll Dünkel und Abscheu gegen die arbeitenden und arbeitslosen Klassen und tendenziell antimodern eingestellt sein sollte, wie es andere von Diez vorgebrachte Zitate nahelegen.
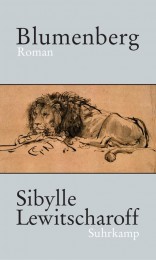 Georg Diez kritisiert Sibylle Lewitscharoff gleichsam mit der abgesägten Schrotflinte: Auf kurze Distanz fatal, aber mit erheblichen Streuverlusten. Gewiss müssen Kritiker sich nicht für allezeit aufs Florett verpflichten, und die Sitten der Zunft sollen hier nicht im Vordergrund stehen. Was jenseits der persönlichen Angriffe an Diezens Polemik irritiert ist, dass die Polemik gegen Lewitscharoff sich einfügt in eine Kampagne, die Diez gegen breite Strömungen der Gegenwartsliteratur betreibt. Gegner ist dabei der Roman des bürgerlichen Realismus (wird der Begriff überhaupt noch gebraucht, seitdem die Werke Georg Lukács’ aus der Mode gekommen sind?) ebenso wie die sich als avantgardistisch begreifende Literatur: Jede Art von Literatur, die sich als Auslotung der Möglichkeiten von Sprache und Einbildungskraft versteht und sich dabei mehr oder weniger explizit gegen eine politische oder gesellschaftliche Indienstnahme verwehrt – oder diese eben durch ihre Vielschichtigkeit gar nicht zulässt.
Georg Diez kritisiert Sibylle Lewitscharoff gleichsam mit der abgesägten Schrotflinte: Auf kurze Distanz fatal, aber mit erheblichen Streuverlusten. Gewiss müssen Kritiker sich nicht für allezeit aufs Florett verpflichten, und die Sitten der Zunft sollen hier nicht im Vordergrund stehen. Was jenseits der persönlichen Angriffe an Diezens Polemik irritiert ist, dass die Polemik gegen Lewitscharoff sich einfügt in eine Kampagne, die Diez gegen breite Strömungen der Gegenwartsliteratur betreibt. Gegner ist dabei der Roman des bürgerlichen Realismus (wird der Begriff überhaupt noch gebraucht, seitdem die Werke Georg Lukács’ aus der Mode gekommen sind?) ebenso wie die sich als avantgardistisch begreifende Literatur: Jede Art von Literatur, die sich als Auslotung der Möglichkeiten von Sprache und Einbildungskraft versteht und sich dabei mehr oder weniger explizit gegen eine politische oder gesellschaftliche Indienstnahme verwehrt – oder diese eben durch ihre Vielschichtigkeit gar nicht zulässt.
Wiederum Diez, vor einigen Monaten: „[…] dabei können wir gerade in diesen Zeiten, die so kompliziert und auf der Kippe zu sein scheinen, den Schriftsteller als Gefährten brauchen. Es braucht dafür gar nicht den großen Krisenroman. Um Gottes willen. Die Reportagen von Michael Lewis über das krisenbefallene Europa reichen schon aus. Es braucht keinen Schriftsteller, der da den Leser noch mit Handlung, Psychologie oder einer Liebesgeschichte belästigt.“
Nichts gegen die Reportagen von Michael Lewis, die gewiss zu den besten ihrer Art gehören.[2] Aber würde Diez nicht wenigstens John Lanchesters „Kapital“ als dazu komplementär gelten lassen? Und warum sollen zu meinem Gegenwartsverständnis nicht auch groß angelegte „bürgerliche“ Romane wir jene von Jonathan Franzen beitragen, oder psychologische Mikroanalysen wie Teju Coles „Open City“? Soll mir die Welt, die sich in den Gedanken von dessen Protagonisten widerspiegelt, etwa nichts mit meiner zu tun haben, und die Figur des Julius nicht imstande sein, mir diese begreiflicher zu machen? Kann mir ein Roman von Zadie Smith[3] wenn schon nicht mehr, dann doch etwas ebenso wissenswertes über mir nicht zugängliche Erfahrungen vermitteln, als es ein Essay könnte? Soll mir die Freude an der Sprache, so ich sie denn zu empfinden vermag, nicht Grund genug sein, die Romane Peter Careys zu lesen? Vielleicht meint es Diez ja anders. Ich weiß es nicht. Und dass mir nun auf Anhieb keine deutschsprachigen Gegenbeispiele einfallen wollen, könnte vielleicht wirklich auf einen ärgeren Missstand hinweisen, als es meine relative Unkenntnis der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist.
Zu urteilen, ob ein Literaturkritiker sich an einem antiliterarischen Affekt abarbeitet, steht mir nicht zu. Doch es scheint mir, als inszeniere sich Georg Diez als Kämpfer auf verlorenem Posten um eine Literatur, die sich dem Hier und Jetzt nicht verweigert, sondern auf die Straßen geht, auf Sportplätze, in Flüchtlingslager und überall dorthin, wo es lärmt und stinkt, wo Blut, Schweiß, Tränen und andere Säfte fließen, wo Leidenschaften und Freiheitskämpfe ausgetragen werden und es, kurzum, nach „Wirklichkeit“ aussieht. Ob ihm dabei das romantische Pathos dieser Haltung auffällt, er um ihre lange literarische Tradition weiß, verrät er nicht. Dafür lässt Diez auch andere Kritiker wissen, was er von ihnen verlangt: nämlich Entschiedenheit, Schneid und markige Worte. Richard Kämmerlings, früher FAZ, heute Welt, „sei ein Hü-Hott-Autor, ein klassischer Einerseits-Andererseits-Kritiker“, kanzelt er den Kollegen ab, der sich gar zu versöhnlich gezeigt habe. Für Walter Benjamins Diktum, der Kritiker habe ein „Stratege im Literaturkampf“ zu sein, hat Diez eine konkrete Umsetzung gefunden. Sein Kampf richtet sich gegen den Roman, der eine falsche Geschlossenheit der Welt vorgaukele, und trifft doch auch jene Autoren und jene literarischen Verfahren, die diese Illusion innerhalb der Form des Romans problematisieren.
Auch will ich die Literaturhausliteratur, das ganze hochgelobte und Monate später wieder vergessene Kunstgewerbe, die Stadtschreiberprosa, gegen die Diez anschreibt, nicht anhand einzelner Autoren verteidigen. Gerne will ich zugestehen, dass Liebe zur Literatur und der Glaube an ihre Fähigkeit, den Einzelnen zu erschüttern und (von mir aus auch) die Welt zu verändern, einhergehen können, vielleicht auch müssen, mit einem Furor gegen die mittelmäßigen Erzeugnisse, die Saison um Saison auf den Markt geworfen werden. Gewiss ist es nicht im Sinne eines Georg Büchner, wenn in seinem Namen ein Literaturpreis als goldene Ehrennadel für langjährige Betriebszugehörigkeit vergeben wird. Und doch: Verteidigen will ich die Sibylle Lewitscharoffs und, wenn es denn sein muss, auch noch die Martin Mosebachs dieser Welt gegen die Forderung, sie sollten sich von einer Idee der Literatur als selbstgenügsamer Sprachkunst lossagen. Die Freiheit, deren Werke nicht zu lesen, muss ich gar nicht erst für mich reklamieren. Doch zu behaupten, dass die Literatur sich nur durch Abschied vom Kunstwillen retten könne, ist nichts als eine denkmalstürzerische Geste aus Widerwillen gegen den Geist, die (so zeigt es jedenfalls die Literaturgeschichte) noch mehr hochgradig vergeistigte Literatur hervorbringt. Wenn ich mit dieser Einstellung unter die „Einerseits-Andererseits-Kritiker“ gehen muss, hoffe ich wenigstens auf gute Gesellschaft.
Joe Paul Kroll
[1] Ich vermute, dass Diezens Zorn auf Christian Kracht zwar den Roman „Imperium“ und seine angeblich „rechten“ Inhalte zum Anlass nahm, aber in der enttäuschten Liebe eines Emphatikers für einen vermeintlich Gleichgesinnten wurzelt.
[2] Conflict of interest: Der Verfasser arbeitet bei Michael Lewis’ deutschem Verlag.
[3] Zadie Smith hat ihrerseits eine Debatte angezettelt, in der Realismus und Avantgarde gegeneinander ausgespielt werden und damit ihren jüngsten Roman, „NW 3“, theoretisch vorbereitet. Aber das ist eine andere Geschichte.











