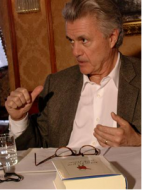 „Ich glaube nicht an Zufälle!“
„Ich glaube nicht an Zufälle!“
Man muss sich John Irving als einen glücklichen Menschen vorstellen. Entspannt und aufgeräumt sitzt er im Salon des Wiener Edel-Hotels „Imperial“, um über seinen neuesten Roman „Bis ich dich finde“ zu sprechen. Der Schriftsteller John Irving im Gespräch mit Petra Vesper.
Kein Wunder: Die Stadt an der Donau liegt dem US-Autor zu Füßen. Gerade sind anlässlich der Aktion „Eine Stadt, ein Buch“ 100.000 Exemplare seines Erstlings „Lasst die Bären los“ gratis verteilt worden. Die Freiexemplare seines Debüts, das in weiten Teilen in Wien spielt, waren innerhalb von nur zwei Tagen restlos vergriffen. Seine Lesung im mehr als 1100 Plätze fassenden Burgtheater ist – ebenso wie die darauf folgenden Veranstaltungen seiner Europa-Tour in Berlin, Hamburg und Zürich – restlos ausverkauft. Der Gala-Empfang des Wiener Bürgermeisters zu seinen Ehren im Rathaus ist – obwohl mitten in der glamourösen Ballsaison – ein gesellschaftliches Ereignis. Viel Ehre für einen Mann, der in seiner Heimat gerne mal als Nestbeschmutzer gilt, da er sich nicht scheut, in seinen Romanen auch brisante politische Themen aufzugreifen. Nach der Auseinandersetzung mit dem Vietnam-Krieg in „Owen Meany“ und seiner Haltung zum Thema Abtreibung in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ ist es diesmal vor allem die „sexual explicitness“, die Irvings nunmehr elftem Roman vorgeworfen wird – vor allem in seiner Heimat. „Ich bin mir des Puritanismus und der sexuellen Verklemmtheit eines großen Teils der amerikanischen Leser- und Kritikerschaft durchaus bewusst, doch ich habe mir nicht explizit vorgenommen, das amerikanische Publikum zu schockieren“, betont John Irving. „Obwohl ich – glaube ich – ein Talent dazu habe, genau jene Menschen zu provozieren, die mich ebenfalls provozieren. Warum wohl kommt das Wort „Penis“ so häufig in meinem Roman vor? In Europa regt das niemanden großartig auf, in Amerika – und in einem geringeren Maße auch in England – dagegen schon. Ich gebe zu: So zwei, drei zusätzliche Penisse sind in meinem Roman vor allem deshalb drin, weil ich das amerikanische Publikum im Hinterkopf hatte. Als europäischer Autor, der für ein europäisches Publikum schreibt, hätte ich darauf bestimmt verzichtet.“
Dabei feiert der passionierte Ringer John Irving gerade in Europa seine größten Erfolge als Autor: „Die USA waren stets mein schlechtestes Publikum. Weniger als ein Prozent der Erwachsenen dort lesen überhaupt gebundene Bücher, davon 70 bis 80 Prozent lediglich Sachbücher. Ein Schriftsteller ist in der amerikanischen Kultur absolut unbedeutend.“ Was zunächst einmal recht desillusioniert klingt, hat für den eher zurück gezogen lebenden Autor durchaus Vorteile: „Ich lebe gerne in Amerika, wirklich. Denn dort weiß praktisch niemand, wer ich bin. Selbst die meisten meiner Freunde – Leute, die zu uns zum Abendessen kommen – haben meine Bücher nie gelesen.“ Während er bei seiner Europa-Lesetour in jeder Stadt auf der Straße erkannt und angesprochen werde, könne er in New York wahrscheinlich für den Rest seines Lebens quer durch die Stadt laufen, ohne dass ihn jemand erkenne, lacht Irving. „Na ja, vielleicht, wenn ich mich direkt vor eine Buchhandlung stellen würde. Dann käme wahrscheinlich irgendwann jemand heraus, um mir zu sagen, dass ich wie eine ältere Ausgabe des Schriftstellers John Irving aussähe.“ Daher gebe es praktisch kein anderes Land, betont er, in dem er sich so sehr als Ausländer fühle, wie in den USA. Zum ersten Mal habe er in Wien erlebt, was es heißt, ein Außenseiter zu sein. 1963 kam er als Student für ein Auslandssemester in die österreichische Hauptstadt. „Schon damals wusste ich, dass ich Schriftsteller werden wollte. Ein befreundeter älterer Schriftstellerkollege hatte mir geraten, dorthin zu gehen, wo ich mich als Ausländer fühlen würde. Er war der Überzeugung, dass es dieses Gefühl sei, das mich als Schriftsteller immer begleiten werde.“
Aus seiner tiefen Verbundenheit zu Europa macht der bekennende Dickens-Adept Irving kein Hehl. „Ich reise mehrmals im Jahr nach Europa, fühle mich der europäischen Kultur- und Literaturtradition viel stärker verbunden als der amerikanischen.“ So ist es auch keinesfalls Zufall oder aber das Resultat seiner Recherchen in der Welt der Tätowierer und Kirchenorganisten, dass Irvings jüngster Roman über weite Strecken in Nord-Europa spielt – in Amsterdam, Hamburg, Helsinki, Oslo oder Stockholm – sondern auch ein Ausdruck seiner Verbundenheit mit seinem Publikum: „Hier habe ich die meisten Leser.“Diese nordeuropäischen Hafenstädte sind es, die der vierjährige Jack Burns – Hauptfigur in „Bis ich dich finde“ – an der Hand seiner Mutter abklappert, immer auf der Suche nach seinem Vater, der sich vor seiner Geburt abgesetzt hat. Und hierhin kehrt er auch als erfolgreicher Hollywood-Schauspieler zurück, immer noch auf der Suche nach seinem Vater. Indem er die Reise seiner Kindheit wiederholt, versucht er, die Wahrheit über seine Familiengeschichte ans Licht zu bringen.
Freimütig hat John Irving schon im Vorfeld bekannt, wie eng Roman und eigene Biographie im Falle von „Until I find you“ – so der englische Originaltitel – zusammen fallen. Ist die Frage nach dem autobiographischen Gehalt eines Romans ansonsten häufig eine der gleichermaßen beliebtesten wie gefürchtetsten Leserfragen an einen Autor, hat John Irving diesmal schon von sich aus alle Zweifel ausgeräumt: Ja, auch er habe lange Jahre nichts über seinen leiblichen Vater gewusst; das Thema wurde in der Familie totgeschwiegen. Und ja: auch er sei – wie seine Hauptfigur Jack Burns – im Kindesalter von einer weitaus älteren Frau sexuell missbraucht worden und habe sich in der Folge jahrelang zu älteren Frauen hingezogen gefühlt. Der Name seiner Hauptfigur Jack Burns klingt nicht zufällig ähnlich wie sein Taufname John Blunt. Den Nachnamen „Irving“ erhielt er von seinem Stiefvater, der ihn im Alter von sechs Jahren adoptierte.
Selten zuvor hat sich John Irving so nah an seine Vita heran geschrieben. Ist „Bis ich dich finde“ also eine verkappte Autobiographie? Wo bleibt die Distanz des Autors zu seinem Roman? „Distanz ist ein Trick, den man beim Schreiben anwendet“, erläutert Irving. „So sehr Details aus Jacks Kindheit und Jugend auf Fakten meiner eigenen Vergangenheit beruhen, so unterschiedlich sind doch die Personen, die ich erfunden habe. So ähnelt die Figur der Mrs. Machado in meinem Roman in keiner Weise der Frau, die mich – im Alter von 11 Jahren – sexuell missbraucht hat. Sie war eine Frau in den Zwanzigern, eine enge Vertraute der Familie. Die Figur der Mrs. Machado habe ich eher anderen Frauen entlehnt: Frauen, die ich mal in einem Fitness-Studio getroffen habe, nicht aber Frauen, mit denen ich Sex hatte. Das ist einer dieser Tricks, mit denen man als Autor arbeitet, um Distanz zu erzeugen: Man erfindet Figuren, die so gegensätzlich wie möglich zu den realen Personen in der Erinnerung sind. Aus den emotionalen oder psychologischen Effekten aber, die diese Erfahrungen aus der Vergangenheit produzierten, schöpft man sein Material – im positiven Sinne. Die äußeren Details hingegen erfindet man. Was die Details angeht, vertraue ich der Erinnerung sowieso nicht.“
 Trotzdem rang der Erzähler bei seinem elften Roman härter um Worte, als es bei den vorhergehenden der Fall war. „Fakt ist, dass ich sicherlich nicht nur deshalb sieben Jahre lang an diesem Roman geschrieben habe, weil er so lang geraten ist. Dabei war die Recherche in diesem Fall eigentlich ziemlich einfach – schon allein deshalb, weil ich von vornherein etwa über Musik viel mehr wusste als zum Beispiel über Handchirurgie [für „Die vierte Hand“]. Und die Recherche in der Tätowierer-Szene hat ganz einfach mehr Spaß gemacht als unter Medizinern [für „Zirkuskind]. Ich fühle mich in Arztpraxen eher unwohl und habe in meinem Leben schon mehr Babys zur Welt kommen sehen, als ich jemals wollte [für „Gottes Werk und Teufels Beitrag“].
Trotzdem rang der Erzähler bei seinem elften Roman härter um Worte, als es bei den vorhergehenden der Fall war. „Fakt ist, dass ich sicherlich nicht nur deshalb sieben Jahre lang an diesem Roman geschrieben habe, weil er so lang geraten ist. Dabei war die Recherche in diesem Fall eigentlich ziemlich einfach – schon allein deshalb, weil ich von vornherein etwa über Musik viel mehr wusste als zum Beispiel über Handchirurgie [für „Die vierte Hand“]. Und die Recherche in der Tätowierer-Szene hat ganz einfach mehr Spaß gemacht als unter Medizinern [für „Zirkuskind]. Ich fühle mich in Arztpraxen eher unwohl und habe in meinem Leben schon mehr Babys zur Welt kommen sehen, als ich jemals wollte [für „Gottes Werk und Teufels Beitrag“].
“Der eigentliche Kampf war das Schreiben selbst: „Ich habe mir niemals zuvor soviel Zeit beim Schreiben gelassen, habe niemals zuvor so viel Zeit mit dem Überarbeiten verbracht wie diesmal – ganz zu schweigen davon, dass ich den Roman kurz vor Drucklegung noch einmal von der ersten Person in die dritte Person umgeschrieben habe. Ich habe noch nie sieben Jahre an einem Roman gearbeitet – fünf waren das Maximum. Und ich habe niemals zuvor so häufig und so bereitwillig die Arbeit an einem Roman unterbrochen, um etwas anderes zu schreiben wie diesmal“, bekennt Irving. „Die Pausen dauerten teilweise sechs, acht Monate – einmal sogar eineinhalb Jahre. Jedes Mal, wenn ich nach einer solchen Pause zu „Bis ich dich finde“ zurückgekehrt bin, habe ich in dem Manuskript etwas entdeckt, das geändert werden musste.“ Und: „Wenn die Nähe zu groß und das Schreiben zu schmerzhaft wurde, musste ich einfach einen Weg finden, um mir Abstand zu verschaffen.“
Distanz wurde für Irving auch zu einer technischen Herausforderung: „In der ersten Person war die Stimme des Romans viel lauter“, erinnert er sich an die erste Fassung. „Aber auch viel emotionaler. Von dem Moment an aber, wo ich meine Figur „Jack Burns“ genannt habe, wo ich „er“ anstelle von „ich“ geschrieben habe, war plötzlich jene Distanz da, die ich brauchte und die auch für den Roman nötig war.“ So ganz nebenbei war der Roman – ohnehin schon mit 1100 Druckseiten der umfangreichste Irvings – in der ersten Person noch einmal gut 250 Seiten länger…
„Das Geschichtenerzählen ist für mich kein intellektueller Prozess, sondern ein emotionaler. Der Grund, warum ich immer das Ende kennen muss, bevor ich anfange zu schreiben, ist, dass ich immer die Stimmung des Romans kennen muss, wissen muss, ob es auf ein gutes oder ein schlechtes Ende hinaus läuft. Bei allem Grotesken, bei allem Traurigen und bei aller sexuellen Perversion in „Bis ich dich finde“, wusste ich doch immer, dass am Ende das Wiedersehen Jacks mit seinem Vater steht: ein Happy End. Am Ende dieser Geschichte lernt Jack Burns die zwei normalsten Menschen seines bisherigen Lebens kennen. Sein Vater – obwohl er in einer Heilanstalt lebt – ist der erste Mensch, der von Jack Burns nicht mehr verlangt, als ein guter Sohn zu sein. Bis dato hatte sich Jack am wohlsten gefühlt, wenn er jemand anderes war. Er wollte so sehr jemand anderes sein, dass er seine größten Erfolge als Schauspieler mit Frauenrollen hatte.“ Natürlich, so gibt Irving zu, hätte er seine Hauptfigur Jack Burns auch zu einem Schriftsteller anstatt zu einem Filmschauspieler machen können. „Aber auch das war eine Methode, um Distanz zu gewinnen. Und außerdem hätte ich mich dann selbst um alle Seitenhiebe auf die Hollywood-Filmindustrie gebracht. Und gerade daran hatte ich sehr viel Spaß…“
Der Romancier Irving sieht sich selbst weniger als Literat denn als Handwerker. Akribisch arbeitet er an seinen Büchern, feilt an jedem Satz. Die Rohfassung schreibt er ganz altmodisch per Hand, danach beginnt die eigentliche Arbeit: wieder und wieder überarbeitet er jedes einzelne Kapitel. „Wenn ich sieben Jahre für diesen Roman gebraucht habe, dann habe allein fünf Jahre mit dem Überarbeiten verbracht.“ Auch das ist für Irving – so paradox es sich anhört – eine Methode, um Distanz zu seinem sehr persönlichen Ausgangsmaterial zu gewinnen: „Wenn man das erste Mal über etwas schreibt – und es ist persönlich – dann fühlt es sich auch persönlich an. Doch je häufiger man daran arbeitet, desto größer wird die Distanz. Jedes Mal, wenn man den Text wieder überarbeitet, ist man ein anderer Mensch, man entfernt sich immer weiter davon.“ Deshalb, so ist Irving überzeugt, gebe es einen großen Unterschied zwischen dem Beginn und dem Ende der Arbeit an einem Roman – das Schreiben hat für ihn eine gleichsam kathartische Wirkung: „Wenn man zum ersten Mal über etwas schreibt, dann kann das schmerzhaft sein, oder auch nicht. Man kann 12 Seiten an einem Tag schaffen oder sich zwei Tage lang mit einer Seite abmühen. Aber wenn man es erst einmal alles aufs Papier gebracht hat, dann fühlt man sich befreit. Und je häufiger und länger ich an einem Roman arbeite, desto mehr lasse ich los.“ Den Prozess des Überarbeitens vergleicht Irving, der für sein Drehbuch zu „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, mit der Entstehung eines Films im Schneideraum: „Irgendwann denke ich nur noch an den Leser: Wie das, was ich schreibe, den bestmöglichen Effekt für ihn hat. Daran, wie der Leser eine Szene sehen wird, ob ich etwas gut genug vor ihm versteckt habe oder ob es – im Gegenteil – zu offensichtlich ist.“
Über den langen Zeitraum des Schreibprozesses lebt Irving quasi mit seinen Figuren: „Wenn man selbst als Autor kein emotionales Verhältnis zu seinen Figuren aufbaut – wie kann man dann so vermessen sein, anzunehmen, dass es die Leser tun?“ In diesem Roman sei Emma, die Jugend-Freundin von Jack Burns, seine Lieblingsfigur. „Sie ist viel sympathischer als Jack. Ich habe mich selber erschrocken, als mir klar wurde, wie früh sie den Roman verlassen würde.“ In den letzten Jahren hat nicht nur der Autor die Nähe seiner Figuren ertragen, auch seine Familie – Ehefrau Janet und Sohn Everett – ist involviert: „Meine Familie wusste immer, an welcher Szene ich gerade schreibe – sie konnten es mir am Gesicht ablesen. Ich erinnere mich, wie eines Nachmittags Everett aus der Schule und in mein Arbeitszimmer kam. Er sah mich und meinte sofort: ‚Oh, oh, sieht aus, als wärst du schon wieder in Amsterdam.’ Ich glaube, als soziales Wesen funktioniere ich in meiner Familie nicht sonderlich gut, wenn ich schreibe.“
Über seine Arbeitsweise hat Irving schon häufig gesprochen – er überlässt nichts dem Zufall: Das Ende eines Romans steht zuerst, danach arbeitet er sich Schritt für Schritt zum Anfang vor. Zug um Zug entsteht so eine Art „Straßenkarte“ des Romans. Erst wenn diese fertig ist, macht er sich daran, das erste Kapitel zu schreiben. „Bis ich dich finde“ macht da keine Ausnahme – auch hier hatte Irving die letzten drei Kapitel des Romans, die in Edinburgh und Zürich spielen, fertig, bevor er sich an den Rest machte: „Die Architektur dieses Romans ist sehr präzise – vor allem, wenn man seine Länge bedenkt. Ich wusste von Anfang an, dass es ein Stück in fünf Akten werden würde und wie diese aussehen würden. Ich wusste, dass ich mit meiner Hauptfigur Jack als Kind beginnen würde, dass anschließend seine Erziehung – sowohl seine intellektuelle Bildung als auch seine sexuelle – folgen mussten, dass ich ihn anschließend als Teil der Filmindustrie Hollywoods etablieren würde, dass der Tod seiner Mutter und seiner Vertrauten Emma ihn zusammenbrechen lassen und seine psychologische Behandlung in Akt fünf beschleunigen würden und dass wir seine Psychologin, Dr. Garcia, erst im letzten Akt kennen lernen würden. In der ersten Person, so wie ich den Roman zunächst verfasst habe, weiß der Leser von Anfang an, dass die Hauptfigur Jack Burns die ganze Zeit zu seiner Psychologin spricht, auch wenn er sie erst im fünften Akt kennen lernt.“ Als er den Roman von der ersten in die dritte Person umgeschrieben habe, so Irving, habe das nicht zuletzt den Effekt gehabt, dass er so vor den Lesern verstecken konnte, dass seine Hauptfigur Jack Burns ein Mensch in psychologischer Behandlung ist.
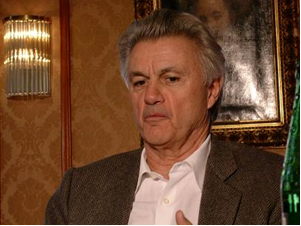 Der Roman, so Irving, sei jene literarische Form, mit der man den Zusammenhang von disparaten Ereignissen aufzeigen könne – jedenfalls dann, wenn man an die „altmodische“ Form des Romans mit einem starken Plot glaube. Im wirklichen Leben gebe es zu viele Zufälle und Ungereimtheiten – nicht aber in seinem Roman: „Was mit Jack Burns in Kapitel 38 passiert, geschieht, weil in den Kapiteln 1 bis 37 dieses und jenes geschieht.“ Das Neu-Arrangieren von Fakten, das Verdichten, Übersteigern, das Hinzuerfinden und Weglassen ist es, das für Irving den Reiz eines Romans ausmacht – im Gegensatz zu Memoiren, bei denen man sich an die reinen Fakten halten müsse: „Ich habe zwar schon autobiographische Bücher veröffentlicht, aber die waren beide sehr kurz. Mein Leben ist nicht spannend. Wichtig ist nicht, was ich erlebt habe, sondern was ich aus den wenigen Dingen mache, die mir passiert sind. Ich kann ein Ereignis aus meiner Vergangenheit nehmen – wie etwa den sexuellen Missbrauch: Die psychische Wirkung, den dieser auf Jack hat, ist meinen eigenen Erfahrungen nicht unähnlich, aber ich konnte sie viel zerstörender, viel lang anhaltender und viel tiefgreifender gestalten, als sie tatsächlich war. Diese Freiheit habe ich in einem Roman: Ich kann Dinge erfinden.“ Details, vor allem visuelle Details, spielen für den Romancier Irving eine wichtige Rolle. Sie zusammenzusetzen zur architektonischen Struktur eines Romans, darin liegt für ihn der Reiz des Schreibens.
Der Roman, so Irving, sei jene literarische Form, mit der man den Zusammenhang von disparaten Ereignissen aufzeigen könne – jedenfalls dann, wenn man an die „altmodische“ Form des Romans mit einem starken Plot glaube. Im wirklichen Leben gebe es zu viele Zufälle und Ungereimtheiten – nicht aber in seinem Roman: „Was mit Jack Burns in Kapitel 38 passiert, geschieht, weil in den Kapiteln 1 bis 37 dieses und jenes geschieht.“ Das Neu-Arrangieren von Fakten, das Verdichten, Übersteigern, das Hinzuerfinden und Weglassen ist es, das für Irving den Reiz eines Romans ausmacht – im Gegensatz zu Memoiren, bei denen man sich an die reinen Fakten halten müsse: „Ich habe zwar schon autobiographische Bücher veröffentlicht, aber die waren beide sehr kurz. Mein Leben ist nicht spannend. Wichtig ist nicht, was ich erlebt habe, sondern was ich aus den wenigen Dingen mache, die mir passiert sind. Ich kann ein Ereignis aus meiner Vergangenheit nehmen – wie etwa den sexuellen Missbrauch: Die psychische Wirkung, den dieser auf Jack hat, ist meinen eigenen Erfahrungen nicht unähnlich, aber ich konnte sie viel zerstörender, viel lang anhaltender und viel tiefgreifender gestalten, als sie tatsächlich war. Diese Freiheit habe ich in einem Roman: Ich kann Dinge erfinden.“ Details, vor allem visuelle Details, spielen für den Romancier Irving eine wichtige Rolle. Sie zusammenzusetzen zur architektonischen Struktur eines Romans, darin liegt für ihn der Reiz des Schreibens.
„Ich glaube nicht an Zufälle“, betont John Irving daher immer wieder. Und deshalb sei es für ihn auch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet während der Arbeit an diesem persönlichsten seiner Romane das passierte, worauf er sein Leben lang gehofft hat: Der Schleier des Familien-Geheimnisses um seinen Vater wurde gelüftet. Freilich anders, als Irving sich das erträumt hat. „Mein Leben lang wurde mein Vater in meiner Familie totgeschwiegen. Ich habe ganz einfach keine Antwort bekommen, wenn ich nach ihm gefragt habe. Irgendwann hatte ich gelernt, keine Fragen mehr zu stellen.“ Erst, als er selbst schon 36 Jahre alt war und sich gerade von seiner ersten Frau scheiden ließ, habe ihm seine Mutter kommentarlos einen Stapel Briefe, die sie einst von seinem Vater bekommen hatte, auf den Esstisch gelegt. „Da habe ich zum ersten Mal überhaupt erfahren, wer er war.“ Aus den Briefen ging hervor, dass sein Vater, obwohl er nicht mit der Mutter seines Kindes zusammenleben wollte, durchaus Kontakt zu seinem Sohn behalten wollte. „Meine Mutter hat ihm das nie erlaubt.“ Sein Leben lang, so Irving, habe er sich vorgestellt, dass sein Vater ihn insgeheim beobachte – ob als heimlicher Zuschauer an der Ringermatte oder später als Leser seiner Romane – und dass er sich ihm eines Tages offenbaren würde. „Ich habe sogar Hinweise für ihn in meinen Romanen versteckt; in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ zum Beispiel aus seinen Briefen zitiert. Ich habe immer versucht, ihn mit solchen Hinweisen hervorzulocken.“ Ähnlich, wie seine Romanfigur Jack Burns als Schauspieler sich ein Leben lang sein Ein-Mann-Publikum – seinen Vater nämlich – vorstellt, so schrieb auch Irving lange für „den einen Leser“. „Ich wusste, dass meine Mutter anscheinend sehr wütend auf ihn war, weil sie den Kontakt zu ihm unterbunden hat. Aber es ist mir ein Rätsel, warum mein Vater auch später, als ich schon erwachsen war und eine eigene Familie hatte, nicht den Kontakt zu mir gesucht hat. Wenn ich an der Stelle meines Vaters gewesen wäre, dann hätte ich versucht, mich zu finden. Ich wäre nicht weg geblieben.“
Das Happy End, das Jack Burns im Roman erlebt, war seinem geistigen Vater nicht vergönnt. „Eines Tages bekam ich einen Anruf von jemandem, der sich als Chris Blunt vorstellte und sagte, er sei mein Stiefbruder.“ Bei aller Beschäftigung mit seinem abwesenden Vater war es dem Geschichtenerfinder Irving bis dato nie in den Sinn gekommen, dass sein leiblicher Vater später noch einmal geheiratet und eine Familie gegründet haben könnte. „Mein Bruder Chris und ich haben zwei Stunden lang am Telefon geredet und ich merkte, dass er sich um den entscheidenden Satz herum drückte.“ Irving selber fragte dann danach: „Ich erfuhr, dass mein Vater zwei Jahre zuvor gestorben war.“ Doch nicht nur das: „Er starb als psychisch Kranker in einer Heilanstalt.“ So erschütternd die Nachricht für Irving auch war, passte sie doch in die Arbeit zu „Bis ich dich finde“: „Es war bizarr, aber ich wusste, dass ich mit dem, was ich in meiner Geschichte erfunden habe, irgendwie richtig gelegen hatte.“
Von seinem Bruder und von seinen anderen Halb-Geschwistern – einem weiteren Bruder und einer Schwester –, die Irving nach und nach kennen lernte, habe er erfahren, dass sein Vater ein „netter Kerl und ein guter Vater“ gewesen sei – wenn auch am Ende seines Lebens psychisch krank. „Wenn man die vier Frauen, die er im Laufe seines Lebens geheiratet hat, fragen würde, sieht die Antwort bestimmt anders aus.“ Eine der wichtigsten Erkenntnisse für John Irving: „Mein Vater war nicht das Monster, zu dem ich ihn all die Jahre gemacht hatte.“ Anders als in seinem Roman, in dem Jacks Mutter Alice den abwesenden Vater über Jahre hinweg dämonisiert und ihn zu einem Monster aufbaut, habe seine eigene Mutter nie ein negatives Wort über seinen Vater verloren, erzählt Irving: „Den Zorn, der sich durch Alices Leben zieht, hat meine Mutter nie an den Tag gelegt. Es gab in meinem Leben niemanden wie Alice, der bewusst die Fakten verändert hat. Sie hat ganz einfach nie über ihn gesprochen. Ich selber habe ihn als Kind dämonisiert – ich dachte immer, er müsse ein ganz schrecklicher Mensch sein, wenn keiner der Erwachsenen über ihn reden will. Ich dachte, sie alle wollten mich nur beschützen. Alle meine negativen Eigenschaften habe ich ihm zugeschrieben.“ Das einzige, was Irving über seinen Vater wusste, war sein Name. „Und dass es ihn irgendwie geben musste: Wenn ich John Wallace Blunt jr. war, so musste es einen John Wallace Blunt geben.“ Umso glücklicher war er über die Adoption durch seinen Stiefvater: „Endlich trug ich den Namen von jemandem, den ich auch sehen konnte. Und ich mochte ihn sehr gern.“ Für den jungen John Irving wurde der Stiefvater allerdings keine Hilfe, wenn es darum ging, Informationen über den abwesenden Vater zu erhalten: „Er wusste genauso wenig wie ich, meine Mutter hat auch mit ihm nicht über ihren ersten Mann gesprochen.“ Immer noch ist der Vater ein Nicht-Thema zwischen dem inzwischen 64-jährigen John Irving und seiner Mutter. „Wir sehen uns drei, vier Mal im Jahr – und wir sprechen immer noch nicht über die Dinge, über die wir nie gesprochen haben.“ Nicht zuletzt trug aber die unbeugsame Haltung seiner Mutter zu seiner Entwicklung als Schriftsteller bei: „Wenn ich nicht selber schon genügend Phantasie gehabt hätte, um Schriftsteller zu werden, so war das, was meine Mutter getan hat, indem sie die Tür zu meinem Vater verschloss, das beste was sie tun konnte, um meine Phantasie anzukurbeln. Dadurch, dass sie mir nichts über meinen Vater erzählen wollte, musste ich ihn mir erfinden.“ Abwesende Elternteile und verwaiste Kinder und das Gefühl des Betrogenwerdens ziehen sich wie ein roter Faden durch das Werk John Irvings – doch bislang leugnete er stets einen autobiographischen Zusammenhang. Er musste erst so alt werden, um sich – und seinen Lesern – mit seinem elften Roman die Verletzungen seiner Kindheit einzugestehen. „Die Hinweise waren immer da – aber sie waren nie so offensichtlich wie diesmal.“
Viele Leute hätten ihn nach der Veröffentlichung von „Bis ich dich finde“ gefragt, ob die späte Entdeckung seines Vaters seinen Roman verändert habe. „Auf die Idee kann nur jemand kommen, der mich nicht gut kennt. Zu dem Zeitpunkt konnte sich das Buch nicht mehr ändern.“ Denn die Straßenkarte für „Bis ich dich finde“ war schon Jahre zuvor festgezurrt. Ob die Entdeckung der Wahrheit über seinen Vater und die Zusammenführung mit seinen Halb-Geschwistern aber einen Einfluss auf sein zukünftiges Werk hat? „Es ist nicht so, dass ich mir die Themen aussuche, über die ich schreibe – die Themen suchen sich mich aus. Ich habe dann ganz einfach keine Wahl.“ Und so wird sein nächstes Buch – man ahnt es fast – ein Roman über eine Vater-Sohn-Beziehung werden.
Petra Vesper
© Fotos: Frank Schorneck











