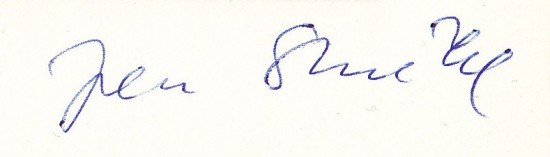Empfindsam und noch empfindsamer
Für den alten aberglauben und für so kluge ohren,
fürs radar der sommernächte unter den linden,
für die häßlichkeit des eigenen antlitzes
schlugen einst die menschen die fledermaus ans tor.
Mit dem stift durchdrangen sie die dünne haut der flügel,
die kleine leiche hing zerknittert in der stille,
und das schamvolle entsetzen, seidenglatt,
rauschte lange auf den kleinen fallschirmen der glocken.
Warum trag ich dieses marterbild in mir,
und warum prüfe ich, bevor in einem neuen haus ich
um nachtlager bitte, aufmerksam und lange
die pfosten an der haustür,
im holz nach nagellöchern suchend?
Ich bin nur ein dichter, ein radar unter den linden.
Nicht an mir ist’s zu antworten. Ich frage.
Übersetzung: Rainer Kunze
Um den 1922 in Znorovy (Mähren) geborenen und 1989 gestorbenen Jan Skàcel ist es in den letzten Jahren auffallend still geworden. Das war einmal anders. In den siebziger, achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fanden die Gedichte von Skàcel zwar kein großes, aber doch bemerkenswertes Echo in der literarisch interessierten Öffentlichkeit. Er galt als eine nicht laute, aber immer integre Stimme des kulturellen Widerstands gegen damalige kommunistische Regime der Tschechoslowakei. Viele Jahre lang wurden seine Gedichte nur heimlich, still und leise in seinem Heimatland vertrieben und gelesen.
Seine Gedichte – sehr gut übersetzt von Rainer Kunze und Felix Philipp Ingolf – waren auch beliebt bei Lesern, die ansonsten nur schwer einen Zugang finden zur modernen Lyrik. Im Ton und in den Inhalten siedelte man sie irgendwo zwischen Georg Trakl und Peter Huchel an. Seine Gedichte sind nicht so dunkel gefärbt wie bei Trakl und sie haben oft auch einen leisen ironischen Ton, der bei Huchel zum Beispiel vollkommen fehlt.
Sehr schön und treffend heißt es in der Laudatio von Peter Handke auf Skàcel anlässlich der Verleihung des „Pretraca-Preises“ im Jahre 1989: „Wie nur die Liebe, welche die Gedichte Jan Skácels auf mich Leser übertragen – vollkommen schweigsame und im Schweigen ganz ihre Genüge findende Augenblicke der Zuneigung über die Gedichte hinaus zu den Dingen der Welt – hinüberbringen ins Reden … ? Sachlich – nicht bleiben (denn sachlich bin ich nicht von vornherein), sondern werden; sich an die Sachen, die Wörtlichkeiten der einzelnen Gedichte, halten; und dann sachlich sagen – es zumindest versuchen, auch wenn dabei zugleich schon wieder eine Empfindung dazwischen spielt: die Empfindung beim Lesen von Jan Skácels Gedichten wie die von wärmendem Sommergras unter den bloßen Sohlen. So beruhigend, begütigend, erdend wirken die Gedichte…“
Wunderbar und „typisch Skàcel“ ist sein Loblied auf die mährische Hymne. „Ich singe sie sehr oft und mit Ehrfurcht. Die Hymne des lieblichen Landes Mähren…ist weder traurig noch fröhlich. Sie besteht aus absoluter Stille. Aus Respekt vor den Tschechen und Slowaken stehen wir auch auf bei feierlichen Anläsen. Dann schweigen wir aber und denken uns so manches.“ Man findet dieses stolze Lob der mährischen Hymne in dem Band „Das elfte weisse Pferd“, in dem kurze Glossen und Kommentare von Jan Skàcel zusammengestellt sind (Wieser Verlag, Klagenfurt, 1993). Anfang des Jahres 2012 wäre Jan Skàcel 90 Jahre alt geworden. In Deutschland hörte man aus diesem Anlass nur die Hymne des Landes Mähren – die absolute Stille.
Carl Wilhelm Macke
Die Abbildung wurde von dem Benutzer HTO bei Wikimedia Commons als gemeinfrei eingestellt.