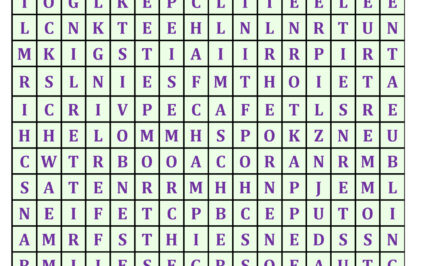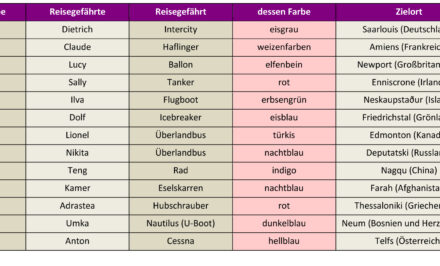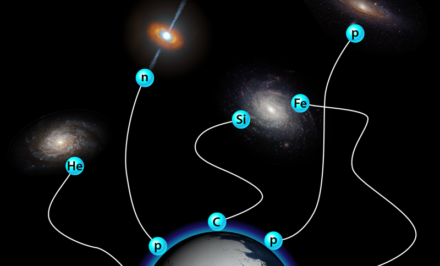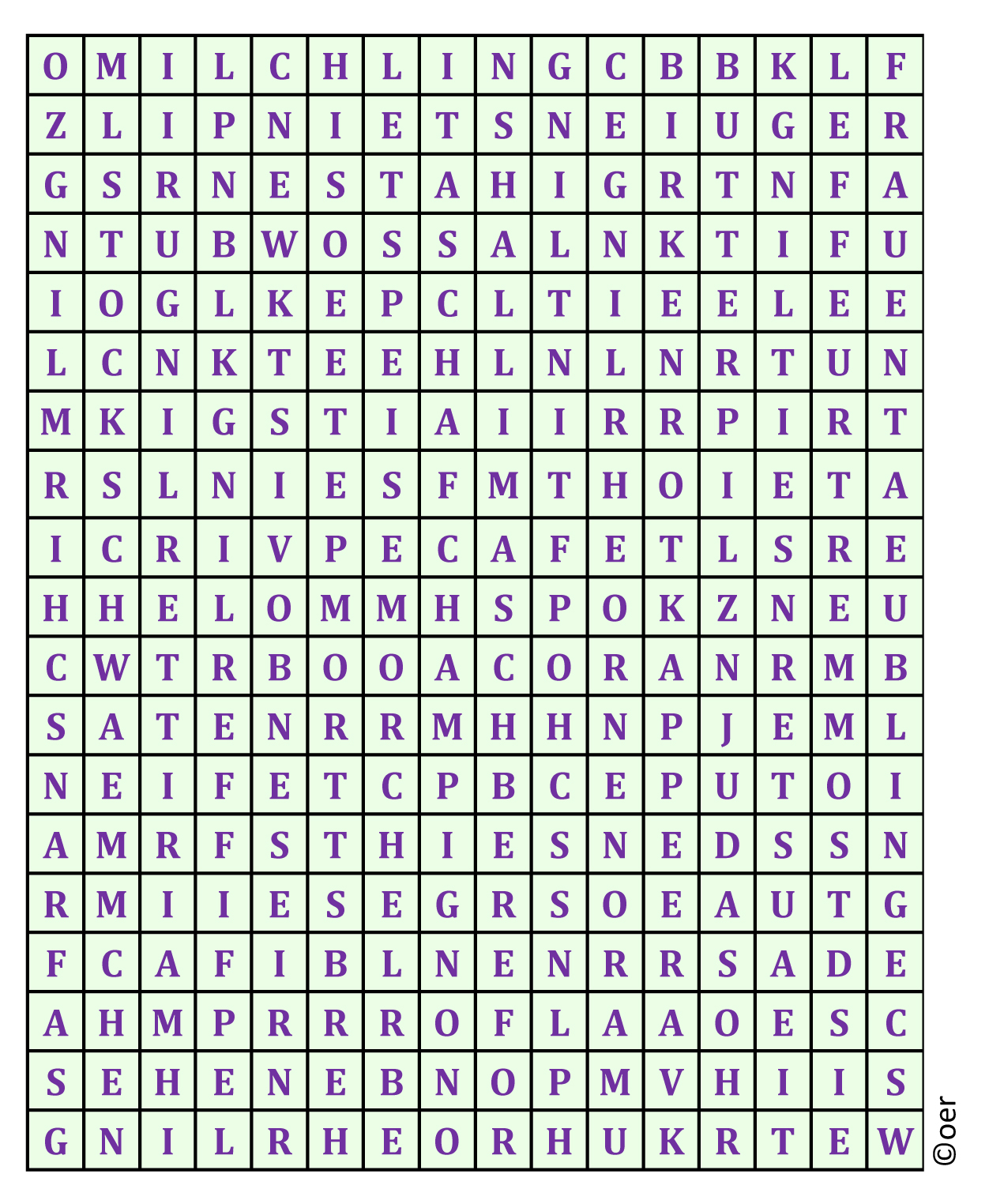Lobrede auf die ‚kleine Form‘
Wer schreibt, kennt sie genau und wer nicht schreibt, kennt sie auch. Jene ununterbrochen im Kopf herumschwirrenden Gedanken, die sich nicht zu einem Ganzen fügen wollen, aber trotzdem nicht das Feld der Phantasien und Ideen räumen.
Unentwegt gehen sie in unserem Kopf ein und aus, suchen eine Heimstatt in dem Gebäude unseres Denkens, finden sie, vielleicht auch nur für kurze Zeit, oder sie verlieren sich wieder irgendwo in den großen spinnwebenverhangenen Depots unseres Vergessens. Gedankenblitze, Augenblicke, Tagträume, gelegentlich auch Halluzinationen. Ein einziges Kommen und Gehen ist das zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein, zwischen Aufmerksamkeit und Gleichgültigkeit. Andere dieser kurzen Impressionen, kleinen Miniaturen und abgebrochenen Fragmente sind zu geistreich, zu wertvoll, um über sie einfach wieder das Gestrüpp unserer Alltagsgespräche wuchern zu lassen. Sie halten uns gefangen. Wir lassen sie Anker werfen in Notizheften, Tagebüchern oder auf Zetteln, damit wir ihre intellektuelle Fracht irgendwann einmal in einer Rede, einem Brief, einem literarischen Werk oder in einer theoretischen Abhandlung löschen können. „So gehen im Denken beiseite“, schrieb der unstillbare neugierige Spurensucher Ernst Bloch einmal, „und dem, was sich darin sehen läßt, selber ausgefallene Dinge auf, vergessene Zwischentöne, wichtige Nachrichten aus geringfügig scheinendem Abfall, Zwischenfall, auch Tapetentüren auf dies Nebenbei. Und noch eines gehört hierher: Schrägblick auf Abseitiges.“
1.
Eine der schönsten neueren Sammlungen dieser flüchtigen Notizen verdanken wir dem 1994 in Paris verstorbenen Peruaner Julio Ramon Ribeyro. Im deutschen Sprachraum gehörte Ribeyro zu den weniger beachteten zeitgenössischen lateinamerikanischen Schriftstellern, obwohl sein Werk sowohl im Umfang wie in der Qualität ein beachtliches Niveau aufwies. Es existieren Übersetzungen einiger seiner Prosawerke, die aber längst in den hinteren Regalen der Antiquariate verstauben. Auch das letzte, 1991 ins Deutsche übersetzte Buch von Ribeyro „Heimatlose Geschichten“, ist schon kurz nach dem Erscheinen in der Bücherflut unserer Zeit untergegangen. Dabei erweist sich Julio Ramon Ribeyro hier als ein bemerkenswerter Erbe jener mit den Namen Walter Benjamin und Franz Hessel, Alberto Savinio und Max Frisch verbundenen großen urbanen Flaneurtradition dieses Jahrhunderts. Mehr als zweihundert über einen längeren Zeitraum hinweg festgehaltener Skizzen hat Ribeyro in diesem Buch eine Heimat verschafft. „Als ich sie in diesem Band versammelte“, so schreibt er im Vorwort, „wollte ich sie vor der Vereinzelung retten, ihnen einen gemeinsamen Raum geben und ihnen dank der Nachbarschaft und der Zahl zur Existenz verhelfen“.
Immer wieder kommt Julio Ramon Ribeyro in diesen Aufzeichnungen auf Schlüsselthemen schriftstellerischer Existenz, des Lebens eines Lateinamerikaners in der Fremde Paris, auf die Frauen und die zögernde Annäherung an Alter und Tod zurück. „Das Zuspätgekommene, das Überflüssige, das ehedem Begehrte häuft sich um uns, ordnet sich zu dem, was man ein Haus nennen könnte, aber erst wenn wir schon dabei sind, von allem Abschied zu nehmen, denn dieses anhäufende Leben entsteht an der Schwelle unseres Todes“.Wenn es der Literatur heute immer schwerer fällt, die Totalität des Lebens zu erfassen, dann ist es vielleicht ihre Aufgabe, die vielen kleinen Lebenspartikel zu sammeln, zu sichten und zu einem „Muster im Teppich“ (Ribeyro) zu verweben. Mit seinen „Heimatlosen Geschichten“ lenkt Julio Ramon Ribeyro unseren Blick auf das kleine, scheinbar belanglose, schnell vergessene Detail im Alltag. Dem Augenblick, den Dingen, vor allem den flüchtig an unserer Aufmerksamkeit vorbeihetzenden Menschen, gibt er hier ihre Würde zurück. Wenn für einen „wachen Geist“, wie Valery einmal schrieb, die „kaum wahrnehmbaren und fortlaufenden Ereignisse besonders zählen“, dann war Julio Ramon Ribeyro gewiß einer jener rar gewordenen wachen Geister, an die in der Epoche des rasenden Stillstands zu erinnern sich lohnt. Zum Beispiel auch an Jan Skácel.
2.
Als der tschechische Schriftsteller Jan Skácel Ende 1989 starb, hoffte ein mit dessen Werk gut vertrauter Journalist und Landsmann, daß endlich alle Arbeiten von ihm auch ins Deutsche übersetzt werden. „So gut wie unbekannt“, schrieb damals Werner Paul in der Süddeutschen Zeitung, „sind hierzulande Skácels ‚kleine Rezensionen‘ der Erscheinungen des täglichen Lebens, die auf eine anmutige und zugleich tiefschürfende Art von seiner Poetik, Lebensanschauung und langjährigen journalistischen Erfahrung geprägt sind.“ In einer außergewöhnlich aufwendig gestalteten, handwerklich tadellos gemachten und dazu noch ausgesprochen handlichen Ausgabe erschien dann endlich 1993 unter dem Titel „Das elfte weiße Pferd“ eine Auswahl dieser ‚kleinen Rezensionen‘ von Jan Skácel in einer deutschen Übersetzung. Wie schon in seiner Lyrik lernen wir hier einen Dichter kennen, der staunend und neugierig wie ein Kind, gelassen und lebensweise wie ein alter Mann seinen Blick auf eine ihm immer fremder werdenden Welt wirft, in der „alles die reinste Brüsseler EXPO“ ist.
Gemessen an den gängigen Kriterien muß das Schreiben Skácels als ganz und gar unmodern angesehen werden. Ihm fehlt jedes Tempo, jeder schnelle Schnitt, jedes Experiment, jede Aggressivität und Oberflächlichkeit. Sein Werk ist ein sehr sorgfältig und liebevoll geschaffener Gedenkstein gegen die Gleichgültigkeit und für das Verlorene, für die unscheinbaren Menschen, auch für die widerständige Kauzigkeit in einer Zeit, in der Menschen wie Dinge immer austauschbarer werden. Den berstenden Spannungen und Konflikten der modernen Welt setzt Skácel aber nicht die Sehnsucht nach der heilen Idylle entgegen, sondern die tröstliche Kunst der Dichtung und eines fast immer nur schwach angedeuteten Schüttelns mit dem Kopf über die Selbstüberschätzung der Menschen. Großväter, die wir uns wünschten, müßten so wie Skácel über das oft so undurchschaubare Leben erzählen und schreiben können. Staunend über so viel Abfall, zornig über so viel Gleichgültigkeit, lächelnd über so viel Windbeuteleien. Sie würden uns vertraut machen mit der Welt, ohne uns sofort mit ihr zu versöhnen. Skácel leidet an der Gegenwart, so wie sie ist, aber jeder Ton des Jammerns oder der Verklärung vergangener Zeiten ist ihm fern. Dem Pathos der großen Worte widersetzt er sich mit der Verteidigung der kleinen Welten. Wie befreiend wirkt etwa in Zeiten wieder erwachender Nationalismen das Plädoyer von Skácel für die Stille als mährische Nationalhymne : „Diese Hymne hat keine Worte. Nichts wird in ihr behauptet, proklamiert, aufgezwungen. Sie ist weder traurig noch fröhlich. Sie besteht aus absoluter Stille.“
Über das Begräbnis eines Schmiedes lesen wir hier, über Spinngewebe, den Schnee im neuen Jahr und über die höflichen Bäume. In einer kleinen Randbemerkung erzählt uns Jan Skácel zum Beispiel, daß er einmal zusammen mit einem Dichterfreund längere Zeit sehr konzentriert einen Kanarienvogel beobachtet habe. „Ludvig und ich zerbrachen uns den Kopf darüber, ob der Kanari aus Freude oder aus Kummer singt. Das konnten wir aber nicht lösen. Es ist eine ungemein schwierige Frage“. Skácel erzählt uns über dies und das, nichts ist ihm zu unbedeutend, als daß man aus dem verlorensten Detail nicht noch einen Funken Interessantes, oft auch Lehrreiches herausschlagen könnte.
Diese Geschichten und leise belehrenden Schnurren lesend wird man ganz neidisch auf die Menschen, die das Glück hatten, die legendäre Brünner Literaturzeitschrift „Host do domu“ (Gast ins Haus) noch zu Lebzeiten von deren Herausgeber Jan Skácel zu lesen. Was Peter Handke in seiner Laudatio anläßlich der Petrarca-Preisverleihung an Jan Skácel wenige Monate vor dessen Tod über seine Gedichte sagte, gilt auch für seine leichten literarischen wie journalistischen Skizzen: „Ach, nur noch drei Gedichte bleiben mir zum Lesen, dachte ich Leser, und dann, oh, nur noch zwei!, und dann, ach, jetzt schon das letzte!“
3.
Das in seinem Umfang wesentlich größere und in seinem literaturgeschichtlichen Gewicht wohl auch ungleich bemerkenswertere Werk eines anderen Meisters der kleinen Form, erfordert ein längeres Verweilen. Die Zahl der „Prosastückli“ von Robert Walser ist unübersehbar. Sind es dreizehnhundert, vierzehnhundert..? Jahrelang haben Wissenschaftler an der Entzifferung von Notaten gearbeitet, die Robert Walser mit kleinsten Buchstaben auf Papier ziselierte. Was Walser der deutschen Sprache an Wortneuschöpfungen und skuril-genialen Denkspielereien hinterließ, ist noch längst nicht abgetragen: „Ich war die Beute gedankenreicher Gedankenabwesenheit“ oder „Von Italien hörte wohl noch niemand nie“. Oder „Der Einfluß, den Mitwelt und Zeitalter auf uns ausüben, kann ins Beklemmende gehen.“In jedem seiner oft nur kurzen Erzählskizzen stolpert man unentwegt über diese schrägen oder mehrfach geknoteten Gedankenkunststücke. „Schrullen, Schrullen muß man haben und den Mut muß man haben, mit seinen Schrullen zu leben. So lebt sichs nett. Es darf keiner Angst vor seinem bißchen Wunderlichkeit haben“. Walser-Leser erkennt man sofort. Nicht an der Haartolle oder ihrem Gang. An ihren Worten, an ihrem schrägen, umwegigen Blick auf die Welt ringsum. Sie staunen noch, wo anderen alles gleichgültig ist. Stücke von Robert Walser kann man immer und immer wieder lesen. Es besteht Suchtgefahr! Über ihn zu schreiben aber ist nicht leicht. Man gerät dabei immer wieder in die Strudel eines grenzenloses Mäanderns durch die üppig blühenden Irrgärten des Fabulierens. Es besteht Kopiergefahr! Und dieser Ton, dieses eigenartige schnelle Springen vom molto vivace zum Adagio, von der Nervösität zur Meditation, will aus dem Ohr nicht weichen. Diese schnellen Schnitte zwischen eben noch erhabener Bewunderung zu irritierter Verwunderung über Alltägliches, zwischen den gewagtesten modernen Satzkonstruktionen zu Passagen haarscharf am Butzenscheiben-Kitsch vorbei sind Sperrgut im Fluß des Lesens. Ein getriebener Langsamer und ein flirrend nervöser Romantiker ist dieser Schreibhandwerker aus Biel.
Konnte sich ein Walter Benjamin noch beklagen, daß es über Robert Walser nichts zu lesen sei, lautet die zeitgenössische Klage anders: wie ist die Sekundärliteratur zum Werk des Schweizer „Einfällehaber“ (Robert Walser) überhaupt noch zu bewältigen. Daneben erscheinen noch unablässig Bücher wie Texte vornehmlich von Schriftstellern und Literaturkritikern, in denen sie ihr Verhältnis zu Robert Walser veröffentlichen. Auffallend viele Liebeserklärungen finden sich hier für einen Autor, der seinerseits von dem Schwärmen und Lieben nicht lassen konnte. „Ich fühle, wie wenig mich das angeht, was man Welt nennt, und wie mir groß und hinreißend vorkommt, das, was ich Welt nennen, ganz im Stillen.“ Drei Jahrzehnte schrieb er wie ein Besessener. Dann folgten noch einmal fast drei Jahrzehnte, er denen er alles hinausschwieg, was in ihm schrie. Fast dreißig Jahre lang bis zu seinem tragischen Tod während einer Schneewanderung Weihnachten 1956 brachte er keine einzige Zeile mehr zu Papier. Als Patient in Schweizer Heil- und Pflegeanstalten verstummte Walser. Immer wollte Robert Walser ein Kleiner unter Kleinen sein. Daß er schließlich doch von Größen der deutschsprachigen Literatur in diesem Jahrhundert als ein Gleichgesinnter anerkannt worden ist, hätte ihn vielleicht sogar eher bedrückt denn gefreut. „Mich entsetzt der Gedanke, ich könnte Erfolg in der Welt haben“. Robert Walser würde obebn, in der Welt der Großen und Reichen nur Platzangst bekommen. Atmen, hat er einmal geschrieben, „atmen könne er nur in den unteren Regionen“.
4.
Alfred Polgar, einem anderen Großen der kleinen Form hingegen fiel das Atmen in den oberen Regionen keineswegs schwer. Er war Gentiluomo, der sich in den Kreisen der Feinen und des gut gebügelten Bürgertums zu bewegen wußte. Und wer ihn würdigt, sucht aus dem Sprachschatz auch stets nur die nobelsten Vokabeln. Siegfried Jacobsohn verglich in der Weltbühne seine Prosa mit Hennesssy Dreistern, „so brenne sie auf der Zunge“. Er sei, schrieb Jacobsohn ein anderes Mal, ein „Wohltäter der deutsch lesenden Menschheit“, eine „Verkörperung der Noblesse“. Anton Kuh nannte sein Werk „ein Mausoleum der Nuancen“. Für Arnold Zweig hatte er die „zarteste Federspitze“. Weniger emphatisch aber ebenso bewundernd lobte Walter Benjamin die „schöne Bescheidenheit dieses Autors“ und Joseph Roth bezeichnete ihn als „seinen Lehrer… in diesen jämmerlichen Tagen, in denen Barbaren und Stotterer die deutsche Sprache mißhandeln.“ Alfred Polgar, dem diese vielstimmige Hommage gilt, hat sich zu Lebzeiten immer gegen allzu aufdringlich empfundene Würdigungen gewehrt. Er sei ein Hommes de lettres ordinaire hat er einmal von sich gesagt und das waren auch schon die gewähltesten Worte, mit denen er sich selbst zu charakterisieren pflegte. Trotz dieses generösen Understatements und weil die „Barbaren der deutschen Sprache“ heute so unverschämt die öffentliche Sprachkultur bestimmen, reizen seine unendlich vielen scheinbar mühelos zu Papier gebrachten Prosastücke, Theaterrezensionen und Aphorismen immer noch zu bewundernden Würdigungen. Es ist der höfliche aber gleichwohl demokratische Tonfall seiner Prosa, seine Sensibilität, die in einem winzigen Alltagsdetail, einem „Sandkorn am Ufer der Geschehnisse“, das komplizierte soziale, politische und kulturelle Gefüge einer Gesellschaft entziffern kann, seine Sympathie und Hinwendung zu den „hilflosen, leidenden Geschöpfen“ (Ernst Fischer), die den Leser auch heute noch faszinieren. „Indem aller Leim, der die Welt zusammenhält, weich wird, alle Scharniere sich lockern, Neues und Altes durcheinanderstürzt, die Ordnungen wie die Waggons eines entgleisten Zuges sich spießen, sich ineinander verkeilen oder, gänzlich umgeworfen, ihren nackten, toten Mechanismus exhibieren, geht das Leben doch seinen Gang weiter. Die Anständigkeit der kleinen Leute bewirkt solches Wunder“, schrieb Polgar 1918 in einer Glosse für das „Prager Tagblatt“, die mit dem bezeichnenden Satz endete: „Ich will lieber die Büste meines Briefträgers auf den Schreibtisch stellen als die des großen Napoleons.“
An einem Sonntagmorgen fand man die obdachlose Strickerin Josephine Strasser erfroren. „Ein Ankleber von Wahlplakaten entdeckte das starre Lumpenhäufchen. Mitleidig deckte er es mit seinem größten Papier zu: „Wählt bürgerlich-demokratisch!“ So fein verstand Polgar seine Feder zu gebrauchen, um Mitleid für die Opfer und Hohn für die Täter zu entfachen.Das Feld der harten politischen Fehde, gar der Propaganda, war nie Polgars Platz, obwohl er, der Bürger par excellence, es an Solidarität mit den kleinen Leuten, mit den Arbeitern, mit der Sozialdemokratie nie mangeln ließ. „Im Grunde“, schrieb sein Biograph Ulrich Weinzierl, „blieb er bis zum Schluß, der er am Anfang seiner Karriere gewesen, ein leiser Anarchist‘, nie bereit Zwang, Ungerechtigkeit und Unterdrückung stillschweigend zu übergehen, stets renitent in der revolutionären Neigung, alles in Frage zu stellen: Staat und Politik, Würde und Ruhm, Gerechtigkeit und Geist, Literatur und Theater, große Gefühle und Leidenschaften, schließlich auch die eigene Person, nur eines nicht – das Recht des einzelnen auf größtmögliches Glück.“ Das Werk Alfred Polgars zeichnet eine nicht aufdringliche, bescheidene, aber doch deutlich vernehmbare Parteilichkeit für die unbekannten Opfer im Schatten der Geschichte, seine Verantwortung gegenüber dem Wort, seine, scheinbar paradoxe Verteidigung von aristokratischer Höflichkeit als einer demokratischen Tugend.
5.
So wie Polgar liebte es auch Alberto Savinio mit Krawatte und seidenem Einstecktuch vor der Schreibmaschine zu sitzen. Noblesse oblige auch dann, wenn – besonders bei Savinio – mit bitterstem Spott über die Dekadenz des „mürben Salonbürgertums“ hergezogen wird. Alberto Savinio gilt als einer der Wegbereiter der modernen italienischen Literatur. Heute berühmte Schriftsteller wie Luigi Malerba oder Umberto Eco nennen ihn einen ihrer Lehrer. Im deutschsprachigen Raum jedoch ist Savinio noch weitgehend unbekannt, obwohl von ihm inzwischen mehrere Bücher, darunter das wunderbare Mailand-Buch „Stadt, ich lausche deinem Herzen“, übersetzt worden sind. Die Neugierde des Alberto Savinio galt stets den „Dingen, die im Schatten ihrer bewunderten Schwestern leben: den Aschenbrödeln der Stadt. Es geht darum, Dinge zu sehen, die auch die anderen sehen, jedoch in einem Augenblick, in dem die anderen nicht hinsehen“. Bevor er sich einem Gegenstand, einem Menschen, einem Kunstwerk oder wie in seinem großen Mailand-Buch, einer ganzen Stadt nähert,gilt erst einmal dem scheinbar Abseitigen seine Aufmerksamkeit. So beginnt er sein Lauschen am Herzen Mailands mit einem Gang durch Venedig und einem Aufenthalt im Café Pedrocchi, einem der bis heute pulsierenden Herzen Paduas. Als wolle er seine Sinne für den Gang durch das geliebte Mailand vorher noch einmal in der Fremde erproben, tastete, hört, schmeckt, riecht Savinio sich durch die Serenissima. „Keine Stadt wurde so sehr als Frau geliebt, wie die Stadt Venedig, La Venezia. Vielleicht wegen ihres Geruchs, vielleicht weil sie sich am Geruch zu erkennen gibt.“ In Venedig entdeckt er auch noch jene „geschlossene Kultur“, der sein einziges Interesse gilt. Savinio liebt Kurzerzählungen, Abschweifungen, Grillen, kauzige Blicke in die Welt hinter den Tapetentüren der Wirklichkeit. Wo immer er auch seine Augen hinlenkt, auf Steinsäulen, Mobiliar, Schaufenster, Bahnhofsglocken beginnt sofort das Leben, werden Phantasien gezündet, werden grandiose Exkurse in die Dialektik der Nebensächlichkeiten und Banalitäten gestartet. An den Rändern der öffentlichen Großereignisse und Inszenierungsspektakel Liegengebliebenem gilt seine ganze Aufmerksamkeit. Über scheinbar Unsinniges wie etwa einer Philosophie der Kalauer („Die Frau ist eine vorsätzliche Feindin der Kalauer“) oder dem Untergang des „Fensterladenöffnens“ durch die Erfindung des Rollos schwadroniert er seitenlang auf hohem geistigen Niveau. Bei Savinio kann man die hohe Kunst des intellektuellen Herumschweifens in den Abstellkammern des Alltäglichen und Normalen erlernen. Einem nur an der instrumentalen Vernunft und reibungsloser Verwertbarkeit orientierten Fortschrittsbegriff stellt er ein Verständnis von Kultur gegenüber, das allen Protagonisten der kleinen literarischen Form, so verschieden sie ansonsten auch sind, eigen zu sein scheint: „Der Fortschritt der Kultur“, schreibt Savinio in seinem mailänder Flaneurbuch, „läßt sich messen am Sieg des Überflüssigen über das Notwendige.“
6.
Die schönste Definition der ‚kurzen Form’, die gleichzeitig auch als eine Hommage auf die Abkürzung als ein Vorschein einer am Ende des kurzen Weges erscheinenden langen Allee zu lesen ist, hat der triestiner Schriftsteller Umberto Saba geschrieben. Er hat den Abkürzungen ein eigenes Buch gewidmet , das beginnt mit seinem Verständnis des kurzen Weges, der kurzen Form: „Abkürzungen sind kürzere Wege, um von einem Ort zum andern zu gelangen. Sie sind zuweilen beschwerlich, richtige Ziegenpfade. Sie können Sehnsucht nach den langen, ebenen, geraden Landstrassen wecken.“
Carl Wilhelm Macke