
Die Entdeckung des Moors für Literatur und Kunst
Von Ludwig Fischer
Zunächst ist eine Binsenweisheit angebracht: Was wir als ‚Natur’ wahrnehmen, bedenken, beurteilen, ist immer eine kulturell erscheinende Natur. Es gibt in unserem Bewusstsein Natur für uns Menschen nur in den Bildern und Vorstellungen, die wir uns von ihr machen. Damit löst sich aber das, was ‚Natur’ heißt und ist, nicht in ein bloßes ‚kulturelles Konstrukt’ auf. Unser Körper, der selbst Natur ist, kann uns das lehren – schon um ihn, als ‚Natur’, zu erhalten, müssen wir eine vorgängige, gegenständliche, nicht bloß ‚gedachte’ Natur bearbeiten. Mehr noch: Der größte Teil dessen, was wir mit unseren mehr oder weniger aufmerksamen, mehr oder weniger gut geschulten Sinnen als unsere Mitwelt – insbesondere die natürliche Mitwelt – wahrnehmen, bleibt uns unbewusst, wird von unserem Leib (dem in natürlichen und gesellschaftlichen Umgebungen ‚anwesenden’ Körper) autonom, ohne unser willentliches Zutun aufgenommen und ‚verarbeitet’.Wir dürfen also weder in einen naiven szientifischen Realismus der vorgeblich natürlichen Natur verfallen – so als sei ‚Natur’ die Gesamtheit der nicht menschlich verfertigten und transformierten ‚Objekte und Prozesse’, die wir durch Wissenschaft und Technik ‚exakt’ beschreiben und erforschen können –, noch dürfen wir uns einem radikalen Konstruktivismus ausliefern, mit dem wir uns ‚logisch’ beweisen wollen, dass wir über ‚die Natur’ keine ontologisch gültigen Aussagen machen, sondern uns nur über die Konstrukte unseres Bewusstseins verständigen könnten.
Die Realität unseres wahrnehmenden und tätigen Umgangs mit dem, was wir Natur nennen, ist weit verwickelter, als es rigide philosophische Theorien wahrhaben wollen.

Auch die Geschichte unserer Wahrnehmung und Darstellung des Naturraums Moor liefert dafür ein eindrückliches Beispiel. Ich will das hier nur für die jüngsten Phasen dieser Wahrnehmungs- und Darstellungsgeschichte aufzeigen, für die Zeit seit Beginn der ästhetischen Nobilitierung des Moors – die nicht zufällig mehrere Jahrzehnte nach der großflächigen Kolonisierung und Urbarmachung der Moore in Deutschland einsetzte. Das heißt: Ich betrachte, notwendig skizzenhaft, die ‚Entdeckung des Moors für Literatur und Kunst’ in der bürgerlichen Gesellschaft etwa seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts.
Für unsere heute noch vorherrschende, inzwischen ökologisch angereicherte Vorstellung vom Naturraum Moor wurden – wie für unseren gesamten Naturbezug, auch den Naturschutz – die entscheidenden Bilder und Wertzuschreibungen mit dem Aufstieg der bürgerlichen Ökonomie und Sozialverfassung entworfen, also etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, maßgeblich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Literatur und Kunst waren dabei wichtige Medien. Und zugleich lassen sich die überlieferten kulturellen Hervorbringungen auch als Dokumente für jene unaufhebbare Dialektik von Naturbearbeitung und Naturwahrnehmung begreifen, mit der gleichsam ‚hinter unserem Rücken’ Form und Ergebnis der tätigen Aneignung von Natur noch in unsere unbewussten Einstellungen, Bilder und Bewertungen eingeht.
Ich bringe, für das Beispiel unseres Umgangs mit dem Naturraum Moor, diesen Zusammenhang zunächst auf eine zugespitzte Doppelthese. Erstens: Die ästhetische ‚Entdeckung’ des Moors (im 19. Jahrhundert) erfasste, sieht man genau hin, gar nicht die ‚unberührte Natur’ des Hoch- oder Niedermoors, also das, was wir inzwischen aus ökologischen (oder klimatologischen) Gründen für schützenswert halten und was in Deutschland nur noch in winzigen Restbeständen vorhanden ist. Vielmehr richtete sich der Blick der künstlerisch und populärkulturell maßgeblichen Akteure auf das mit den entscheidenden Unternehmungen schon kultivierte Moor, die bereits zivilisatorisch überformte Natur.
Zweitens: Auch diese ästhetische Überhöhung der ‚ersten Stufe’, also der vorindustriellen Phase der Moorkolonisierung hat, mit ihrer agrar-romantischen Tendenz, einen regressiven Zug, stellt das gesamtgesellschaftlich schon weithin Überholte vor. Was als künstlerische ‚Entdeckung’ einer bis dahin ästhetisch unergiebigen, ja verachteten Landschaft gefeiert wurde, entwarf stilisierte Bilder einer im Grunde vormodernen Aneignung eines Naturraums und trennte die Wahrnehmung der ‚ursprünglichen’ Moorlandschaft von der kulturell sozusagen geadelten Darstellung ab. So überlagerte sich die agrar-romantisch intonierte ‚Entdeckung des Moors’ durch Maler und Schriftsteller, mit der eine wirtschaftliche Erschließung von Moorarealen zu Bildern von ‚schöner Natur’ stilisiert wurde, mit einer indirekten, zumeist ungewussten Negation von unbearbeitetem Moor, von nicht erschlossener Naturlandschaft.

Damit aber bestätigte gewissermaßen, sieht man auf die politisch und wirtschaftlich vorangetriebene Vernichtung der lebendigen Ökosysteme der Moore, die ästhetische Aneignung von Moorlandschaften ungewollt noch einmal jene Entwertung des Naturraums Moor, die am Beginn der neuzeitlichen Kolonisierung der Moore stand. Denn – und jetzt kommt der auch für eine ökologische Betrachtung entscheidende Befund – die Ästhetisierung von Moorlandschaften setzte kultur- und bewusstseinsgeschichtlich einen menschlichen ‚Triumph’ in der Erschließung und Verwertung der natürlich gewachsenen Moore voraus. Ohne den ‚Sieg über das Moor’ ist weder eine künstlerische Aneignung vom vorgeblich archaischen Lebensraum Moor noch auch eine ökologische Wertschätzung des ‚naturbelassenen’ Moors möglich. Wer als ästhetisch gestimmter Betrachter oder als ökologisch motivitierter Fürsorger und Schützer diese Dialektik übersieht oder gar negiert, landet immer wieder bei politischer Ohnmachtserfahrung und einer von Zorn grundierten Trauer über das Verlorene und weiter verloren Gehende.
Ich möchte diese Thesen am kulturgeschichtlichem Material zum Teufelsmoor, nordöstlich von Bremen, ein wenig erläutern. Das liegt nahe, nicht weil ich wenige Kilometer vom ursprünglichen Teufelsmoor-Gebiet entfernt wohne, sondern weil die ‚Entdeckung’ des Teufelsmoors, einstmals eine der größten Moorlandschaften Norddeutschlands, die modellbildende und maßgebliche ästhetische Nobilitierung vom vorgeblichen Naturraum Moor überhaupt ist. Das ‚Malerdorf’ Worpswede, eine der bedeutenden europäischen Künstlerkolonien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, bildet den Kristallisationspunkt für diese ja bis in die Gegenwart fortwirkende Erschließung von Moor für die kulturelle Wertschätzung. Nicht nur die traditionalistische ‚Worpswede-Malerei’ der vierten oder fünften Generation, sondern auch die avantgardistische Kunstpraxis setzt sich an diesem Ort noch immer mit der ästhetischen Entdeckung von Landschaft auseinander, die einmal Moor war und deren kolonisierende Aneignung seinerzeit die Voraussetzung für eine kulturelle Aufwertung war. (Vgl. das Projekt ‚Sehnsucht nach Landschaft? Kunst und Natur in Worpswede. 3.6. bis 8. 10. 2000. Katalog Worpswede 2000)
Um etwas von diesem kulturgeschichtlichen Prozess verständlich machen zu können, muss ich ganz kurz in die wirtschafts- und sozialhistorische Entwicklung ausholen. Zu den Standards über die Geschichte des Teufelsmoors gehört der Hinweis, dass das riesige, unwegsame und für die Menschen ‚lebensfeindliche’ Hochmoor-Gebiet von den Rändern angrenzender Geestrücken aus schon im Mittelalter partienweise genutzt wurde, ja dass von den Klöstern Lilienthal und Osterholz aus erste Moordörfer bereits im 12. Jahrhundert gegründet wurden, wie etwa Worpswede. Aber gerade Worpswede zeigt, was dafür die Voraussetzung war: nämlich fester Grund. Das Dorf lag, in seiner ursprünglichen Ausdehnung, am Hang einer großem Düne im Moor, dem Weyerberg, also auf sandigem, für den Ackerbau nutzbaren Boden. „Das Moor wurde von den Bauern ringsum praktisch als ihre Allmende betrachtet und, wo es ging, auch als Weideland, sonst aber als Torflieferant für Heiz- und Stallstreuzwecke verwandt.“ (Björn Emigholz: Das Bild des Teufelsmoores bei Bremen. Funktionsanalyse eines Aspektes von Stadt-Land-Beziehungen. Diss. Hamburg 1985, S. 17)
Das Moor selbst wurde also nicht systematisch erschlossen und besiedelt, sondern in einem sehr geringen (heute würden wir sagen: ‚verträglichen’) Ausmaß wirtschaftlich genutzt, mit minimalen Eingriffen in die ‚Natursubstanz’ und nur ganz partiell mit an die Naturgegebenheiten angepassten Kultivierungsmaßnahmen. Alte Karten führen diesen Sachverhalt vor Augen. Ich wähle ein leicht greifbares Beispiel aus dem Vehnemoor westlich von Oldenburg: Das Siedlungsareal und die Weide- und Ackerflächen liegen auf Geestvorsprüngen am Rand der noch Ende des 18. Jahrhunderts geschlossenen Moorfläche. Es führen nur ganz wenige, lediglich im Sommer begehbare Wege durchs Moor, aber es gibt im Moorgebiet „Buchweizenmoore“, also Flächen, auf denen im unkultivierten Moor Buchweizen angebaut werden konnte. Einige wenige, nur unter günstigen Umständen nutzbare Schaftriften kommen hinzu. (Thomas Kossendey/Gerd von Seggern (Hg.): Aus braunem Moor wird grünes Land – Kleefeld. Oldenburg 1983, S.40)
So müssen wir uns die nur in den Randbereichen überhaupt möglichen, bäuerlichen Nutzungen von Moorflächen über viele Jahrhunderte hin, bis weit in die Neuzeit hinein, vorstellen, gewissermaßen menschliche Mitnutzungen eines Naturraums, der weit gehend sich selbst überlassen blieb. Vergleichbar ist die Praxis in Hudewäldern und in manchen Heidegebieten. Das änderte sich ziemlich abrupt und durchgreifend in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Merkantilistische Wirtschaftsprinzipien der Aufklärungszeit verlangten staatliche Autarkie auch für die ökonomische, auf der Landnutzung basierende Entwicklung, Bevölkerungswachstum war, nicht zuletzt unter militärischen Gesichtspunkten, anzustreben. Entsprechend solchen Maximen war die Ausweitung der landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen unabdingbar. Folgerichtig wurden ab 1740, verstärkt dann ab 1770 staatliche Programme zur systematischen Kultivierung von ‚Ödland’ entworfen und dann auch orbigkeitlich umgesetzt. Rainer Beck hat am Beispiel bayerischer Gebiete detailliert nachgezeichnet, wie eine solche Erschließung von scheinbar ungenutztem Land auch gegen starken Widerstand der bäuerlichen Bevölkerung, die an den traditionellen ‚Mischnutzungen’ von unkultiviertem Arealen festhalten wollte, mit drakonischen Maßnahmen durchgesetzt wurde. (Rainer Beck: Die Abschaffung der ‚Wildnis’. Landschaftsästhetik, bäuerliche Wirtschaft und Ökologie zu Beginn der Moderne. In: Werner Konold (Hg.): Naturlandschaft – Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der Nutzbarmachung durch den Menschen. Landsberg 1996, S.27-44) Was als gottgewollte und Gewinn verheißende Urbarmachung von ‚Wildnis’ deklariert wurde, war in Wirklichkeit die Abschaffung ‚angepasster’ Nutzungen von Naturräumen, denen wir heute Grenzertragsböden zuschreiben würden. Die Grenzen zwischen ‚nützlichem Land’ und ‚Wildnis’ wurden neu gezogen, ja allererst scharf gemacht – mit einem gewaltigen Schub an Reduktion von bis dahin unerschlossenem oder sehr extensiv genutzten Flächen.

Im Teufelsmoor hatten sich hie und da ‚Kolonisten’ vom Geestrand aus auf einigermaßen geeigneten, also nicht völlig sumpfigen Moorflächen angesiedelt, lebten aber ökonomisch zumeist weniger von den Nutzungen dieser angeeigneten Moorpartien als von Lohnarbeit für Bauern der angrenzenden Geest. (Emigholz, s.o., S. 17f) Aber 1750 wurde die systematische Kolonisierung größerer Areale mit zentraler staatlicher Planung voran getrieben. Die Leitung hatte der von der kurhannoverschen Regierung (d.h. genauer: vom englischen König) eingesetzte Beamte Jürgen Christian Findorff, der 1771 den eigens geschaffenen Titel eines ‚Moorkommissars’ erhielt. (ebd., S. 20; vgl. Karsten Müller-Scheessel: Jürgen Christian Findorff und die Kurhannoversche Moorkolonisation im 18. Jahrhundert. Hildesheim 1975) Parzellen wurden an interessierte ‚Kolonisten’ vergeben, sogar Gelder und Materialien zur Errichtung von Häusern bereit gestellt, strenge Verpflichtungen zu Arbeiten an der Entwässerung der Kultivierungsareale auferlegt.
Ich kann und will hier nicht den Verlauf der für die bäuerlichen Akteure äußerst entbehrungsreichen ersten Phase der Moorkolonisierung des Näheren nachzeichnen. Erfolg hatten vor allem die Kolonisten der ersten Stunde, die nahe an den Flüssen des Teufelsmoor-Gebiets siedeln konnten – Hamme, Wörpe, Beek. Denn zu Seiten der Flüsse und Flüsschen lagen Partien, die durch die regelmäßigen Überschwemmungen aufgeschlickt waren und festere Grasnarben entwickeln konnten, so dass sie als Weideland nutzbar waren. Findorff hatte in seinem Grundsatzkatalog dekretiert, dass – abgesehen von der unabdingbaren Erschließung durch Kanal- und Grabensysteme sowie der Befestigung von Verkehrswegen – die Nähe der Ansiedelungen zu Gräsungsflächen geboten sei, damit eine Basis für die Viehhaltung als landwirtschaftlicher Notwendigkeit bestehe. (Emigholz, s.o., S. 20f) Aus den durch die Lage begünstigten Moordörfern entwickelten sich relativ rasch prosperierende bäuerliche Gemeinden. In den abgelegenen Moorpartien aber herrschte bis ins 20. Jahrhundert hinein eine kaum glaubliche Armut. Den Kolonisten dort blieb oft nichts anderes, als auf Landwirtschaft so gut wie ganz zu verzichten und eine dürftige Existenz ausschließlich auf den Torfabbau mit Spaten, Schaufel und Torfmesser zu gründen.
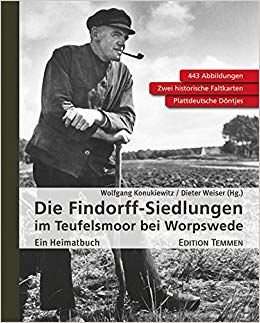
So verlangsamte sich denn auch der Kolonisierungsprozess im Teufelsmoor in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr stark. Findorff hatte bis zu seinem Tod 1792 51 Moordörfer gründen können. Bis 1850 entstanden nur noch 18 weitere Dörfer. (ebd., S. 22) Und auch in den Arealen der etablierten Dörfer war durchschnittlich nur ein Fünftel, oft weniger, der zugewiesenen Flächen in Kulturland umgewandelt. Bereits vor 1800 setzten die Klagen der zuständigen Ämter ein, dass nur noch schwer bereitwillige Siedler zu finden seien. Und die Hütten der ärmsten Moorbewohner, mit Wänden aus Torfsoden oder allenfalls ein paar Fachwerkhölzern und Backsteinen, mit Grasplaggen oder dünnem Schilf gedeckt, fanden sich eben noch bis in die Zeit, zur der Schriftsteller und Maler das Moor als der Darstellung würdige Landschaft ‚entdeckten’.

Für das Teufelsmoor gibt es nun eine literarische Quelle, in der sich sehr genau das Grundmuster für die Ästhetisierung fassen lässt. Der Reiseschriftsteller Johann Georg Kohl aus Bremen veröffentlichte, nachdem er schon ein sehr erfolgreicher Autor im damals populären Genre der Reisebeschreibung mit Büchern über europäische Landschaften geworden war (Johann Georg Kohl: Nordwestdeutsche Skizzen 1864. Stuttgart 1990. Einleitung, S.15ff) und mehrere Bücher über Nordamerika verfasst hatte, 1864 seine ‚Nordwestdeutschen Skizzen – Fahrten zu Wasser und zu Landen’. Darin findet sich ein längeres Kapitel über ‚Das Teufelsmoor im Herzogtum Bremen’. Kohl rechtfertigt seine Schilderungen von den Erkundungsfahrten und –gängen im Moor, wie durchgehend bei seinen Reisebeschreibungen, mit einem binnenethnografischen Interesse: „Ich habe mehr diejenigen Partien des Landes aufgesucht, zu denen die großen Heerstraßen nicht führen, die der fremde Besucher nicht so bald aufsucht, mit denen er sich selbst zu beschäftigen auch keine Zeit hat, die er zur Erweiterung seines Blickes aber doch gern von Anderen geschildert sieht, um zu erfahren, wie es im Inneren des Landes, das er nur auf den großen Stationen berührt, aussieht.“ (Johann Georg Kohl: Nordwestdeutsche Skizzen – Fahrten zu Wasser und zu Landen. Bremen 1864, S. IV)

Der Hinweis darauf, dass die beschriebenen Landschaften, so auch das Teufelsmoor, abgelegen und relativ wenig bekannt seien, ist von Bedeutung. Denn die ästhetisch begründete Hinwendung zu peripheren, im allgemeinen Interesse noch unentdeckten Räumen hat einen entscheidenden Impuls aus der Entgegensetzung zu den urbanen, wirtschaftlich und kulturell weit entwickelten Regionen erhalten – die Zivilisationskritik, die das Movens der Agrar-Romantik bildete, wurde gerade bei den europäischen Künstlerkolonien, zu denen ziemlich früh eben Worpswede gehörte, in den Protest gegen den ‚Akademismus’ übersetzt, gegen die Verpflichtung auf eine streng an der beglaubigten Tradition ausgerichtete künstlerische Arbeit. Die Wendung etwa zur Plein-air-Malerei in ‚naturnahen’ Landschaften und dann, wie in Worpswede, in scheinbar archaisch-authentischen Lebenssphären und ‚ursprungsnahen’ Naturräumen suchte eine Erfahrtungswelt, die noch ‚unverfälscht’ zu sein versprach von den zivilisatorischen Überformungen in den Ballungsräumen und Kulturzentren.
Kohls Begründung für seine Auswahl darstellungswürdiger Landschaften liefert ein Indiz dafür, dass es ein verbreitetes Interesse an der literarisch durchaus ambitiösen Schilderung erreichbarer, aber relativ wenig besuchter Landschaften gab, unter denen solche wie das Teufelsmoor, Bereiche mit zunächst befremdlichen, vormodernen Lebensformen, eine besondere Rolle spielten, wie ähnlich die von Kohl schon vorher besuchten Halligen im nordfriesischen Wattenmeer. (vgl. Johann Georg Kohl: Die Marschen und Inseln der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Dresden und Leipzig 1846. Bd. I, S.301ff) Nur so lässt sich ja dann der nach einem ersten Fehlschlag mit der Bremer Ausstellung schlagartig einsetzende, enorme Erfolg der Worpsweder Maler erklären.
Für meine Thesen ist nun aber entscheidend, dass Kohl ganz unmissverständlich und krass wertend bei seinem Reisebericht aus dem Teufelsmoor unterscheidet zwischen dem unerschlossenen, unwegsamen und unabsehbar sich erstreckenden Hochmoor und den kolonisierten, besiedelten, zu Kulturland verwandelten Partien des großenteils abgetorften, landwirtschaftlich intensiv genutzten Moorgrunds.
Er schildert eine Fahrt, auf der er sich mit dem Kahn auf einem der Kanäle dem Dorf Teufelsmoor nähert, das zu den ältesten Siedlungen in dem aus verschiedenen Teilen bestehenden, nur pauschal unter dem einen Namen zusammengefassten Moorgebiet gehört.
„ [… wir] bekamen so endlich das gesagte, am Rande des Hochmoors gelegene Dorf in Sicht. Dasselbe bot uns Heranschiffenden eine gar anmuthige Front dar, schöne weitläuftige Gehöfte und von Wohlhäbigkeit schimmernde Bauernhäuser, unter dem Schatten eines Eichenhains und mit künstlich geschaffenen Wiesengründen, die zu unsern Grünlandsümpfen hinabfielen und mit Geflügel und Vieh bedeckt erschienen. Es waren die Besitzungen einiger der ältesten und daher reichsten Ansiedler des Ortes. Da das Land zuerst bei dem Beginn solcher Moor-Colonien billig zu sein und als Lockspeise billig verschenkt zu werden pflegte, so schnitten sich die ersten Ansiedler aus dem wüsten Hochmoore die Morgen zu Hunderten heraus. Sie waren trotzdem nicht gleich reich, aber ihre Nachkommen wurden es, indem man allmählich alles zugänglicher machte, mehr anbaute und besser verwertete.“ (Kohl 1864, s.o., S. 229/30).

Der ‚schöne Anblick’ gleicht mit den aufgeführten Elementen fast völlig dem eines norddeutschen Dorfes außerhalb der Moorgebiete, das ‚Anmutige’ beruht in dieser Schilderung auf der gelungenen Verwandlung von Moorboden zu bäuerlichem Kulturland. Die positive Wertung in ästhetischer Hinsicht wird ermöglicht durch die anschaulichen Resultate einer optimierten Verwertung des ursprünglich „wüsten“ Siedlungsareals.
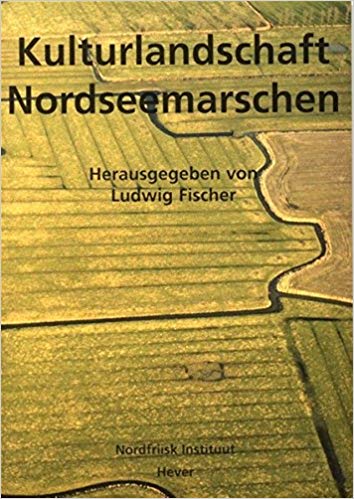
In diesem ästhetischen Urteil schimmert die alte, für die Aufklärungszeit charakteristische ‚Schönheit des Nützlichen’ durch, wie sie mustergültig an der nahezu geometrischen Kulturlandschaft der holländischen Nordseemarschen wahrgenommen worden war. Der bei Albrecht von Haller und vielen Zeitgenossen dokumentierte, geradezu enthusiastische Lobpreis dieser „an der Schnur“ ausgerichteten Fluren und des ihnen abgewonnenen, sichtbaren Wohlstands war aber bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts schroff abgelehnt worden, vom Gegenmodell einer Erhabenheitsästhetik her, die das ‚Wilde’ und Bedrohliche schroffer Küsten, hoher Gebirge, starker Wasserfälle und aufgewühlter Meere feierte. (Vgl. Ludwig Fischer: Die Ästhetisierung der Nordseemarschen als ‚Landschaft’. In: L.F. (Hg.): Kulturlandschaft Nordseemarschen. Bredstedt/ Westerhever 1997, S.201-232)
Johann Georg Kohls ästhetische Wertsetzung in der Beschreibung des Moordorfs richtet sich also an einer historisch bereits obsoleten Identität von ‚schön und nützlich’ aus, sie gehört eigentlich in jene Zeit, in der die systematische Moorkultivierung begann. Und genau deren Imperativen gehorcht folgerichtig die Bewertung des (nahezu) unerschlossenen Moors.
„Obgleich wir uns, wie gesagt, mitten in der schönsten Jahreszeit befanden, in welcher Alles umher, was nicht Moor war, grünte und blühte, und in der alle Gebüsche der Haide vom Gesange der Vögel erklangen, so war doch auf diesem Moor-Plateau alles todt und öde, wie im tiefsten Winter. Vögel gab es da nicht, weil kein Gebüsch und keine Gelegenheit zum Nestbau vorhanden ist. Keine Lerche jubelt in den Lüften. Kein Fisch bewegt sich in den im Moraste behanten Gewässern. Selbst Fuchs und Hase können in diesem Sumpfe nicht leben. Obgleich die Sonne lieblich strahlte, wanderten wir auf tiefen glitscherigen Morastwegen wie im trüben November. Die Oberfläche war überall mit verschiedenen Sorten schmieriger und schwammiger Moose bewachsen. Wir konnten uns einbilden, es wäre ein riesiger verfaulter, auf der Erde hingestreckter Baumstamm, auf dessen abgestorbener Rinde wir wie kleine Käfer kröchen. Obgleich man im Grunde genommen in einer Niederung steckte, so hat man dabei doch den Eindruck, als befände man sich auf einer hocherhabenene Anhöhe. Solche Öde sah man nur an den Ende und Gipfeln der Erde, auf dem Rücken der Hochgebirge und dicht unter dem Wolkenschleier der Gletscher.“ Kohl 1864, s.o., S. 231/32)

Die nicht erschlossene, nicht in ertragreiches Kulturland verwandelte Moorfläche nimmt Kohl als eine trostlose, trübe und ‚tote’ Ödnis wahr, der auch ästhetisch keinerlei Reiz abzugewinnen ist. Die Vergleichung mit Hochgebirge und Gletscher belegt noch einmal, dass der Autor damit sozusagen hinter die Erhabenheitsästhetik zurück geht, die ja gerade an der Hochgebirgsregion den ‚delightful horror’ und ‚terrible joy’ des Erhabenen als die höherwertige ästhetische Empfindung entdeckt hatte. Das flache, scheinbar strukturlose Hochmoor machte allerdings eine positive Wertung im Zuge der Erhabenheitsästhetik schwer, obwohl es mit der Eigenheit des Endlosen, Unabsehbaren Ansätze für die Kantische Kategorie des ‚mathematisch Erhabenen’ hätte bieten können. Es fehlte ihm nicht bloß das sichtbar und direkt erlebbar Bedrohliche des ‚dynamisch Erhabenen’, sondern auch die definitive Grenzenlosigkeit von Ozean und Eiswüste.
Denn Kohl beschreibt unmittelbar im Anschluss an die zitierte Passage, dass auf dem ‚wüsten Plateau’ des Moors sehr wohl erste menschliche Aktivitäten zu erkennen sind, manifest mit den verstreuten Hütten der Torfstecher. Die Armseligkeit dieser primitiven Behausungen, die regelrecht archaische Praxis der schweren Arbeit des Torfabbaus und die unfassbar harten Lebensbedingungen der Menschen bei dieser Primärnutzung des noch im ‚Naturzustand’ befindlichen Moors schildert Kohl in aller Ausführlichkeit. Er gesteht: „Ich hatte nicht gewusst, dass es in unserem Deutschland noch solche Zustände gäbe.“ (ebd., S. 244) Und er rechtfertigt die Beschreibung der erbärmlichen Verhältnisse bei den auf Torfabbau angewiesenen Siedlern damit, dass er sie als die unumgängliche, erste Phase einer dann Ertrag versprechenden, ‚normale’ bäuerliche Existenz eröffnenden Kultivierung der Ödnis deklariert. (Emigholz, s.o., S. 70f)
Nun geschieht aber bei der Abschilderung der befremdlichen, entwürdigenden Lebensform der Torfstecher und ihrer Familien etwas Bemerkenswertes: Er erklärt nämlich, dass der Kontrast zwischen den ästhetisch ansprechenden, älteren Dörfern der erfolgreichen Kolonisten und dem noch unerschlossenen Hochmoor (einschließlich der unglaublich primitiven Lebenspraxis beim Torfabbau) sehr wohl einen besonderen Reiz vermittele: „[…] ich begreife nicht, dass solche Contraste von unseren wissbegierigen Reisenden nicht häufiger aufgesucht, dass solche merkwürdigen Gegenden von unseren Touristen, die doch immer nach dem Neuen trachten, nach An- und Aufregung verlangen, nicht mehr bereist werden. Ein feiner, allgemein empfänglicher und vielseitig entwickelter ästhetischer Sinn fehlt uns bei unseren Reisen noch zu sehr und gewöhnlich streben wir nur dem nach, was in Italien und in den Alpenthälern recht glänzt und scheint. Wäre es anders, so würden beobachtende Natur- und Menschenfreunde im Teufelsmoore und in vielen ihm ähnlichen nordwestdeutschen Strichen sich häufiger begegnen, als es geschieht.“ (Kohl 1864, s.o., S. 245/46)
Der ästhetische Sinn soll sich also nicht auf das Hochmoor selbst richten, sondern auf das ‚Merkwürdige’ an einer ungewöhnlichen, zunächst befremdlichen und dann im Erfolg der Kultivierung umso ‚schöner’ anmutenden Bearbeitung der Naturgegebenheit. Ziel ist es, gewissermaßen auch ästhetisch „mit den Colonisten über die erlangten Triumphe zu jubilieren.“ (ebd., S. 249) Aber im Bewusstsein dieses allenthalben bereits sichtbaren ‚Sieges über die wüste Natur’ des Moors können dann auch der Dürftigkeit des Daseins im Prozess der Kultivierung besondere Reize abgewonnen werden. Kohl scheint auf die ästhetische Aneignung der quasi archaischen Lebensformen im Moor regelrecht voraus zu weisen: „Ich begreife nicht, dass unsere Maler das Leben und Treiben an solchen merkwürdigen Hochmoorhäfen und Torffabrikstätten, die sich überall an den zerfressenen Rändern unserer Hochmoore darbieten, noch so wenig zum Gegenstand von Studien gemacht haben.“ (ebd., S. 241)

Mit Kohls Reisebericht aus dem Teufelsmoor ist bis ins 20. Jahrhundert hinein paradigmatisch das Grundmuster einer ästhetischen Erschließung der Moorgegenden etabliert: Der nach ‚Reiz’ suchenden Wahrnehmung der sensibilisierten Kulturbürger, der ästhetischen Aneignung durch die das ‚Andere’ suchenden Maler und Literaten ist nicht das Moor selbst, sondern die Manifestation der ihm abgewonnenen bäuerlichen Lebensweise interessant und darstellenswert. Noch die Hinwendung zu den erbärmlichen Existenzen von Moornutzern der ‚ersten Stufe’ erhält ihren grundlegenden Impuls aus einer Kontrasterfahrung zum zivilisatorischen Leben und setzt zugleich voraus, dass der ‚Triumph über die Natur’, in der letztlich gelingenden Kultivierung aus scheinbar archaischen Anfängen, mitgedacht wird.
Was diese Koordinaten einer ‚ästhetischen Entdeckung des Moors’ für künstlerische Darstellung bedeuten, lässt sich an Malerei und früher Fotografie der Worpsweder Künstler der ‚ersten Generation’ zeigen. Mit ganz wenigen Ausnahmen erfasst die Landschaftsdarstellung aus den Moorgegenden um Worpswede unübersehbar die bereits erschlossene, zur Kulturlandschaft verwandelte Moornatur. Häuser, Gräben, Kanäle, von Booten befahrene Flüsse, von Birken gesäumte Fahrwege, bestellte Felder werden zu Chiffren einer zwar in die Vormoderne gerückten, aber menschlich bearbeiteten Umgebung. Auch Bilder, die ‚nichts als Landschaft’ vorstellen, zeigen die bäuerlich genutzten Partien, etwa die Wiesen an den Flussläufen, oder die Zeichen des Torfabbaus. (Zum Beispiel Heinrich Vogeler: Der Moorgraben. 1913; Otto Modersohn: Birken im Moor. Um 1904; Fritz Overbeck: Zwischen Moorwänden. 1902; Hans am Ende: Sommertag. 1901) Und die malerische Komposition bestätigt gewissermaßen den ‚Triumph der Kultivierung von Natur’, zum Beispiel in der ‚reizvollen’ Darstellung von Flachlandschaft – entgegen den klassischen Normen von Rahmung und bildlicher Staffelung wird der entgrenzten Landschaft das Ornament sparsamer Linien und Flächenkontraste eingeschrieben, und nach dem Vorgang schon der Holländer des 17. Jahrhunderts wird dem ‚Großen Himmel’ entscheidende Formen- und Farbwirkung zugewiesen. (Vgl. etwa Hans am Ende: Weites Land. 1902; Otto Modersohn: Hammewiesen mit Weyerberg. 1889; Fritz Overbeck: Im Moor. 1902)

Die Worpsweder der ersten Generation sind mehr oder weniger ‚moderate Realisten’ und greifen beispielsweise selten die radikaleren Gestaltungsmittel für Flachlandschaften auf, wie sie seit Caspar David Friedrich erprobt wurden. Wie sehr in den Moorbildern die ästhetische Überhöhung durch das Kompositorische die ‚bloße Natur’ erfasst, zeigt sich am deutlichsten dort, wo einmal das Moor selbst Gegenstand wird. Etwa Otto Modersohns Gemälde ‚Moortümpel’ (um 1896) verwandelt unverkennbar den ‚Naturausschnitt’ in ein Kunstprodukt, wesentlich mit dem an Jugendstil gemahnenden Ornament eines Bewuchses auf der kleinen, bemerkenswert farbigen Wasseroberfläche.
Paula Becker-Modersohn war die modernste unter den frühen Worpswedern. Nicht ohne Grund schulte sie sich in Paris an den avantgardistischen Malern ihrer Zeit, um das ‚Wesentliche’ auch an den Menschen und der Landschaft in der Moorgegend erfassen zu können. Ihr Anschluss an die künstlerische Moderne der Jahrhundertwende dokumentiert, dass die Ästhetisierung des kolonisierten Moors vom ‚urbanen’ Kunstwillen aus auch dort erfolgte, wo im Lebensvollzug der Maler eine Abkehr vom maßgeblichen Kulturraum der Stadt zu konstatieren ist. Mit ihrer Kunst bleiben sie nicht nur dem Urteil, sondern auch dem Publikum, den ‚Abnehmern’ in den Zentren verpflichtet. Deshalb trägt die Hinwendung zur bäuerlichen Lebenswelt am Rand der erschlossenen Moorpartien deutlich agrar-romantische Züge, idealisiert diese noch in vielem vormoderne Welt zu einer Einheit von Naturbasis und menschlicher Sozietät, während gleichzeitig der für den künstlerischen Erfolg unerlässliche Anschluss an städtischen Kultursphären gewahrt bleibt. Das wird nicht nur an den Biographien und Arbeiten etwa von Heinrich Vogeler oder Paula Becker-Modersohn deutlich.
Die Ambivalenz von energisch angeeigneter Modernität in der ‚Hauptstadt der Kunst’ und romantisierender Stilisierung der immer wieder dargestellten Lebenswirklichkeit in der Moorgegend zu einem authentischen ‚Gelingen des einfachen Lebens’ schlägt sich auch in Becker-Modersohns Texten nieder. (S. etwa Worpswede und das Teufelsmoor. Hamburg 1984. S. 40f) Auch sie hält sich, wo sie Landschaftspartien malt, an die Erscheinung des bereits kultivierten Moors, und sie radikalisiert die kompositorische Wirkung, indem sie die Elemente dieser spezifischen Kulturlandschaft vereinfacht, das Formale im noch bewahrten ‚Abbildungsrealismus’ heraus hebt. (vgl. etwa ‚Moorkanal’. Um 1900) Gerade damit strebt sie aber das ‚Essenzielle’ der wahrgenommenen Landschaft und der in ihnen lebenden Menschen zu erschließen an.
Schärfer noch als bei den Malern wird in frühen Fotografien aus dem Teufelsmoor die indirekte ‚Negation’ des Naturraums Moor deutlich, indem sich die ästhetische Überhöhung des Angeschauten auf die Erscheinungen des bereits erschlossenen Hochmoors konzentriert. Der Maler und Grafiker Georg Tappert hat aus den Jahren bis 1910 die eindrücklichsten Fotografien aus der Lebenswelt der frühen und mittleren Moorkolonisierung hinterlassen – die Motive sind oft mit denen der Maler identisch, und gerade in der bildlichen ‚Askese’ wird unverkennbar der verklärende, das ‚einfache Leben’ ästhetisch aufhöhende Blick des in den Zentren geschulten Künstlers deutlich. (Gerhard Wietek: Die Worpsweder Fotografien des Malers Georg Tappert von 1906-1909. Worpswede 1980)
Die Linie dieser Wahrnehmungsdisposition setzt sich über den wohl bekanntesten Fotografen des Worpsweder Raums, Hans Saebens, (Hans Saeberns/Otto Gothe: Backtorf. Bilder und Geschichten aus dem alten Teufelsmoor. Worpswede 1982) bis in die Gegenwart fort, etwa zu den radikal reduktionistischen Aufnahmen von Jürg Andermatt. (Teufelsmoor. Bremen 1976) Immerhin wird bei Saebens, Andermatt und anderen ambitionierten Fotografen gelegentlich ein ‚malerisches’ Detail aus den Restbeständen des naturbelassenen Hochmoors abgelichtet – immer aber auf die kompositorische Wirkung hin heraus geschnitten, nie im Interesse eines ‚ökologischen Dokuments’. Denn solche dokumentarische Fotografie des noch erhaltenen Naturraums Moor gibt es selbstverständlich inzwischen, abseits nahezu jeder Tendenz zur Ästhetisierung. Um den ‚garstigen Graben’ zwischen ästhetischem und ökologischem Interesse in der Abbildung des Moors zeigen zu können, müsste ich genauer in die Fotografiegeschichte und in die aktuellen Bildpräsentationen aus dem Moor hinein blicken, als ich es an dieser Stelle kann.
Ich hatte anfangs behauptet, die ‚ästhetische Entdeckung’ des Moors folge nicht nur chronologisch, sondern von ihrer kulturgeschichtlichen Ermöglichung her den frühen Stufen der Moorkolonisierung nach. In den bildlichen Darstellungen wird das an jener ‚Negation’ des unbearbeiteten Naturraums Moor erkennbar – Einzelheiten daraus können künstlerisch allenfalls dadurch angeeignet werden, dass eine kultivierende Ästhetik kompositorisch in sie hinein verlegt wird. Das kommt aber kaum vor, Motive gibt fast durchgehend die erschlossene und schon überformte Moorlandschaft ab.
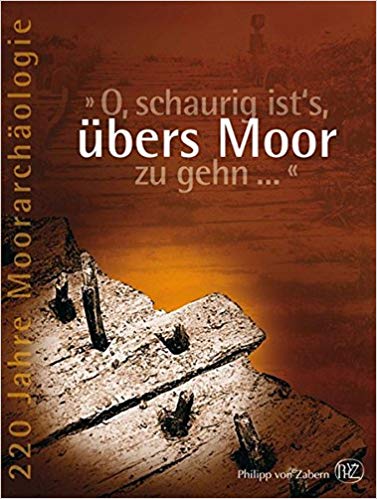
Damit bestätigen also die Künstler indirekt jenes ästhetische Verdikt, das Johann Georg Kohl stellvertretend für die ‚Kulturträger’ über die natürliche Erscheinung des Moors formuliert hatte. Inwiefern aber eine ästhetische Aufwertung des Landschaftsraums Moor überhaupt dessen ‚zivilisatorische Unterwerfung’ voraussetzt, bin ich anzudeuten noch schuldig. Ich will das zum Schluss nur mit dem Hinweis auf eine kulturgeschichtliche Traditionslinie der Moorwahrnehmung andeuten, die bisher gar nicht zur Sprache kam. Es ist die Jahrtausende andauernde Linie einer Erfahrung des lebensfeindlichen und bedrohlichen Naturraums Moor. Wir können sie in der Frühzeit erahnen an den Praktiken von Ritualmord, Opferung oder Hinrichtung im Moor, auch an der Funktion des Moors für das bewahrende Versenken von Kult- und Wertgegenständen, wie wir es etwa aus dem Nydam-Moor in Südjütland kennen. Wir können sie erschließen aus der Bedeutung archäologisch freigelegter Bohlenwege durch Moore, und wir können sie fassen in den zunächst sehr seltenen Textzeugnissen über die existenziellen Gefahren im Moor. (Mamoun Fansa/Frank Both (Hg.): „O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehn“ 220 Jahre Moorachäologie. Oldenburg 2011)
Wenn Elemente aus dieser Erfahrungskonstante dann aber im 19. Jahrhundert literarisch genutzt und überhöht werden, setzt dies bereits das Bewusstsein des zivilisatorischen ‚Siegs über das Moor’ voraus. Man kann das an den vergleichsweise wenigen Texten sehen, die wir dazu in der künstlerisch ambitionierten, deutschsprachigen Literatur haben. Ich deute das zum Schluss nur noch mit kurzen, groben Hinweisen am wohl berühmtesten Moorgedicht der Literatur des 19. Jahrhunderts an, dem Poem ‚Der Knabe im Moor’ von Annette von Droste-Hülshoff (1841). Entscheidend unter den hier verhandelten Gesichtspunkten ist an diesem Text, dass eine Literatin, die aus ihrer westfälischen Heimat den Erfahrungsraum Moor allenfalls peripher kennt, ein ‚Erlebnis’ fiktiv ausgestaltet, das eigentlich nur noch Zitat ist.
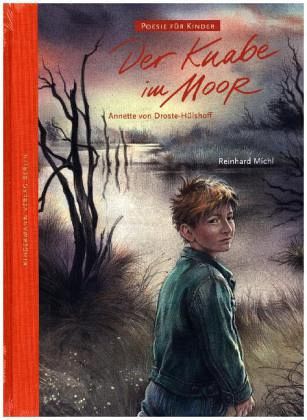
Annette von Droste-Hülshoff: Der Knabe im Moor
O schaurig ist’s übers Moor zu gehen,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt,
O schaurig ist’s übers Moor zu geh,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche.
Fest hält die Fibel das zitternde Kind
Und rennt als ob man es jage;
Hohl über die Fläche sauset der Wind –
Was raschelt drüben am Hage?
Das ist der gespenstige Gräberknecht,
Der dem Meisater die besten Torfe verzecht;
Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind!
Hinducket das Knäblein zage.
Vom Ufer starret Gestumpf hervor,
Unheimlich nicket die Föhre,
der Knabe rennt, gespannt das Ohr,
Durch Riesenhalme wie Speere;
Und wie es rieselt und knittert darin!
Das ist die unselige Spinnerin,
Das ist die gebannte Spinnlenor’,
Die den Haspel dreht im Geröhre!
Voran, voran, nur immer im Lauf,
Voran als woll’ es ihn holen;
Vor seinem Fuße brodelt es auf,
Es pfeift ihm unter den Sohlen
Wie eine gespenstige Melodei;
Das ist der Geigenmann ungetreu
Das ist der diebische Fiedler Knauf,
Der den Hochzeitheller gestohlen!
Da birst das Moor, ein Seufzer geht
Hervor aus der klaffenden Höhle;
Weh, weh, da ruft die verdammte Margret:
„Ho, ho, meiner armen Seele!“
Der Knabe springt wie ein wundes Reh,
Wär’ nicht ein Schutzengel in seiner Näh’,
Seine bleichenden Knöchelchen fände spät
Ein Gräner im Moorgeschwele.
Da mählich gründet der Boden sich,
Und drüben, neben der Weide,
Die Lampe flimmert so heimatlich,
Der Knabe steht an der Scheide.
Tief atmet er auf, zum Moor zurück
Noch immer wirft er den scheuen Blick:
Ja, im Geröhre war’s fürchterlich,
O schaurig war’s in der Heide!
(Annette von Droste Hülshoff: Gesammelte Schriften, Bd. 1, Stuttgart 1879, S. 115f) – hier rezitiert von Fritz Stavenhagen:
Für die Autorin wie für ihre Leserschaft ist der Glaube, der gefährliche Naturraum Moor sei Heimstatt der Untoten und deren Präsenz bedrohe den Menschen, der hindurch muss, längst erledigt, als Aberglaube allenfalls des ‚unverständigen Volks’, dessen Katalog von Spukfiguren vorgeführt wird. Realgeschichtlich ist dieser tatsächlich für die Menschen einmal riskante Naturraum ja zu jener Zeit so weit zurück gedrängt, dass eben niemand mehr hindurch muss– die Gefährdung wird Schauer evozierendes Zitat.
Wie wenig es um den realen, noch wenig bearbeiteten und partiell tatsächlich gefährlichen Naturraum Moor geht, lässt sich auchg daraus ersehen, dass die Dichterin im Text umstandlos Moor und Heide gleichsetzt: Zwei physisch und naturräumlich völlig verschiedene Landschaften schieben sich gleichsam ineinander, weil sie beide historisch dem gleichen, mit der Kultivierung des ‚Ödlands’ etablierten Wahrnehmungsimperativ unterliegen, nämlich eben ödes, wildes, noch lebensfeindliches Land zu sein, das ‚gefahrlos’ erst dann erlebt – und in der ästhetisierenden Darstellung vermittelt – werden kann, wenn seine ‚Bezwingung’ nicht mehr in Frage steht.
Dieser ästhetisierende Umgang mit einer historisch ‚erledigten’ Erfahrung des Moors in seiner ursprünglichen Form setzt sich in der popularisierenden Literatur fort bis zu den Moor-Romanen der völkisch-nationalistischen Autoren, wo das ‚heroische Bestehen der starken Menschen’ im Gefährdungsraum Moor unmissverständlich rassistische Töne in politischer Absicht bekommt und zur Legitimation des ‚archaischen Ursprung’ eines vorgeblich überlegenen Menschentyps dienen soll. (vgl. Emigholz, s.o., S. 169ff)
Ich schließe mit einer etwas gewaltsamen und sicher provokativen Folgerung und Weiterung: Auch ein ökologisch motiviertes Interesse an den mehr oder weniger großen Restbeständen natürlicher Moore setzt, zwar nicht konkret-räumlich, aber im geschichtlich geformten Bewusstsein, die zivilisatorische Beherrschung der Moore voraus. Nur wer existenziell nicht mehr durch den Naturraum Moor gefährdet und nicht mehr auf eine lebenspraktische ‚Auseinandersetzung’ mit ihm angewiesen ist, kann den scheinbar ‚zweckfreien Wohlgefallen’ am Ökosystem Moor entwickeln. Das ästhetische und das ökologische Interesse gehen sozialgeschichtlich auf die gleiche Wurzel zurück, auf die ‚Freisetzung’ dieses Interesses von der praktischen Naturaneignung, was allemal eine gelungene und sichernde Naturunterwerfung voraussetzt.
In diesen Entstehungsgrund ist das Doppelgesicht unseres neuzeitlichen Naturverhältnisses unaufhebbar eingelassen: Die ‚bürgerliche’ Wertschätzung vermeintlich ursprünglicher Natur aus ästhetischen und ökologischen Motivationen stellt die Rückseite jener instrumentellen Naturaneignung dar, deren Effekte sie beklagt, ohne die sie aber nicht zu haben ist. Ob eine ‚Inwertsetzung’ naturbelassener Areale mit einer Ökonomie des Klimaschutzes an dieser Dialektik tatsächlich Wesentliches ändert, wäre zu diskutieren. Wie dringlich dies auch politisch geboten ist, führt uns die aktuelle Realgeschichte der Moore vor Augen – nicht nur der immer noch fortschreitende Abbau dieser unfassbar großen Speicher von Kohlendioxyd und Methan, sondern nun auch die großflächigen Brände der schier endlosen subpolaren Moore vor allem in Sibirien, mit denen Moor nun zu einem Gefahrenpotenzial ganz anderer Art wird, als es die ‚öden und wüsten’, unkultivierten Naturräume vorzeiten einmal für die Menschen sein mochten, die an ihren Rändern lebten.

- Ludwig Fischer, geboren in Leipzig, aufgewachsen in Oldenburg (Oldb), Studien- und Berufsjahre in Tübingen, Basel, Zürich, Stockholm, Berlin. Lehrte als Ordentlicher Professor von 1978 bis 2004 Literaturwissenschaft und Medienkultur an der Universität Hamburg, veröffentlichte zahlreiche Bücher und Aufsätze zur deutschen Literatur, zu Film und Fernsehen, zum Naturverständnis, zur Kultur- und Regionalgeschichte. Gedichte, Essays, Kurzgeschichten in Anthologien, Jahrbüchern, Zeitschriften. Mehrere Lyrikbände, zuletzt ‚Folgelandschaften’ (2015). Bei Matthes & Seitz Berlin ‚Brennnesseln. Ein Portrait’ (2017) und ‚Natur im Sinn. Naturwahrnehmung und Literatur’ (2019) – hier nebenan von Alf Mayer besprochen.











