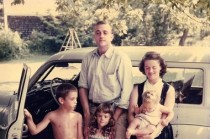„Je wahnsinniger ich war, desto mehr Spaß macht es, sich daran zu erinnern.“
„Je wahnsinniger ich war, desto mehr Spaß macht es, sich daran zu erinnern.“
Mark Vonnegut, das erste Kind des amerikanischen Autors Kurt Vonnegut, wurde 1947 geboren, zwei Jahre, nachdem der Vater aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen war, wo Kurt Vonnegut als amerikanischer Kriegsgefangener die Bombardierung Dresdens miterlebt hatte. In Vonneguts Werk ist die Dresden-Erfahrung in jedem Roman ab „Die Sirenen des Titan“ präsent, bis der Autor sie in „Schlachthaus Fünf“ endlich zum Hauptmotiv erkären kann. Vonneguts Familie wiederum, erst mit drei, und nach dem Tod von Schwester und Schwager mit sechs Kindern, ist regelmäßig Gegenstand der Vorwörter in seinen Romanen. Mark kommt als Erwachsener, als Kinderarzt, in den Vorwörtern zu späteren Büchern mehrfach vor. Dass Mark selbst zwei Bücher geschrieben hat, allerdings keine Romane, wird von Kurt Vonnegut gerne erwähnt. Eins davon ist jetzt unter dem Titel „Eden Express“ erstmals auf Deutsch erschienen.
Als Mark Vonnegut 22 Jahre alt und gerade das Studium am Quäker-College Swarthmore beendet hatte, zog er nach British Columbia in Kanada, um in den Wäldern mit seiner damaligen Freundin und weiteren Freunden eine Landkommune zu gründen. Es war Ende der 1960er. Der kleinen Gruppe, die sich alle aus dem College kannten, ging es darum, den Grundstein für eine bessere Welt zu legen. Das Unternehmen stand damit ganz und gar im Einklang mit dem Zeitgeist. 1975 wird Mark Vonnegut dazu schreiben:
„Im Rückblick finde ich am erstaunlichsten, wie wenig Widerstand es vonseiten unserer Eltern, Professoren oder sonst irgendjemandem gab. Die vereinzelten Bedenken, die zur Sprache kamen, waren vage, entschuldigend und meistens murmelnd vorgetragen worden. Ich glaube, die Kennedys, Martin Luther King, der Krieg und eine ganze Reihe anderer Unerfreulichkeiten hatten so verheerend in den Gehirnen aller gewütet, dass es zumindest einen Versuch wert zu sein schien, die Kinder nackt in den Wald zu schicken, damit sie dort eine neue Gesellschaft aufbauten.“
Hübscher und seltsamer Wunsch nach Widerspruch. Die „Kinder“ waren schließlich keine Kinder, sondern Anfang 20-Jährige, Vertreter einer geburtenstarken Generation, deren Stimme sich seit Jahren gegen jeden Einspruch des Systems (zu dem sämtliche Erziehungsberechtigten gehörten) lautstark verwehrte, und zudem Sprösslinge mittelständischer Familien, auf deren Unterstützung sich zurückgreifen ließ, wenn das Experiment schiefging. (Was es im Fall von Mark Vonnegut auch tat.)
Nicht lange nach Inbetriebnahme der Farm fing er an Stimmen zu hören und in seltsame Zustände zu geraten. Er aß kaum noch und schlief noch weniger, verbrachte Stunden und Tage auf dem Dach der Farm in meditativer und extrem verlangsamter Kontemplation der Natur, geriet in euphorische Glücks- und panische Angstzustände, und als sein Wahnsinn auch für die Freunde nicht mehr zu übersehen war, dauerte es dennoch noch eine ganze Weile, bis er in professionelle Behandlung kam. Schließlich gingen die Überzeugungen der Hippie-Generation (nach R.D. Laing) dahin, dass „Geisteskrankheit eine gesunde Reaktion auf eine kranke Gesellschaft darstellt“, dass psychiatrische Kliniken in erster Linie das Ziel verfolgten, aus diesen „gesunden“ Kranken systemkonforme Elemente zu machen. „Einer flog übers Kuckucksnest“ ist der Film zum Glauben.
Es sind seine Wege in den Wahnsinn und der nicht ganz einfache Weg aus ihm heraus, die Mark Vonnegut in seinem autobiografischen Buch „Eden Express“ beschreibt.
Und warum sollten wir das heute noch lesen, warum wird „Eden Express“ 2014, knapp 40 Jahre nach Ersterscheinung ins Deutsche übersetzt? Nicht wegen des Inhalts, der in erster Linie Betroffene und ihre Angehörigen interessieren dürfte, und dem selbst dann eine gewisse Patina anhaftet. So spricht man, vermute ich, heute nicht mehr über Geisteskrankheit, man könnte beinah sagen, so „funktioniert“ Geisteskrankheit heute nicht mehr – als sei auch der Zustand der Umnachtung, wie die Träume in ihrer Nachbearbeitung, abhängig von den Moden und der Denkweisen der Zeit, in der er stattfindet. Mark Vonnegut entdeckt in seinem Wahnsinn eine Antwort auf die Krankheit der Welt: Sexualität in all seinen sanften und heilenden Formen. In seinen philosophisch-wirren Kontemplationen zur Natur, die in den Krankheitsphasen eine Rolle spielen, sind die Autoren immer präsent, die damals, Anfang der 1970er, zur Pflichtlektüre gehörten. Und selbst während des Protokollierens scheint sich der Autor, noch nicht lange von seiner Geisteskrankheit genesen, weiterhin nicht ganz sicher, ob im Wahnsinn nicht doch auch ein Funken Erleuchtung lag… In dem Buch, das ehrlich und erschöpfend ausführlich den Zuständen der Krankheit folgt, lebt zwischen den Zeilen auch eine leise Hoffnung, diesen Funken (wieder) zu finden.
„Die meisten Leute glauben, mich an mein Verrücktsein zu erinnern, müsse schmerzlich sein. Das stimmt nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Erinnerungen an mein Verrücktsein eine beinahe sinnliche Freude hervorrufen. Je wahnsinniger ich war, desto mehr Spaß macht es, sich daran zu erinnern.“
Das Kalkül des Verlags dürfte einfach sein (und auch aufgehen): Wir lesen das Buch des Sohnes Vonnegut, weil uns der Vater Vonnegut darin interessiert. Der taucht, anfänglich, gar nicht weiter auf, wird aber mit zunehmender Krankheit präsenter. Am Ende wird er es sein, den die Freunde zu Hilfe rufen, und der Mark in die Klinik fährt. Davor verlangen die Stimmen von Mark Vonnegut, sich von dem Vater abzuwenden, dann reden sie ihm ein, er habe sich umgebracht und keiner wolle ihm davon erzählen, und irgendwann redet der Vater selbst, als Stimme im Kopf, mit dem Sohn:
„Hey Mark, bist du je auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht diesen Text schreibe?“
„Hey, Paps, bist du je auf die Idee gekommen, dass das nicht der Fall ist?
Was ich meine, Mark, ist, denkst du, ich wäre als Schriftsteller gut genug, um das zu schreiben, was du durchmachst?“
„Ehrlich gesagt nicht, Paps. Niemand könnte das, glaube ich.“
„Nun, Mark, da hast du womöglich recht. Es würde mir nicht einmal ansatzweise gelingen, das zu schreiben, das du erlebst, nicht einmal ansatzweise.“
An dieser Stelle würde man sich als Leser gerne kurz abwenden, wenn das mit dem Abwenden beim Lesen ginge – allzu nackt kommt der Wunsch daher, den berühmten Vater zu übertrumpfen, ihn klassisch ödipal, und auch noch mit seinem Einverständnis, zum Alteisen zu relegieren.
Kein Zufall, dass die Stelle in einem Zusammenhang auftaucht, in dem Mark Vonnegut bei einem Fan seines Vaters untergekommen ist. Solche Fans gab es unter seinen Bekannten viele. Kurt Vonnegut war Anfang der 1970er längst eine Ikone der Hippiegeneration, eine Auszeichnung nebenbei, die dem Sci-Fi-Autor so unangenehm war wie die Schublade „Sci-Fi“ selbst. Dass Kurt Vonnegut in der Zeit, als Mark Vonnegut diesen Rückblick in die Krankheit schrieb, seine Frau und Marks Mutter verlassen hatte, dass er sie davor schon, als Mark, seine Schwestern, und einige der Neffen noch zuhause lebten, während einer mehrjährigen Abwesenheit (als Lehrbeauftragter im Writers-Workshop von Iowa) mit einer anderen Frau betrogen hatte, – dass Jane Vonnegut unter der späteren Trennung litt, was Mark, obwohl er da schon ausgezogen war, wusste – nun, es ist müßig, sich laienhaft auszumalen (obwohl es beim Lesen hilft), welche Gründe es für den Anfang Zwanzigjährigen vielleicht auch noch gegeben hat, den Vater weg- oder zumindest kleinmachen zu wollen.
Die Mutter taucht in „Eden Express“ kaum auf. In einem Buch, das Jane Cox Vonnegut Jahre später über ihre Familie schrieb, „Angels without Wings“, vermutet sie, eine eigene Veranlagung zur verschobenen Realitätswahrnehmung sei auf Mark übergegangen. Mark Vonneguts Buch, und das wusste er vielleicht schon, als er es Anfang der 1970er schrieb, ist heute nicht zuletzt ebenfalls ein Puzzlestein im Komplex der Familie Vonnegut, die der Vater in fast allen Vorwörtern zu seinen Romanen so gerne, und mit so guter Hoffnung, seinen Lesern als wesentlicher Teil seiner selbst nahebrachte.
„Schizophrenie“ nennt Mark Vonnegut im Vorwort von 1975 die Krankheit, die ihn erfasst hat, und die, wie er festhält, biochemische, also genetische Ursachen hat. In seinem Fall wurde sie mit der neuartigen und umstrittenen „Mega-Vitamintherapie“ bekämpft (später auch mit Gesprächstherapie, anderen Medikamenten und Elektroschocks), und ein Ziel seines Protokolls war es, diese Vitamin-Therapie und die biochemische Sicht auf die Krankheit als eine Art Heilslehre zu propagieren. In einem Nachwort von 2014 revidiert der Arzt, der Mark Vonnegut nun ist, diese Aussagen seines jüngeren Ichs. Die Verfeinerung der psychiatrischen Diagnosen lassen ihn vermuten, es habe sich eher um eine manische Depression als um Schizophrenie gehandelt. Die Mega-Vitamintherapie, stellt er fest, habe in seinem Fall geholfen, in ebenso vielen Fällen sei jedoch eine Heilung ohne sie zustande gekommen, in einigen Fällen auch mit ihr keine Besserung eingetreten. Vorwörter und Nachwort sind ein Beleg für die prozesshaften Veränderungen in der Einschätzung von (oder der Hilflosigkeit gegenüber) Geisteskrankheit, ihren Ursachen, ihrer Bekämpfung.
In einem Vorwort von 2002 zu „Eden Express“ fasst Kurt Vonnegut den Tatbestand in der ihm eigenen, nur scheinbar lapidaren Art zusammen: „Einige Leute haben den Sturz im Holzfass die Niagarafälle hinab überlebt. Andere nicht. Die Erschütterungen sind nicht ohne.“
Brigitte Helbling
Mark Vonnegut. Eden Express. Die Geschichte meines Wahnsinns (The Eden Express. A Memoir of Insanity. 1975). Aus dem Amerikanischen von Johann Christoph Maass. Berlin Verlag. Berlin 2014. Euro 19,99.
Hübscher Booktrailer von einem Fan des Buches: