 Vom Leben und vom Lernen
Vom Leben und vom Lernen
– Er hat gern gegessen, kräftig und gut. Er kochte die Spaghetti in frisch gewonnener Fleischbrühe und entkorkte dabei schon die erste Flasche. Er war ein ausdauernder Trinker, und seine Geschichten bei Tisch waren weitaus mehr als Anekdoten über die Freuden und Leiden eines freien Autors im getrennten und im vereinten Deutschland. Von Frank Göhre
Am 15. Dezember 2010 ist er gestorben – Peter O. Chotjewitz, der Pit. Der grandiose Erzähler und Chronist eines halben Jahrhunderts wurde 76 Jahre alt. Er hatte Krebs und er wusste, dass die ihm verbleibende Lebenszeit nur noch knapp bemessen war. Und so besuchte er in den letzten Monaten noch einmal einige der Orte, die für ihn wichtig gewesen waren. Er wollte seine Lebenserinnerungen schreiben, eine „Éducation sentimentale“ sollte es sein. Doch letztlich hatte er nicht mehr die Kraft dazu.
Der Freund und Kollege Jürgen Roth, Autor des hervorragenden Hörbuchs „Helmut Schmidt – Eine Revue in Originaltönen“, übernahm es, Pit an vier Tagen im September ausführlich erzählen zu lassen. Er zeichnete die knapp 30 Stunden auf, ließ die Bänder transkribieren, redigierte und ergänzte schließlich auch noch gemeinsam mit dem inzwischen Bettlägerigen das umfangreiche Manuskript.
Jetzt ist es als Buch erschienen, 363 eng bedruckte Seiten, unter dem schönen Titel „Mit Jünger ein’ Joint aufm Sofa, auf dem schon Goebbels saß“ (Zusammentreffen in der Villa Massimo, Rom).
Es ist kein chronologisch angeordneter Lebensbericht, vor allem aber keine behäbige oder gar eitle Rückschau wie die der Herren Grass und Raddatz. Chotjewitz ist in seinem „Nachlassbuch“ so frisch und frech wie seit jeher. Er wendet sich an seine beiden Töchter, beginnt sein Erzählen vom Leben und Lernen mit der Krankheit und den Besuchen bei den Ärzten. Schnell ist er dann bei seinen literarischen Anfängen in Berlin und Stuttgart. Nach und nach setzt sich das Bild eines der ersten deutschen Pop-Autoren zusammen. Mit „Die Insel – Erzählungen auf dem Bärenauge“ (1968) schaffte er es mit den zeitgleich erschienenen Romanen von Hubert Fichte („Die Palette“) und Rolf Dieter Brinkmann („Keiner weiß mehr“) sogar auf die Bestsellerlisten.
 Gewitzter Anarchist
Gewitzter Anarchist
Chotjewitz wurde vom Feuilleton bejubelt, bekam ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom und ließ sich vom Fotografen Gunter Rambow nackt ablichten („Roman – Ein Anpassungsmuster“). Allein um diese immer wieder unterbrochene und Seiten später neu aufgenommene Zeitspanne ranken sich zig ironische und zugleich aufschlussreiche Anmerkungen über den Zustand des damaligen Literaturbetriebs (der auch heute nicht grundsätzlich anders funktioniert). Chotjewitz steckte selbst mittendrin und hat ihn sich als gewitzter Anarchist so gut wie eben möglich zunutze gemacht. Seine Romane, Erzählungen und „Stereotexte“ der frühen Jahre sind geschickt montierte Collagen populärer Versatzstücke, gleich mehrfach verwertet in Anthologien und als Funkfeature.
Im „Deutschen Herbst“ 1977 aber rückte er als langjähriger Freund des RAF-Terroristen Andreas Baader ins Visier der Staatsschützer und galt fortan als unter scharfer Beobachtung zu haltender Sympathisant.
Chotjewitz verarbeitete diese Stimmung in dem Romanfragment „Die Herren des Morgengrauen“, das in der von Uwe Timm u. a. herausgegebenen „Autorenedition“ bei Bertelsmann erscheinen sollte. Bertelsmann verweigerte die Zustimmung zur Veröffentlichung, „und damit war die AE gestorben … ich erzähle das nur, um einige literaturpolitische Aspekte der späten siebziger und frühen achtziger Jahr dazustellen“.
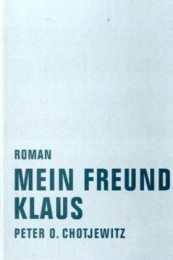 Unterwegs mit Borsalino und Gehstock
Unterwegs mit Borsalino und Gehstock
Dieser politische Background und die Haltung des Autors wird in jedem der sechzehn Kapitel deutlich, sei es beim „Satz vom Sitzfleisch“ (wie Bücher geschrieben werden) oder bei der „Erörterung zum Eurokommunismus“. Chotjewitz erzählt nie allein von seinen Stationen in Hamburg, Köln, Kassel und auf dem Land, von seinen langjährigen Italienaufenthalten in Rom und Florenz, den Frauen, den Freunden und Kollegen– immer verbindet er es mit Reflexionen über sein Schreiben und Tun, mit der Frage nach der Rolle eines engagierten Schriftstellers in unserer Zeit.
Die Lage der Nation ist nicht gerade der guten Laune dienlich (wann war sie das je hierzulande?), aber Chotjewitz wäre nicht der Chotjewitz, wenn er gejammert und sich gar selbst bemitleidet hätte. Er hat lieber geflucht und gespöttelt und sich bei allzu großem Frust einen edlen Dreiteiler in Weiß gekauft, dazu einen Borsalino und später auch noch den Gehstock mit silbernem Knauf. So trat er dann auf bei den Lesungen aus seinem letzten Buch „Mein Freund Klaus“.
Es ist die Spurensuche nach einer zentralen Person der RAF-Jahre, nach dem Anwalt Klaus Croissant. Es ist ein Doppelporträt und enthüllt gleichermaßen den RAF-Anwalt in all seinen Facetten wie auch den fröhlich anarchistischen Bohemien.
Der Literaturbetrieb hat das, meiner Ansicht nach, beste Buch weitgehend ignoriert. Zu hoffen aber ist, dass Chotjewitz’ „Éducation sentimentale“ Anlass gibt, seine Romane und Erzählungen (im Verbrecher Verlag) neu und möglicherweise zum ersten Mal zu lesen.
Frank Göhre
Peter O. Chotjewitz/Jürgen Roth: Mit Jünger ein’ Joint aufm Sofa, auf dem schon Goebbels saß. Éducation sentimentale. Wetzlar: Büchse der Pandora Verlag 2011. 363 Seiten. 28 Euro.











