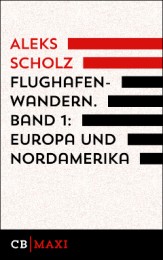»Flughafenwandern ist der Versuch, den Flughafen zu transzendieren, das große, störrische Ding, ihn aus den Angeln zu heben. Was bleibt übrig, wenn man den Kern des Flughafens, seinen Daseinszweck, ignoriert?«
»Flughafenwandern ist der Versuch, den Flughafen zu transzendieren, das große, störrische Ding, ihn aus den Angeln zu heben. Was bleibt übrig, wenn man den Kern des Flughafens, seinen Daseinszweck, ignoriert?«
Das Problem mit Flughäfen ist wohl, dass wir nicht dort sein wollen, sondern woanders, und Flughäfen sind nur die Trittsteine in diese andere Welt. Es sind sonderbare Zwischenorte, die sich nicht so verhalten, wie wir es gewohnt sind, Orte, die einen einsaugen, nur um einen am anderen Ende wieder auszuspucken. Dabei geben sie sich große Mühe, möglichst geheimnisvoll zu wirken.
Flughäfen sind so unlogisch wie Luftschokolade. Überall öffnen sich sinnlose Höhlen. Parkgaragen und Autobahnen verknoten sich in der vierten Dimension. Busse fahren ins Niemandsland. Es gäbe so viel zu verstehen, aber Flughäfen haben kein Interesse daran, verstanden zu werden, im Gegenteil. Flughäfen behandeln uns wie weiße Mäuse in einem seltsamen weltumspannenden Tierversuch.
Aus der Gefangenschaft zu entkommen, die Struktur der Flughäfen zu erkunden, ihre Topographie zu kartieren, ihre Funktion zu enthüllen, zu überleben in einer inhumanen Umgebung, das ist die Aufgabe des Flughafenwanderers.
»Wie in einem mittelalterlichen Abenteuerepos eilt der Held von Schauplatz zu Schauplatz und bekämpft das drachenhafte Techno-Imaginäre … in seinem erfrischend klugen, genresprengenden Text.« FAZ, Oliver Jungen
Beneath the fabricating and universal writing of technology, opaque and stubborn places remain.
Michel de Certeau
Dublin Airport
Die Dubliner Flughafenrunde. Ich bin sie viele Male abgelaufen, bei Regen, Schnee, Sonne, Kälte, Nebel, Dunkelheit. Terminal 1, Terminal 2, altes Terminal, zurück. In Irland, wo das Wetter an einem Tag mit dem am Tag davor scheinbar nichts zu tun hat, wo jeder Tag ein neues Kunstwerk ist, das aus Wolken, Wind, Licht und Niederschlag zusammengewürfelt wird, wo es keinen kausalen Zusammenhang zwischen heute und morgen gibt, benötigt man nicht viel Raum, um das Land kennenzulernen. Eine kurze Spazierrunde genügt völlig. Man könnte auch an derselben Stelle sitzen bleiben und auf die kommenden Tage warten. Das Neue liegt in der Zeitdimension.
Dublin drängt sich auf als Ziel für einen Spaziergang an einem regnerischen Sonntag, egal ob man in Irland, Kroatien oder Finnland wohnt. Durch die Proliferation der Billigflieger wurde der Flughafen von Dublin zu einer Art Zentrum Europas. Er ist einfach zugänglich und für den Wanderer weitestgehend harmlos, aber er ist auch nicht so klein, dass man in weniger als einer Stunde alle Optionen ausgeschöpft hat. Mit anderen Worten: Er ist perfekt. Mit den schnellen Verbindungen von Boston und Chicago kann man sogar über Tagesausflüge aus Amerika nachdenken.
Die Drei-Terminal-Tour ist der klassische Spaziergang in Dublin. Auf der gesamten Runde profitiert man von breiten Gehwegen und teilweise doppelspurigen Radwegen. Radwege, was für ein Luxus. Wer fährt schon Fahrrad auf einem Flughafen? Man beginnt vor Terminal 1, mehr als drei Jahrzehnte lang die einzige funktionierende Abflughalle. Es sieht aus wie ein großes, verunstaltetes Parkhaus, und wer glaubt, dass man Parkhäuser nicht verunstalten kann, der sehe sich Terminal 1 in Dublin an und denke noch einmal genau darüber nach. Von dort läuft man schnurgerade die Straße herunter, grob in Richtung Südosten zum Terminal 2, ein großes, gläsernes Ding, das wie ein riesiges Pantoffeltierchen kurz vor der Zellteilung wirkt. Die Straße verläuft direkt unter der Stelle hindurch, an der sich die beiden Zellhälften voneinander ablösen.
Wenn es dämmert, wird im Straßentunnel unter Terminal 2 das Licht eingeschaltet. Das Licht ist blau. Mehrere Minuten lang läuft man durch ein herrliches blaues Licht. Der Tunnel wirkt als Trichter für den Wind. Gemäß den Strömungsgesetzen nimmt die Windgeschwindigkeit an Engstellen zu, ein Effekt, der auch für das Funktionieren von Flugzeugen bedeutend ist, weshalb der Tunnel aus schwachem Wind starken macht und aus starkem Wind orkanartigen, ungefähr wie auf dem Südsattel des Mount Everest auf 7906 Meter Höhe, nur ohne Sauerstoffmangel. Dublin liegt am Meer, und starker Wind ist nicht selten. Wenn man Glück hat, leuchtet außerdem noch die rot angelaufene Sonne in den Tunnel – an Sommerabenden von der einen Seite, an Wintermorgen von der anderen.
Am Ende des Tunnels führt eine Ladung Treppen hoch zur Vorderseite von Terminal 2. Dort kann man noch ein wenig das Pantoffeltierchen streicheln, bevor man die Erforschung des Geländes fortsetzt. Ausschweifende Routen führen durch die Ostzone des Flughafens, die vorwiegend zugestellt ist mit Parkplätzen, Hotels, Büros. Viele angenehme Stunden kann man dort drüben im Niemandsland verbringen. Am Ende steht man womöglich an dem großen Kreisverkehr, der den Flughafen am Ostende abschließt und direkt zur M1 führt, eine von dreieinhalb Autobahnen auf der gesamten Insel. Noch ein paar Stunden weiter nach Osten abgeschweift und man erreicht die Irische See.
Die klassische Runde jedoch führt in eine andere Richtung. Von der Bushaltestelle vor Terminal 2 ein paar Hundert Meter nach Norden, vorbei an der Flughafenkirche, bis man auf den gegenüberliegenden Schenkel der U-förmigen Hauptstraße trifft. Dann läuft man in Richtung Westen und in einer geraden Linie auf das alte Terminal zu. Von dort sind es nur noch ein paar Meter zurück zum Ausgangspunkt. Auf dem gesamten Weg hat man gute Ausblicke auf das seltsame Terminal-Trio: Terminal 1 als lebende Ruine, Terminal 2, das von vorn aussieht, als käme es aus derselben Fabrik, die auch Raumschiff Enterprise hergestellt hat, und schließlich das alte Terminal, ehemals die Drehscheibe des Flughafens, der Dreh- und Angelpunkt, heute eine Fußnote und außer Betrieb. Ein und dieselbe Funktion, drei radikal unterschiedliche Implementierungen.
Bisher verschwiegen wurde das gut versteckte vierte Terminal. Es wurde verschwiegen, weil es zu klein ist, um sofort als Terminal erkennbar zu sein. Heute wirkt das in den 1950er Jahren gebaute kleine »North Terminal« eher wie eine in den 1970er Jahren erbaute Schwimmhalle. Das Gebäude stellte man rechts neben das alten Terminal, um mit der rapide steigenden Zahl an Passagieren klarzukommen. Dieser Plan war wie so viele Flughafenpläne langfristig nicht sehr erfolgreich; die Unmengen an Flugreisenden überrannten auch das »North Terminal«. Heute dient es vorwiegend als interessantes Anschauungsobjekt für Wanderer.
Wenn man mit der Runde fertig ist, kann man sich selbst zu einem Strawberry Sunrise von der Saftbar einladen und zurückfliegen, nach Rom oder Moskau oder wo auch immer man hergekommen ist.
Toronto Pearson International
Ich kann nicht genau festlegen, wann es passiert ist. Aber irgendwann rings um 2010 war Flughafenwandern kein Spaß mehr. Vorbei die Jahre, in denen ich den Layover in Los Angeles aus Mangel an Alternativen mit sinnlosem Herumlaufen verbrachte. Das Ticket zum Weiterflug im Rucksack. Killing time. Vorbei die Jahre, in denen ich in einem Blog, der Keimzelle dieses Buches, stolz vermeldete, einen Meditationsraum in Heathrow untersucht zu haben. Es ging bis dahin um Zeitvertreib, nichts anderes, ein laszives Herumhängen auf Parkdecks, Beine vertreten. Natürlich auch die Freude daran, etwas völlig Bizarres zu tun. Und damit später prahlen zu können. Einen Wanderführer für Flughäfen zu schreiben. Eine absurde, sinnlose Idee. Flughafenwandern war ein dekadenter Spaß.
Diese Zeiten sind vorbei. Wenn ich heute Flughäfen betrete, dann mit heiligem Ernst. Mittlerweile beschränkt sich Flughafenwandern nicht mehr auf zufällige Zwischenstopps. Ich plane meine Expeditionen. Ich buche Flüge so, dass eine unkomfortabel lange Lücke entsteht, die ich füllen muss. Ich begebe mich viele Stunden vor der angegebenen Abflugzeit zum Flughafen. Ich streiche die Witze aus den Flughafenberichten. Der Spaß ist vorbei.
Toronto, Ontario, Kanada. Fünftausend Kilometer entfernt von zu Hause. Es ist Samstag, Ende November, es könnte auch Anfang Dezember sein. Ich sitze in der U-Bahn in Richtung Flughafen. Mein Plan: Den Flughafen zu erwandern. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Es ist die erste Flughafenexkursion, bei der ich keinerlei Absichten hege, den Flughafen so zu verwenden, wie es die Flughafenerschaffer vorgesehen hatten, zum Abfliegen oder Landen nämlich. Es ist der Versuch, den Flughafen zu transzendieren, das große, störrische Ding, ihn aus den Angeln zu heben. Was bleibt übrig, wenn man den Kern des Flughafens, seinen Daseinszweck, ignoriert?
»Pearson International« heißt der große Flughafen Torontos. Er trägt den Namen von Lester B. Pearson, einem ehemaligen kanadischen Premierminister, außerdem der Mann, der während der Suezkrise von 1957 die Welt gerettet hatte. So jedenfalls steht es in der Begründung für seinen Friedensnobelpreis. Als Student in Oxford schrieb er britische Eishockeygeschichte. Das englische Team mit Pearson demütigte den Rest Europas. »Herr Zig-Zag« nannten ihn die deutschen Zeitungen für seinen Stil auf dem Eis. Als Politiker brachte er die Vierzig-Stunden-Woche nach Kanada, den Vietnamkrieg jedoch nicht. Einen monströsen Flughafen nach Pearson zu benennen, ist eindeutig zu wenig. Das finde nicht nur ich, weshalb außerdem noch ein Platz, ein Park, mehrere Straßen, zahlreiche Gebäude und Institutionen sowie mindestens 13 Schulen nach ihm benannt sind. Und ein mittlerweile eingestelltes jährliches Testspiel zwischen den Profi-Baseballteams aus Toronto und Montreal.
Der Expressbus nach Pearson International wiederum heißt »Airport Rocket«. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Bus mit der Routennummer 192. Er ist bemalt mit roten Streifen, genau wie jeder andere öffentliche Bus in Toronto. Einziger Unterschied zu normalen Bussen sind die fehlenden Haltestellen zwischen Kipling Avenue und Flughafen; er fährt einfach durch. Raketen machen auch keinen Zwischenstopp.
Schon Kilometer bevor die Rakete auch nur in die Nähe des Flughafens gerät, ist seine Anwesenheit nicht zu leugnen. Die kleinskaligen Strukturen der Vororte Torontos, ordentlich in Rechtecke eingeteilt und mit Lagerhallen, Industrie, Drive-ins und Tankstellen aufgefüllt, vereinigen sich zu großen Strömen und weisen überdeutlich auf eine gewaltige Struktur hin. Als würde man in einem Paddelboot auf einem zunächst friedlichen See in die Nähe eines großen Wirbels geraten, der alles verschlingen wird. Noch ein paar Minuten später und die Umgebung besteht nur noch aus Hotels, Bürogebäuden und Parkhäusern, die schmarotzerhaft am Rande des Flughafenwirbels existieren. Der Wirbel wird den Flughafenbus einsaugen, ein paarmal im Kreis drehen und dann wieder ausspucken.
Und mich zwischendurch ausladen. Da stehe ich, verlassen, der einzige Mensch weit und breit ohne Plan, ohne Ziel. Mit anderen Worten: ohne Ticket. Ich bin ein Aussätziger. Ich bin nackt, alle starren mich an. So kommt es mir vor. Ich brauche eine Identität. Ich muss mich in irgendetwas verwandeln, das ich nicht bin, ein Leben wählen, das an diesen Ort passt. Sonst werde ich umkommen, wahrscheinlich. Ich brauche eine Maske, die verhindert, dass mich der Flughafen als Betriebsstörung erkennt.
Das sind nicht nur theoretische Erwägungen. November 2011, Chicago O’Hare, die Polizeisirene wird nur kurz angetippt, die Augenbrauen des Beamten am Steuer nur leicht hochgezogen, aber klar ist doch, dass der Gehweg am Rande des Highways in Wahrheit kein Gehweg ist. Februar 2008, New York JFK, nur wenige Schritte nach Betreten des Parkhauses dröhnt eine Stimme aus der Kabine am anderen Ende der Betonstruktur, eine Stimme, die zu einer großen, breiten, tiefen, dunkelhäutigen Frau gehört, die mich Sweetheart nennt und des Feldes verweist. Die Auseinandersetzung mit uniformierten Wesen, mit eingebildeten und echten Risiken, gehört zum Alltag des Flughafenwanderers.
Darum braucht man Lügen. Oder sagen wir Legenden, alternative Biografien, die einwandfrei die Anwesenheit der eigenen Person auf dem Flughafen erklären. Zum Beispiel: Ich bin auf dem Flughafen, um Freund X abzuholen, der im Flug Y ankommt, und ein wenig zu früh dran. Oder: Ich bin auf dem Weg zu meinem Auto, das hier irgendwo steht. Durchsichtig mögen diese Lügen sein, aber kombiniert mit einem harmlosen Gesicht und der Bereitwilligkeit, sofort umzukehren, sind sie völlig ausreichend. Der Flughafen stellt keine besonders hohen Ansprüche.
Eine Legende gilt nur in einem bestimmten Kontext. Sie funktioniert nur in Kombination mit passenden Verhaltensweisen. Die Legende vom Freund X im Flug Y ist brauchbar, wenn man sich gerade in unmittelbarer Nähe eines Terminals herumtreibt, und sie erfordert einen schlendernden, ziellosen Gang, am besten kombiniert mit längerem Herumsitzen oder -stehen. Freund X will von einem Schlenderer abgeholt werden, einem Flaneur. Die Autolegende andererseits funktioniert am besten in Parkgaragen und in Verbindung mit einem zügigen, zielstrebigen Gang in irgendeine Richtung. Marschieren statt schlendern, stalken statt flanieren. Der englische Autor Iain Sinclair beschreibt den entscheidenden Unterschied so: »The stalker is a stroller who sweats, a stroller who knows where he is going, but not why or how.«
Der Flughafenwanderer, insbesondere wenn er ohne Ticket unterwegs ist, benötigt ein Arsenal an Legenden. Er muss in Abhängigkeit von der Umgebung ständig seine Legende und gleichzeitig Gangart und Verhalten verändern. Er wird zu einem Chamäleon, das je nach Situation zwischen erfundenen Weltbildern hin- und herschaltet. Die Mehrzahl von uns betreibt genau dasselbe ständig, ohne Flughafen, auf dem Weg vom Büro nach Hause, oder von der Kirche zur Trinkhalle, oder vom Kinderzimmer zum Schlafzimmer. Flughafenwandern ist in erster Linie eine Übung in Identitätserfindung.
Aber auch Legenden stoßen an ihre Grenzen. Zum Beispiel die Stalker-Legenden, die Zielstrebigkeit erfordern. Was ist das Ziel? Woher nehmen? Wohin stalken, wenn man nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve geschieht? Was ist ein Stalker schon ohne Ziel? Stalken ohne Ziel ist nicht einfach, man ergänzt die Legende um die Behauptung, vergessen zu haben, wo man hin will, wo sich das Auto befindet, wo das Terminal ist. Noch eine Stufe weiter kommt man zur universell einsetzbaren »Ich habe mich wohl verlaufen«-Legende, das Vortäuschen des Verirrtseins, die Krönung aller Legenden, das schwierigste und zugleich atemberaubendste Kunststück des Flughafenwanderns. Es erfordert langjährige Praxis im tatsächlichen Verirrtsein und Testreihen, bei denen man sich selbst beim Verirren aufmerksam beobachtet. Spiegelkabinette sind speziell zum Training dieser Fähigkeit erbaut worden.
Es gibt Situationen, in denen sich keine glaubhafte Legende finden lässt. Die Sonne steht hoch über Los Angeles, die Zeit scheint stehen geblieben, die Palmen wehen sanft im Wind, und man dreht Runde um Runde auf dem obersten Parkdeck des Flughafens. Good luck explaining that to anybody. Oder wenn man wirklich vorhat, auf der Autobahn aus dem Flughafen zu entkommen, wie damals in Chicago, der Vorfall mit der Polizeisirene. In schlimmen Notfällen kann man immer noch behaupten, Schriftsteller zu sein und für ein Buch über Flughäfen zu recherchieren. Oder unter Gedächtnisverlust zu leiden. Diese Ausreden sollten nicht überstrapaziert werden. Kein Mensch möchte die Nacht in einer Gefängniszelle zusammen mit zehn anderen vorgeblichen Schriftstellern verbringen.
Während andere Flughäfen im Luftbild aussehen wie Fremdkörper, die in die Städte implantiert wurden und mit ihnen nur durch enge, vorgeschriebene Kanäle interagieren, scheint es sich bei Pearson um einen Teil des Ganzen zu handeln, der mit der Umgebung fest verwachsen ist. Klare Grenzen zwischen Flughafen und Umgebung gibt es nicht – der Flughafen verliert sich graduell im Umland. Pearson ist kein Tumor, den man herausschneiden könnte, ohne die Umgebung zu zerstören, sondern ein fest verschraubtes Organ.
Diese Eigenschaft hat für den Flughafenwanderer praktische Konsequenzen. Vollkommen ohne Risiko ist es möglich, das Flughafengelände zu verlassen und in die umliegenden Straßenzüge auszubrechen. Zum Beispiel über den Silver Dart Drive am Nordende von Terminal 3, eine unscheinbare Straße mit Gehwegen, die direkt zur sechsspurigen Airport Road führt, und wenn man es schafft, diese lebend zu überqueren, zum American Drive. Der American Drive gehört eindeutig zur Außenwelt. Die Metamorphose ist komplett. Hier wird einen niemand für einen Flughafenwanderer halten; auf nur ein paar Hundert Metern hat man sich von einem Aussätzigen in einen vollkommen normalen Menschen verwandelt, der nur zufällig 20 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum spazieren geht.
Natürlich ist die Umgebung, in die man so geraten ist, nach fast allen Gesichtspunkten nutzlos. Man steht in einer Vorstadt Torontos mit dem seltsamen Namen Mississauga, zwischen den Büros der Firmen, die nicht genug Geld für die Hochhäuser im Stadtzentrum haben. Autovermietungen. Anonyme Strukturen aus grauem Beton. Parkplätze. In Mississauga wohnen 700.000 Menschen, aber hier sind sie nicht. Benannt ist Mississauga nach einem Indianerstamm, der sich irgendwann im 17. Jahrhundert nach gründlicher Odyssee an der sumpfigen Stelle niederließ, wo der Credit River in den Ontariosee fließt. Zweihundert Jahre später kauften die Briten den Ureinwohnern ihr Land für einen Spottpreis ab. Mit der unhandlichen Bezeichnung Mississauga sind wir noch gut davongekommen: Der Württemberger Conrad Weiser, der in der Gegend im 18. Jahrhundert als Übersetzer und Vermittler zwischen Indianern und Weißen unterwegs war, benutzte für dieselbe Gruppe Indianer den unaussprechlichen Namen Tisagechroamis.
Flucht – der Weg nach draußen – ist eine Schlüsseldisziplin des Flughafenwanderns: der Beweis, dass der Flughafen ein Ort ist, den man zu Fuß erreichen und verlassen kann. Sogar der höchste Berg der Welt, der kälteste Punkt der Erde und die Pole der Unzugänglichkeit lassen sich zu Fuß erreichen. Nur extrem pathologische Orte verschließen sich dem Fußgänger: das Weltall. Die Tiefsee. Die Todeszone zwischen Nord- und Südkorea. Torontos Flughafen gehört offenbar nicht dazu. Test bestanden. Auch der Weg zurück ist in Toronto übrigens sehr einfach. Man begibt sich in das riesige Parkhaus in der Viscount Road, einer Nebenstraße vom American Drive, besteigt den nächsten Zug und lässt sich zurück in den Flughafen saugen.
Fliehen ist trivial, wenn der Flughafen zu klein für Abwehrmechanismen ist. In London-Stansted, Edinburgh, Stockholm Skavsta, selbst Berlin-Schönefeld und Boston-Logan gelingt der Weg nach draußen beinahe unabsichtlich, der Übergang geschieht nahtlos, und innerhalb von Minuten findet man sich in Landschaften wieder, in denen Gummistiefel die beste Fußbekleidung wären. Der Test funktioniert nur bei den echten Riesenflughäfen, in Europa: Charles-de-Gaulle in Paris, Heathrow in London und Frankfurt. In Nordamerika vielleicht noch New York JFK, Atlanta, Los Angeles. Und Chicago.
Chicago O’Hare ist das Gegenbeispiel zu Toronto. Ein Monster von einem Flughafen. Jede Stunde landen circa hundert Flugzeuge in Chicago O’Hare, die dem Ungeheuer neue Nahrung zuführen. Zusammen spucken sie Tausende Pakete aus Menschenfleisch aus, die direkt im Schlund des Riesenkraken verschwinden. Von dort entkommt man nur noch, wenn man sich an die Vorschriften des Kraken hält. Seine Regeln sind hart: nur im Auto, im Bus oder im Zug. Keiner läuft dem Monster davon.
Das Monster arbeitet sowohl mit topografischen als auch mit psychologischen Tricks. Die drei wesentlichen Terminals liegen dicht beieinander in einer engen Schleife, umgeben von weiten Rollfeldern. Der Zugang zu dieser Schleife – der Ausgang aus dem Inneren des Monsters – ist ein enger Korridor, in den sich zahlreiche Straßen und Schienen zwängen. Das vierte Terminal, die Logik mit Füßen tretend Terminal 5 benannt, befindet sich in einem Nebenmagen des Monsters, von allen Seiten eingezwängt von undurchdringlicher Infrastruktur, genau wie die drei anderen hermetisch nach außen abgeriegelt und von den drei anderen Terminals ebenso strikt getrennt. Vor diese Situation gestellt, bleibt dem Flughafenwanderer nur noch die Exploration der Innereien, die Erforschung von Seitenmägen, Gedärmen und Drüsen.
Wer versucht, den Weg nach draußen zu finden, wird schnell gestoppt, entweder von hohen Zäunen, von zehnspurigen viel befahrenen Autobahnen oder von den Ordnungsinstanzen des Monsterorganismus. Von Terminal 1 zum Beispiel führen schöne, breite Gehwege am Rande des Chaos entlang zu einem winzigen Park zum Hundeausführen und anschließend nach draußen. Theoretisch gäbe es hier einen Ausweg, in der Praxis wird der einsame Wanderer nach wenigen Metern gestoppt und zurückgeschickt. In den Parkhäusern, die den Raum in der Terminalschleife ausfüllen und eventuell eine Chance bieten, auf der Gegenseite auszubrechen, patrouillieren uniformierte Wachleute mit Schäferhunden, die jedes auffällige Verhalten unterbinden.
Viele Stunden renne ich dagegen an. Vergeblich. Der Weg nach draußen ist versperrt. Es bleibt nur, dem Monster zu gehorchen. O’Hare lässt keinen Zweifel an seiner Absicht, den Flughafenwanderer zu entmündigen und in einen Teil der Maschine zu verwandeln. Beim Verlassen von O’Hare ist man nicht mehr derselbe.
Aber warum sollte man O’Hare verlassen, könnte man einwenden. Es gibt so viel zu tun.
Die einfachste Form der Unterhaltung in Chicago ist das Abschreiten der drei Terminals 1 bis 3, die zwar im Inneren unoriginell sind, aber viele Varianten für Spaziergänge bieten, innen, außen, oben und unten, verbunden mit markanten Änderungen in den klimatischen Bedingungen. Wie bei allen nordamerikanischen Flughäfen gibt es sowohl im Winter als auch im Sommer scharfe, interessante Kontraste zwischen drinnen und draußen, in Temperatur, Niederschlagsmenge und Windeigenschaften. Der Dank dafür gebührt den Klimaanlagen (innen) und den fehlenden Ost-West-Barrieren (außen). Kalt- und Warmfronten können ungehindert tief in den Kontinent eindringen, bis sie an den automatischen Schiebetüren der Gebäude abprallen.
Die zweite Option ist das ausgedehnte Tunnelsystem, das die drei Terminals auf dem kürzesten Weg miteinander und mit dem Bahnhof verbindet. Der Untergrund von O’Hare ist ein Ort des Friedens: endlose Tunnel, ausgestattet mit langen Laufbändern, Bildergalerien an den Wänden, angenehmer Beleuchtung und, wenn man zu normalen Tageszeiten kommt, Musikern mit sehr unterschiedlichem Repertoire. Das Monster hat sich in diesem Tunnelsystem einen Wohlfühlbereich zugelegt, der den gehetzten und angestrengten Wanderer zur Ruhe bringt.
Dieselben Untergrundnetzwerke bieten Zugang zum Keller des Hilton Hotels, das direkt gegenüber von Terminal 2 steht, auf drei Seiten umgeben von Parkdecks. Von oben wirkt es wie eine unzugängliche Festung, schwarz, glatt, spiegelnd, quaderförmig, aber hier unten ist der Zugang einfach, a soft underbelly if there ever was one. Ohne konkrete Vorwarnung findet man sich auf ruhigen Fluren mit Teppichen und läuft vorbei an der Fitnessabteilung des Hotels, wo eine andere Art Flughafenwanderer sich auf dem Stairmaster bewegt.
Hat man alle waagerechten Wege abgearbeitet, bleibt außerdem die Möglichkeit, in die Vertikale zu wechseln, zum Beispiel durch Aufzugfahren. Die Etagen der Parkhäuser oberhalb des Untergrundsystems sind nicht nummeriert, sondern gekennzeichnet durch die Logos der örtlichen Sportvereine. Bulls, Cubs und Blackhawks sind noch klar, aber wer wusste schon, dass es Chicago Wolves gibt und welchen Sport sie betreiben? Die Aufzugswartestellen sind außerdem akustisch markiert, jedes Level mit einer Melodie, die zum jeweiligen Team passt. Eine Jukebox, bei der sich nicht die Schallplatte an die richtige Stelle bewegt, sondern der Zuhörer. Die Wolves-Etage ganz oben mit der Nationalhymne, die Cubs-Etage mit dem 100 Jahre alten Baseball-Klassiker »Take Me Out to the Ball Game« von Jack Norworth und Albert von Tilzer, beides absolute Baseball-Ignoranten. Auch die Aufzugsschächte sind sicher, friedlich und unbeobachtet. Das ebenerdige Cubs-Etage bietet als einzige Zugang zu den unüberdachten Parkplätzen in den Außenbereichen des Terminalbereichs, das gelobte, aber gefährliche Land für den Flughafenwanderer, in dem noch Gold geschürft wird und die Sonne nie untergeht.
Das Spektrum der Flughafendiversität auszumessen, zu quantifzieren, die multiplen Dimensionen der Flughafenvielfalt zu erforschen, die Alleinstellungsmerkmale zu finden, das soll unser Ziel sein.
Weiterlesen: Aleks Scholz: Flughafenwandern. Band 1: Europa und Nordamerika. Digitale Originalausgabe. CulturBooks Maxi, Dezember 2016. Circa 120 Seiten. 6,99 Euro. Zum Buch.