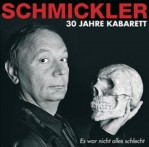 Blick zurück nach vorn im Zorn
Blick zurück nach vorn im Zorn
In seinem vierten Soloprogramm „Es war nicht alles schlecht“ wirft Wilfried Schmickler einen Blick zurück auf seine dreißigjährige Bühnenkarriere, ohne die aktuelle Situation aus den Augen zu verlieren. Von Jörg Auberg
Wilfried Schmicklers Markenziechen ist der cholerische Rundumschlag. In der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“, zu dessen Stammpersonal er seit 1990 gehört, tritt er als sich in Rage redender, gegen die Schlechtigkeit und Verlogenheit der Welt agitierender, am Rande des Herzinfarkts agierender, nach dem Vorhang rufender Choleriker auf, ehe er den aufgestauten Ärger mit einem Glas Kölsch im Abspann hinunterspült.
Nach diesem dialektischen Muster von Spannung und Entspannung verfährt Schmickler auch in seinem vierten Soloprogramm „Es war nicht alles schlecht“, in dem er mit dem Blick zurück auf seine dreißigjährige Bühnenkarriere die aktuellen Verhältnisse beklagt und auf die üblichen Verdächtigen des politischen Establishments (wie die bei Kabarettisten allseits beliebte Figur des neoliberalen Springteufels Guido Westerwelle) eindrischt. Der Zorn des vielfach ausgezeichneten Kabarettisten richtet sich gegen die Verhältnisse, die er – ungeachtet seiner Tiraden – nicht zu ändern vermag, aber gegen die er anschreit, um seine, wenn auch letztlich folgenlose, Opposition öffentlich zu begründen. Das zumeist bürgerlich-linksliberale Publikum erklärt sich mit diesem Kabarett-Ablasses einverstanden – und darin erschöpft sich sein politisches Bekenntnis dann auch.
Aufbruch und Integration
Dabei ist Schmickler nicht dem klassischen politischen Kabarett – wie es von Lore Lorentz, Wolfgang Neuss, Dieter Hildebrandt oder Werner Schneyder über Jahrzehnte in der Bundesrepublik repräsentiert wurde – verpflichtet, sondern steht mit seiner Mischung aus Kabarett und Comedy eher in der Tradition des legendären Anarcho-Kabaretts der „3 Tornados“, das sich in der Szene der Post-1968er Spontis entwickelte und in seiner direkten Einbettung in den politischen Kampf (bei Demonstrationen und Streiks) als Gegenentwurf zum „verkrusteten“ Bühnenkabarett der älteren Generation begriffen wurde. Die politische Radikalität bezahlten sie allerdings häufig mit Zensur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Auftrittsverboten. In den späten 1980er Jahren wurde diese Form des „aktionistischen“ Kabaretts von den Zeitläuften überholt. Symptomatisch war die Auflösung der „3 Tornados“ wenige Tag nach dem Mauerfall 1989, wonach der letzte überlebende, noch aktive Tornado Arnulf Rating den Marsch durch öffentlich-rechtliche Institutionen antrat.
Vergnügen und Einverständnis
Schmickler begann seine Karriere in freien Theatergruppen aus der Sponti-Szene: 1978 schloss er sich dem Trio „Matsche, Works und Hallies“ an (später in „Matsche, Works und Pullrich“ umbenannt) und trat 1989 in der Kölner Kabarett-Gruppe „3Gestirn“ die Nachfolge Jürgen Beckers an. Ab 2003 verfolgte er seine Solokarriere. Auch wenn der unmittelbare politische Anspruch der Anfangsjahre von den gesellschaftlichen Realitäten eingeebnet wurde, ist Schmickler auch weiterhin bestrebt, Kritik, Aufklärung und Unterhaltung zu synthetisieren, obgleich er zuweilen den Tiefgang einer griffigen Pointe opfert, was vor allem im Vergleich mit dem aktuellen Programm seines Ex-Sponti-Kollegen Matthias Deutschmann („Die Reise nach Jerusalem“, Conanima 2009) deutlich wird.
Über das ehemalige bête noire der Linken, Helmut Schmidt, sagt der bekennende Raucher Schmickler, er sei „der quasi rundum qualmende Schlot in der rauchfreien Landschaft“ der „Frischluftfanatiker“, während kein kritisches Wort über den vergangenen und aktuellen Schmidt fällt. Deutschmann dagegen führt Schmidt als Beispiel für Altersradikalität an, der sich im Wechsel von der sozialen zur Raucherfrage nur im Bezug auf das Nikotin öffentlich „radikalisierte“, während er früher linke „Visionäre“ zum Augenarzt schicken wollte. Während Schmickler sich mit einer Pointe aus dem Repertoire des Schenkelklopferhumors begnügt, vermag Deutschmann in einer kritischen Selbstreflexion unter die Oberfläche von Gesellschaft, Politik und Medienindustrie zu blicken.
Bei Schmickler dagegen schlägt phasenweise eine fragwürdige, reduktionistische Vulgärpsychologie durch, die politische Fehlentwicklungen auf vermutete persönliche Unzulänglichkeiten zurückführt. So sieht er das Dilemma politischer Parteien und ihrer Charaktermasken (zumindest teilweise) darin begründet, dass die heutigen Generalsekretäre von CDU/CSU und SPD in ihrer Schulzeit von ihren Schulkameraden geschnitten worden seien, so dass sie aus Rache zu dem wurden, was sie jetzt sind. Damit produziert er billige Lacher, die aus einem gefährlichen, gegen Außenseiter und Sündenböcke gerichteten Denken herausbrechen. An dieser Stelle schlägt vorgeblich politisches Kabarett in Antiaufklärung um.
Kritik und Zerstreuung
„Es war nicht alles schlecht“, heißt es im titelgebenden Lied. „Das meiste war noch schlechter.“ Die zweifelsohne harsche Kritik an den herrschenden Verhältnissen lässt sich sowohl für den Kritiker als auch für das Publikum (das mehr oder weniger Verantwortung für diese Verhältnisse trägt) nicht in aller Konsequenz ertragen, so dass Entspannung in Form von „lustigen Liedchen“ oder „ein paar älteren Witzchen“ gereicht wird (wie es ironisch in der Verlagsmitteilung heißt). Allerdings lässt sich fragen, inwieweit diese „kritische Unterhaltung“ tatsächlich der Aufklärung dient oder ob sie – wie Walter Benjamin 1931 monierte – notwendige politische Kritik „in Gegenstände der Zerstreuung, des Amüsements“ verwandelt, „die sich dem Konsum zuführen ließen“. Dies aber ist eine grundsätzliche Existenzfrage des politischen Kabaretts, das seinen stets am Rande des Konformismus operierenden Unterhaltungscharakter nie vollständig verhehlen kann.
Jörg Auberg
Wilfried Schmickler: Es war nicht alles schlecht. 1 CD, Laufzeit: 78:49 Minuten.
WortArt 2009. Preis: 15,95 Euro.











