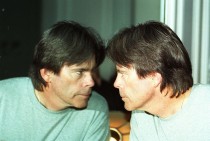Über den amerikanischen Schriftsteller Stephen King
Stephen King erzählt haarsträubende Geschichten auf gekonnt haarsträubende Weise. Nach der Lektüre von „Friedhof der Kuscheltiere“ habe ich tagelang die Bewegungen unseres Katers misstrauisch beobachtet – wer das Buch kennt, weiß, warum.
Zum Beispiel beherrscht King einige im Grunde einfache Techniken virtuos. Etwa diese: Wie ein Boxer es ausnutzt, wenn sein Gegner nach einem gut placierten Treffer nach Luft schnappt, und ihn ausknockt, so setzt King, wenn man meint, schlimmer käme es nun nicht mehr, noch einen drauf. Wir müssen lesen, wie die wahnsinnige Krankenschwester dem von ihr gefangen gehaltenen Schriftsteller mit einer Küchensäge den Fuß abgesägt hat. Und während wir noch nach Luft schnappen, kommt die Beschreibung, wie sie die Wunde mit einem Lötkolben desinfiziert. Eine scheußliche und geschmacklose Szene, gewiss. Und in den meisten anderen Büchern wäre sie nur das. Aber Kings Buch („Misery“, deutsch leider: „Sie“) ist das Spiel mit dem Gedanken, was wohl passieren könne, wenn ein Autor seinem größten Fan in die Hände fällt. Und da ist dann eben die Sache mit dem Lötkolben zugleich ein Akt der Fürsorge.

Kings Bücher haben oft solch eine konditionale Struktur: was wäre, wenn …? Er macht seinen Lesern das Angebot, sich in irgendeine Phantasie hineinzubegeben, und hat die Fähigkeit, immer die Nase vorn zu haben: Sie haben Alpträume? Ich werde Ihnen zeigen, was ein Alptraum ist! Das aber würde als bloßes Aneinanderreihen von Scheußlichkeiten nicht funktionieren. Auf die Seite umgerechnet, sind Kings oft äußerst dickleibige Romane an Grässlichem auch wieder gar nicht so reich. Hingegen sind sie reich an Alltag, oft erstaunlich naturalistische Romane.
Der Naturalismus ist allerdings – das ist die Grenze zur Literatur, die er sich selbst zieht – nur Mittel zum Zweck der Spannungssteigerung. King liebt die Banalitäten des Alltags, um den Alptraum umso effektvoller einsetzen lassen zu können. Der Zigeunerfluch, er möge unaufhaltsam dünner werden, ohne etwas dagegen tun zu können, erreicht nicht den Normal-, sondern den Übergewichtigen, klar, aber es wäre nur der halbe Spaß, wenn wir nicht zu Beginn die morgendlichen Wiegerituale miterlebt hätten: nach dem Gang zum Klo, und die Armbanduhr muss auch noch abgenommen werden. Oder, irgendwo anders, der Telefonanruf, der jemanden auf dem Klo erwischt, und der muss mit runtergelassenen Hosen … – nein, keine Fixierung auf dies Thema, sondern Antwort auf die Kinderfrage, wann und wie macht es Kara ben Nemsi in der Wüste? Die normalen Helden der Spannungsliteratur kommen ohne das aus, aber doch nicht wir, und King kümmert sich liebevoll-boshaft um alle Alltagsnöte und -pannen, insbesondere um die, die wir gern verschweigen, und schmeichelt uns Lesern damit, in dem er anerkennt, dass unser normales Leben sowieso ein Alptraum ist. Und dann legt er erst richtig los.

In einer Menge von Kings Romanen haben wir das klassische Personal des Horrorromans: Vampire, Gespenster (manchmal solche aus dem Lovecraft-Fundus), ungestaltes Böses. Ich mag diese Geschichten weniger; King spart in ihnen sozusagen Anatomie. In ihnen springt das Unalltägliche übergangslos in den Alltag, der Freiheiten, die sich der Autor nehmen kann, sind zu viele. Anders bei den Büchern, in denen nur der Alltag aus seinen Fugen gerät. Hier wird der alltägliche zum sehr speziellen und dann äußerst bizarren Alptraum. Hier gelingen King ungewöhnliche Passagen wie etwa die Beschreibung der Selbstbefreiung der mit Handschellen an ein Bett in einer abgelegenen Hütte gefesselten Frau, deren Mann während eines Sex-Spiels mehr oder weniger zufällig gestorben ist und während der Befreiungsversuche von einem streunenden Hund gefressen wird. Igitt! Ja, gewiss, aber die Pointe besteht eben darin, dass dieses eklige Geschehen ein Aside bleibt – das eigentliche Drama spielt sich ab zwischen einem Körper und zwei Bettpfosten, und zwar sehr viele Seiten lang.
Spannung nicht durch das grässliche Detail, sondern durch die Art und Weise es zu erzählen, zu erzeugen und zu halten, ist durchaus ein Kunststück und manchmal Kunst, und King gelingen seine Kunststücke – wenn sie ihm gelingen – dadurch, dass er sich der Person, der die Grässlichkeiten widerfahren, so weit wie möglich nähert. Auch hier zieht er sich eine Grenze, denn auch das bleibt Mittel zum Zweck. Wir erfahren in Kings Büchern nichts Neues über Menschen (meinethalben: „den Menschen“), sondern er tischt uns, was wir über uns und unsere Mitmenschen wissen, auf, damit wir es wieder erkennen und konfrontiert es mit Außergewöhnlichem. Auch dann über die Condition humaine nicht recht etwas Neues, aber viel Spannung.

Erstveröffentlichung in: KulturSpiegel, 27.12.1999
mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Jan Philipp Reemtsma, Germanist, Publizist und Begründer des Hamburger Institut für Sozialforschung.