 Die Spur des Vogels
Die Spur des Vogels
– Es beginnt schon bei den Titeln seiner Romane. Bei nur wenigen Gegenwartsautoren ist der Titel so bedeutend, auch so poetisch wie bei Hector Bianciotti. „Das extreme Leben einer unscheinbaren Frau“, „Über die Nacht der blauen Sterne“, „Was die Nacht dem Tag erzählt“, „Das langsame Fortschreiten der Liebe“,„Wie die Spur des Vogels in der Luft“. Das Rätsel dieser so elegisch klingenden Titel löst sich dann, auch das ist typisch für das Schreiben Bianciottis, erst ganz am Ende des Romans, ja sogar erst im allerletzten Satz. Bis dahin muss man also schon lesen, um das Geheimnis dieser poetischen Verführungen zur Lektüre der Romane des in Argentinien geborenen französischen Schriftstellers zu entdecken, der gestern im Alter von 82 Jahren in Paris gestorben ist. Von Carl Wilhelm Macke
„Wie die Spur des Vogels in der Luft“ – vielleicht kann man sich der Herkunft des Titels über einen Umweg nähern. Die letzten Kapitel dieses Fährtenlesens durch seine eigene Biographie widmet Bianciotti seinem Landsmann, Freund und Lehrer Jorge Luis Borges. Die Beiden verbindet die gleiche argentinische Herkunft und die großen Vorlieben für die europäische Kultur. Der ältere Borges jedoch hat sein Land, seine Stadt Buenos Aires, nicht für so lange Zeit und so endgültig den Rücken gekehrt wie es der im provinziellen Cordoba geborene Bianciotti getan hat. Gestorben allerdings ist auch Borges fern von Argentinien, 1986 am Genfer See. Dort auch ist er begraben. Nicht ohne Bewegung liest man das von Bianciotti verfasste literarische Protokoll über die letzten Tage, die letzten Stunden, die letzten Augenblicke im Leben des Bibliothekars und Schriftstellers aus Buenos Aires.
Bianciotti verbrachte diese Zeit immer in der Nähe von Borges. „Ich sagte mir wieder einmal, daß man angesichts des Todes eines geliebten Menschen viel zu wenig empfindet. Man bleibt auf dieser Seite des Lebens, unfähig, das Gefühl zu begreifen, das derjenige empfindet, der die letzte Schwelle überschreitet“. Für jeden Liebhaber der Werke von Borges sind die Aufzeichnungen von Bianciotti vom Sterben seines geschätzten Meisters eine unbedingte Pflichtlektüre. Und jeder Kenner von Borges wird auch die Anspielung auf sein Werk in dem Titel bei Bianciotti entdecken. Borges liebte das Bild von dem rückwärts fliegenden Vogel, „der nicht wissen will, wohin er gerät, sondern nur, woher er kommt.“
Diesem „rückwärts fliegenden Vogel“ begegnen wir in allen Werken von Bianciotti wieder. Die Zeitform der Zukunft scheint für ihn nicht zu existieren. Gegenwart schimmert nur selten durch seine Texte. Über allem liegt eine feine Patina von Vergangenheit, von Gewesenem, von gelebten und nicht gelebten Leben. „ Oft wissen wir nicht“, heißt es in dem Roman „Was die Nacht dem Tag erzählt […]was hinter uns hinter der Wegbiegung einer Erinnerung erwartet. Wir finden uns vor einer vergessenen Tür, die Hand ist uns zuvorgekommen und hat schon die Klinke erfasst.“ Unübersehbar ist bei Hector Bianciotti natürlich auch der Einfluss von Marcel Proust. Was anderes macht denn Bianciotti, um mit Benjamin zu sprechen, als seine „Netze im Meer der temps perdi auszuwerfen“?
Immer wieder kommt Bianciotti in seinen Romanen zurück nach Argentinien, nach Cordoba, dorthin wo er 1930 als Kind italienischer Einwanderer aus dem Piemont geboren wurde. Dort, in einem „Theater der Erinnerungen“, trifft der Rückkehrer, zeitlich befristet, nicht für immer, auf die noch lebenden Geschwister, auf Angehörige, auf Freunde, auf frühere Geliebte aus einer kalendarisch, aber nicht im Herzen längst vergangenen Zeit. Immer sind seine Porträts mit großer Sorgfalt, mit großer Liebe, nicht selten aber auch mit anhaltender Verstörung gezeichnet.
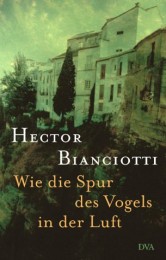 Das Wiedersehen von Elvira etwa , der Schneiderin seiner Kindheitsjahre: „Die Begegnung und die Annäherung rufen in ihr und mir ein seltenes Zusammentreffen hervor: die gleichzeitige Erinnerung an denselben Nachmittag, an denselben gemeinsam verbrachten Augenblick, der uns unversehrt im Gedächtnis geblieben ist, wie eine kleine Insel in der Weite von über einem Jahrhundert.“ Oder die Suche nach dem Grab seiner Eltern, die in ihm wieder ihre Bilder evoziert, die er glaubte, längst vergessen zu haben. Der Mutter legt er sieben, dem Vater fünf Rosen auf ihr Grab, Symbol unterschiedlicher Nähe zu den beiden Portalfiguren seines Lebens.
Das Wiedersehen von Elvira etwa , der Schneiderin seiner Kindheitsjahre: „Die Begegnung und die Annäherung rufen in ihr und mir ein seltenes Zusammentreffen hervor: die gleichzeitige Erinnerung an denselben Nachmittag, an denselben gemeinsam verbrachten Augenblick, der uns unversehrt im Gedächtnis geblieben ist, wie eine kleine Insel in der Weite von über einem Jahrhundert.“ Oder die Suche nach dem Grab seiner Eltern, die in ihm wieder ihre Bilder evoziert, die er glaubte, längst vergessen zu haben. Der Mutter legt er sieben, dem Vater fünf Rosen auf ihr Grab, Symbol unterschiedlicher Nähe zu den beiden Portalfiguren seines Lebens.
Bianciotti ist aber auch kein nur nostalgisierender Verklärer der Vergangenheit, wie ihm auch schon mal von Kritikern vorgehalten worden ist. Die in der Kindheit, in der Jugend, in der Vergangenheit erlebten Verstörungen, auch Zerstörungen seiner Hoffnungen, sind immer präsent. Harmonisch, heil, behütet waren die Jahre, die „temps perdu“ nicht, über die Bianciottii schreibt. Die allen Verästelungen der Vergangenheit nachspürende Erinnerung an Nilda, die einzige Tochter eines kreolischen Ehepaares, legt Zeugnis ab von einer im Schatten der Gewalt verbrachten Provinzkindheit.
Und auch die finsteren Jahre unter dem diktatorischen Operettengeneral Peròn haben niemals geheilte Verletzungen im Verhältnis zu seiner argentinischen Herkunftsheimat hinterlassen. Viel ist bei Bianciotti von Sterbenden, von Toten, von Friedhöfen die Rede. Aber es „fließt kein Blut“, es gibt keine Gemetzel und Schlachten, keinen moribunden Kitzel, keine Passion für den Horror. Bianciotti ist ein leiser Erzähler, dessen Rhythmus mehr dem langsamen, ästhetisch so berauschenden Schwingen eines Greifvogels in der Luft ähnelt als dem Flattern aufgeregter Spatzen. Geduld und ein Gespür für eine weit ausholende Genauigkeit bei Detailbeschreibungen sollte man schon besitzen, wenn man die Bücher von Bianciotti lesen, ihre Poesie aufnehmen und genießen will. Vielleicht liegt er damit weit außerhalb eines heute vorherrschenden, wesentlich härteren, schnelleren Erzählstils. Die Liebhaber von Short Cuts werden einen Roman von Hector Bianciotti wohl niemals zur Hand nehmen. Den Anderen aber, denen, die zu Bücher greifen, um den rasanten Kamerafahrten über die Oberfläche der Zeitaktualität zu entfliehen suchen, finden bei Bianciotti viel. „Man weiß nie“, heißt es bei ihm einmal, „ was uns das Herz zu unternehmen zwingt und auch nicht, wohin man geführt wird, und es ist so der Gefahr ausgesetzt, vom eigenen Weg abweichen zu müssen“.
Bianciotti ist ein Verführer, dessen Faszination für den deutschen Leser aber auch der den besonderen Ton des Originals erfassende Übersetzungsarbeit von Uli Wittmann zu verdanken ist. Bianciotti schrieb so als würde man noch lange nach Abschluss der Lektüre seiner Romane in der Luft die Spur des Vogels wahrnehmen, für die er die Worte fand. „Es gibt Augenblicke“, heißt es in dem Roman „Was die Nacht dem Tag erzählt“, „die weitschweifige Bücher nicht erschöpfend darstellen können.“ Manchmal aber ist Hector Bianciotti diesen Augenblicken in seinen Werken jedoch sehr nahe gekommen.
Carl Wilhelm Macke











