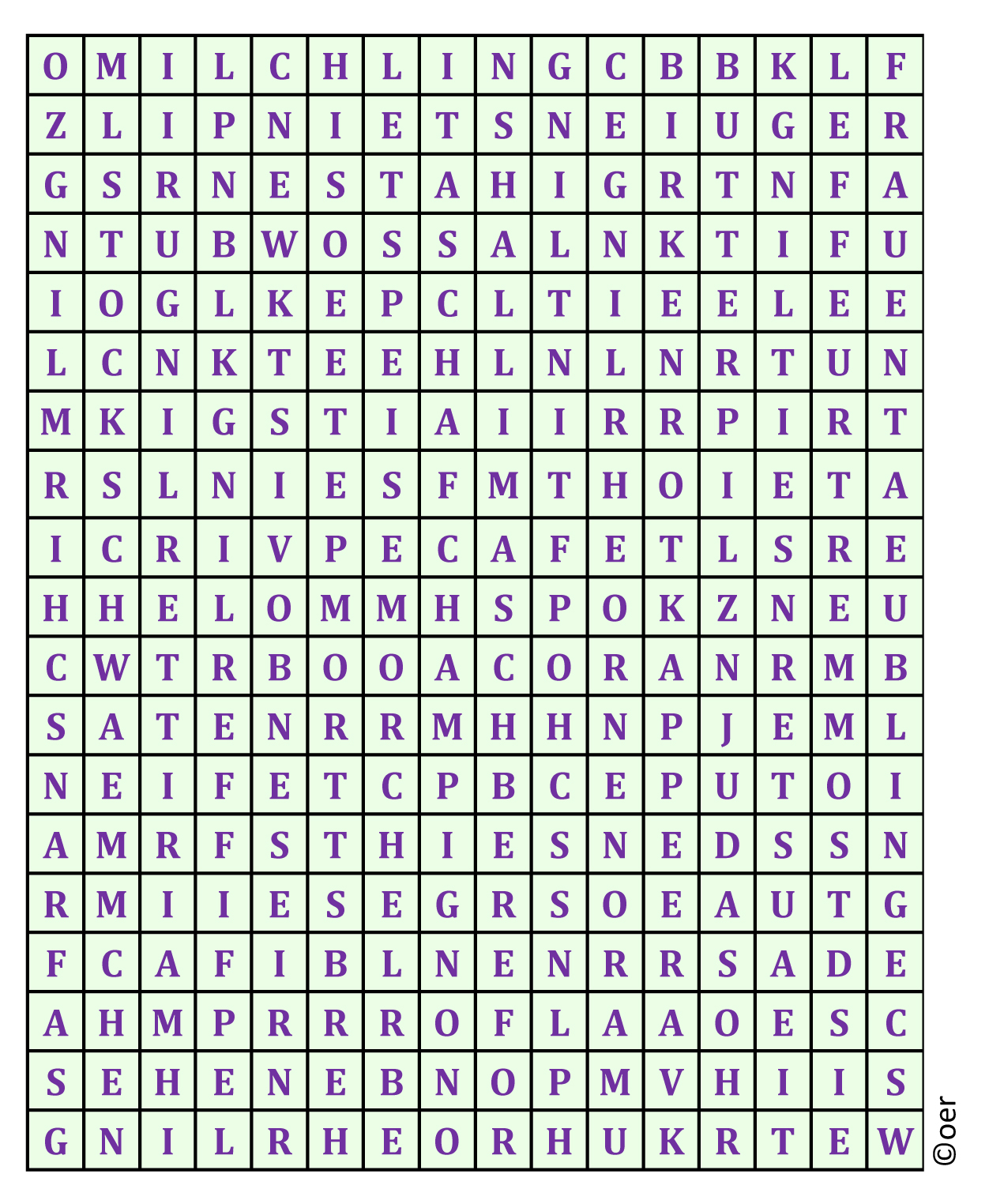Männer haben ja eigentlich keine Sonderbehandlung verdient nötig, heute machen wir eine Ausnahme. Die Ballung interessanter, sterbenslangweiliger, alter und neuer Veröffentlichungen männlicher Musikanten im Postkasten der Kolumnistin wirkte einfach zwingend… Christina Mohr widmet ihre Kolumne in dieser Woche gleich sieben Männern, sechs davon am Leben, einer leider tot. Und wir können schon jetzt verraten, dass es zwei Sieger der Herzen gibt: Edwyn Collins und Lloyd Cole.
 Mono-Theisten
Mono-Theisten
Ich war mal mit meiner Mutter bei einem Konzert von Bob Dylan. Es muss 1986 oder ’87 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Diese Unternehmung machte mir überhaupt keinen Spaß, musikalisch war ich seinerzeit ganz woanders. Es war es mir peinlich, mit meiner vor Begeisterung quietschenden Mutter unterwegs zu sein, wahrscheinlich trug ich aus Protest ein Cure-T-Shirt. Die Peinlichkeit erreichte ihren Höhepunkt, als Mama von einem amerikanischen G.I. (das Konzert fand in Frankfurt statt) auf die Schultern genommen wurde, damit sie eine bessere Sicht hatte. Ich stellte mich an den Rand. Von dort aus konnte ich gut sehen, aber was ich sah, erklärte mir den Jubel meiner Mutter nicht: ein schlechtgelaunter Mann mit Locken und Sonnenbrille, der sich von seinem Publikum abgewandt hatte und unverständliche Laute zu unerkennbaren Melodien knarzte. Dazu bemühte sich Tom Petty (Vorband und Begleitgitarrist) um gute Laune, die ich an diesem Abend nicht mehr bekam. Warum erzähle ich das? Weil ich Bob Dylan heute natürlich anders sehe und mir sogar vorstellen kann, mich von einem G.I. in die Luft heben zu lassen, um His Bobness zu huldigen. Die Geschichte der populären Musik wäre eine andere, hätte es ihn nicht gegeben. Vielleicht gäbe es gar keine nennenswerte populäre Musik. Niemandem vor oder nach ihm gelang es, amerikanischen Folk so selbstverständlich im Pop zu verankern, und dabei so cool und glaubwürdig zu sein. Kaum ein Gitarrist, der nicht zu den Akkorden von „Like A Rolling Stone“ seine Bühnenperformance geübt hat, kaum eine Singer-/Songwriterin, die nicht „Blowin‘ In The Wind“ gecovert hat. Dylans Platten, vor allem die ersten aus den frühen 1960’er Jahren, dürften in jedem halbwegs gut ausgestatteten Haushalt stehen. Von daher scheint die Frage berechtigt, warum jetzt, zusätzlich zu den „Witmark Demos“ ein CD-BoxSet mit Dylans acht ersten Alben erscheint. „Bob Dylan“, „The Freewheelin‘ Bob Dylan“, „The Times They Are A-Changin’“, „Another Side of Bob Dylan“, „Bringing It All Back Home“, „Highway 61 Revisited“, „Blonde on Blonde“ und „John Wesley Harding“ in Mono – und das ist die Erklärung für Sammler. In den sechziger Jahren war es durchaus üblich, neben den „modernen“ Stereotakes weiterhin Monoaufnahmen zu machen. Die Beatles, Jimi Hendrix und die Rolling Stones taten das, Bob Dylan auch. Man glaubte, dass die Songs in Mono direkter, authentischer und mehr wie vom Künstler intendiert klängen. Davon kann man sich jetzt überzeugen – und dazu den lesenswerten Essay von Greil Marcus über Dylan im Booklet lesen.
Bob Dylan: The Original Mono Recordings. BoxSet. Columbia (Sony). Booklet-Text von Greil Marcus.
www.bobdylan.com
Größe durch Verzicht
Edwyn Collins aus Glasgow hat ebenfalls eine Menge Leute beeinflusst, wenn auch nicht ganz so viele wie Old Bob. Bevor er 1994 mit „A Girl Like You“ seinen einzigen großen Hit verbuchen konnte, war er mit seiner Band Orange Juice* Anfang der 1980er-Jahre einer der ersten, auf die das Etikett „Post Punk“ geklebt wurde. Orange Juices herzerwärmende Mixtur aus Pop, Northern Soul und Spuren von Funk und Disco war ein deutlicher Gegenpol zum depressiven Düstersound von z. B. Joy Division aus Manchester. Zurück in die Jetztzeit: Edwyn Collins ist zwar zwanzig Jahre jünger als Bob Dylan, gesundheitlich aber wesentlich angeschlagener. 2005 erlitt Collins Gehirnblutungen, lange Zeit war nicht klar, ob er jemals wieder sprechen, schreiben und Musik machen kann. Die Familie half ihm ins Leben zurück, Sohn Will begleitete auch die Aufnahmen zu Collins‘ Comebackalbum „Home Again“, das vor drei Jahren erschien. Für seine neue Platte „Losing Sleep“ lud Edwyn Collins Musiker ins Studio ein, die nicht nur altersmäßig seine Söhne sein könnten, sondern ihn auch musikalisch beerben: Alex Kapranos und Nick McCarthy von Franz Ferdinand, Romeo Stodart (The Magic Numbers), Ryan Jarman von The Cribs und The Drums sind neben älteren Herren wie Johnny Marr (The Smiths) und Collins‘ altem Freund Sebastian Lewsley mit von der Partie. Wie die rein männliche Namensliste vermuten lässt, ist „Losing Sleep“ ein sehr kumpeliges Freunde-Album geworden. Collins muss weder sich noch seinen Fans irgendetwas beweisen, von daher ist es mehr als in Ordnung, dass er sich Unterstützung holt. Nach seiner Erkrankung ist er nicht mehr so flink mit den Fingern – also, Gitarre an Nick McCarthy weiterreichen. Auch Collins‘ knödelige Crooner-Stimme hat etwas gelitten, doch aus den zwölf Songs klingt die unverstellte Freude an der Musik, und ja, am Leben. Auf „Losing Sleep“ finden sich Collins-typische, fröhliche Soulpopsongs wie der Titeltrack, rührend simple Balladen wie „Searching For The Truth“ und „All My Days“; Liebeslieder à la Orange Juice wie „Humble“ und rockig-tanzbare Stücke wie „Do It Again“ (mit Kapranos) und „In Your Eyes“ (mit Jonathan Pierce) – dass ihm die Gastmusiker dabei fast ein wenig die Show stehlen, ist nebensächlich. Die ‚jungen Leute‘ von Franz Ferdinand und The Drums liefern die Energie, die Collins fehlt; Collins‘ Talent für eingängige Popsongs und -lyrics ist hingegen ungebrochen. Edwyn Collins zeigt Größe dadurch, dass er anderen seinen Platz anbietet.
* auch gerade erschienen: „Coals to Newcastle“, ein BoxSet mit sieben (!) CDs mit dem Gesamtwerk von Orange Juice
Edwyn Collins: Losing Sleep. Cooperative (Universal).
 Die schweren Zeiten sind vorbei
Die schweren Zeiten sind vorbei
Auch Lloyd Cole, der im nächsten Jahr 50 wird, veröffentlichte seine wichtigsten und bekanntesten Platten in den Achtzigern: „Rattlesnakes“ und „Easy Pieces“, die Cole mit seiner damaligen Band The Commotions herausbrachte, gehören ganz ohne „Gib mir das Gefühl zurück“**-Kitsch zum Schönsten, was man aus den 1980ern mitnehmen kann. So erfolgreich wie 1984/’85 wurde er später nicht mehr, seine Karriere ist ein weit verzweigter Pfad mit etlichen Höhen und Tiefen. Aber vielleicht ist es ganz gut so, dass Cole nie zum großen Abräumer wurde: was mit melancholischen Menschen passiert, die zu schnell zu berühmt werden, hat man bei Kurt Cobain gesehen. Lloyd Cole, in England geboren und seit langem in Massachussetts/USA zuhause, war und ist einer der größten Selbstzweifler der Popmusik, also ganz grundsätzlich ein Sympath. In seinen Texten thematisiert er Depressionen, teure Medikamente und zerstörte Liebesbeziehungen, musikalisch blieb er seinem durchaus bodenständigen, aber niemals kraftmeierischen Gitarrensound treu, der viele Singer-/Songwriter beeinflusste. Heute klingt er – eine Hommage an seine neue Heimat – etwas countryesker als früher. Cole passt 2010 also sehr gut aufs Hamburger Tapete-Label, wo schon sein letztes Album, eine Sammlung aus Single-B-Seiten und bisher Unveröffentlichtem, erschien. Country ohne Cowboyhut – in dieser Stimmung beginnt auch „Broken Record“, sanft und zurückgenommen mit der Ballade „Like A Broken Record“. Im Lauf des Albums werden die Songs vordergründig flotter und fröhlicher, die Texte dunkler, z.B. in „Writers‘ Retreat“, das von der Angst des Autors vorm leeren Blatt handelt. Das sonnige „Double Happiness“ zum Schluss ist die lyrische Verarbeitung einer heftigen Depression. In den Stücken dazwischen mischt Cole unaufgeregt Folk-, Blues- und Rock’n’Roll-Elemente in seinen „Broken Country“, seine Stimme klingt dunkel, warm, ein wenig traurig, doch keinesfalls hoffnungslos. Die ganz schweren Zeiten sind schließlich vorbei, das hört man „Broken Record“ bei aller Nachdenklichkeit deutlich an: Das chansonartige Liebeslied „Oh Genevieve“ singt er auf französisch, eine lustig klimpernde Mandoline bringt „Rhinestones“ zum Strahlen. Mit „Westchester County Jail“ verbeugt sich Cole vor Johnny Cash, mit „It’s Alright“ vor Elvis Presley. Songs wie „Man Overboard“ kann man sich wunderbar auf der Bühne vorstellen – und Cole als nicht mehr gar so schwermütigen Rock’n’Roller. Unterstützt wurde Cole auf „Broken Record“ unter anderem von Joan Wasser alias Joan As Policewoman, von der in diesem Jahr auch noch ein neues Album erwartet wird.
** so der Titel einer Oldie-Kampagne eines hessischen Radiosenders
Lloyd Cole: Broken Record. Tapete.
www.myspace.com/lloydcolemusician
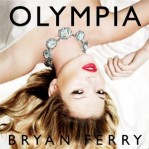 Unantastbar
Unantastbar
Die griechische Antike ist en vogue: Kylie Minogues aktuelles Album heißt „Aphrodite“, Bryan Ferry legt mit „Olympia“ noch einen drauf, wobei Ferry mit dem Titel auf den Londoner Stadtteil verweisen will, in dem sich sein Studio befindet. Ferrys „Olympia“ ist ein Hochglanz-Premium-Produkt, das sich durch die Bezeichnung „Pop“ beleidigt fühlen wird. Gut ist es, trotz des optischen Verweises an Roxy Music-Zeiten (Topmodel Kate Moss auf dem Cover) nicht. „Olympia“ will von allem zu viel und bietet zu wenig. Man traut sich kaum, diese Floskel hinzuschreiben, aber so ist es: zu viele Köche verderben den Brei. Beim Blick ins Booklet bzw. auf die Besetzungsliste von „Olympia“ bekommt man den Eindruck, es handele sich um ein klassisches Werk (oho, Olympia!), so viele Musiker sind pro Song aufgezählt. Überhaupt, die Musiker: bei „Olympia“ mischen unter anderem Flea, Nile Rodgers, David Gilmour, Groove Armada, Babydaddy und Jake Shears von den Scissor Sisters, Marcus Miller, Jonny Greenwood, Chris Spedding, Gary „Mani“ Mounfield und Dave Stewart mit, außerdem sind Ferrys ehemalige Roxy-Gefährten Phil Manzanera, Andy Mackay UND Brian Eno und drei Söhne Ferrys dabei. Klingt das, nach einer guten Platte? Na sehen Sie. Das kann gar nicht gut gehen. Dabei ist Bryan Ferry eigentlich unantastbar. Der letzte lebende Dandy stammt aus einfachen Verhältnissen, was er nie vergisst und stets betont. Gesegnet mit einer Stimme aus Samt und diesem Schlafzimmerblick, der ihn auch als 65-jährigen noch unwiderstehlich macht. Dazu sein Image als verlassener Liebhaber („Jealous Guy“)… Wie gesagt, unantastbar. „Olympia“ aber ergeht sich in Effekthascherei, schwache Songs werden mit jaulenden E-Gitarren, klassischem Instrumentarium (siehe oben) und walkürenhaften Opern-Chorgesängen zugekleistert. Ferrys nobles Organ hat kaum eine Chance zur Entfaltung, lediglich die groovy-verschlafenen Tracks „Shameless“ und „You Can Dance“ lassen dem Meister angemessenen Raum. Sonst wird geklotzt, nicht gekleckert, schon via Songtitel: „Alphaville“ ist einschmalztriefender Gospel, „Tender Is The Night“ widmet Ferry dem „Great Gatsby“-Autor F. Scott Fitzgerald, „BF Bass (Ode to Olympia)“ ist – nun ja, eine Ode. Mit Operngesang. Wie immer covert Bryan Ferry verschiedene Stücke, hier Tim Buckleys „Song To The Siren“ und „No Face, No Name, No Number“ von Traffic. Und erinnert damit schmerzlich an das für seine Verhältnisse bescheiden produzierte, aber gelungene Coveralbum „Dylanesque“ von 2007. Dylans Songs und Ferrys Stimme – eine perfekte Kombination. Wie perfekt, merkt man erst jetzt.
Lieber Bryan Ferry – und das ist ganz ernst gemeint –, bitte werfen Sie bei künftigen Plattenaufnahmen Jeden aus dem Studio, der Ihnen „hey Bryan, wir hatten doch damals in den Siebzigern dieselbe Freundin“, oder ähnliches zuruft. Suchen Sie stattdessen ein paar Bob Dylan-Songs aus oben erwähntem BoxSet aus, darauf sollten Sie das eine oder andere schöne Stück finden. Oder produzieren Sie mit Brian Eno einen Soundtrack, auf dem Sie singen dürfen (siehe unten). Oder singen Sie ein paar Roxy Music-Klassiker, ganz ohne Begleitung. Nur Ihre Stimme und ein Song wie „Dance Away“ oder meinetwegen sogar „Avalon“. Das wäre wundervoll.
Bryan Ferry: Olympia. Virgin (EMI).
www.bryanferry.com
 Vergesst Schubladen!
Vergesst Schubladen!
Ganz anders der andere Roxy Music-Brian, Eno nämlich. Aus seiner Leidenschaft für Soundtracks machte Elektropionier und Produzentenlegende Brian Eno nie einen Hehl, im Gegenteil. Er zog Soundtracks anderer Musik gerade wegen des fragmentarischen Charakters, der der Ergänzung durch Bilder und Worte bedarf, vor. Ab Ende der siebziger Jahre widmete er mit Platten wie „Music for Films“ auch sein eigenes Schaffen soundtrack-ähnlicher Musik, erschuf mit „Ambient I & II“ sogar ein neues Genre – Musik als Raumausstattung. Auf seinem neuen Album „Small Craft on a Milk Sea“, das auf dem wegweisenden Label Warp erscheint, tritt Eno als „Star“ völlig in den Hintergrund. Gemeinsam mit den jungen Komponisten und Musikern Leo Abrahams und Jon Hopkins zelebriert der 62-jährige die Freiheit der Improvisation. Fünfzehn Tracks, oder besser Skizzen, sind ohne Kompositionskorsett entstanden, wurden live im Studio eingespielt und hinterher bearbeitet – ohne sie des Improvisationscharakters zu berauben. Songstrukturen, Vertrautes zum Festhalten wie Strophe, Text, Refrain finden sich nirgends auf „Small Craft…“. Der Anfang ist soft, ambientartig und Keyboard-lastig, ab Track fünf („Horse“) wechseln Rhythmen, Intensitäten, Stimmungen abrupt und schroff. Technoide Tribal-Beats treffen auf kreischende E-Gitarren, kein Musiker und kein Instrument stehen im Zentrum. Das Zentrum, sofern es einges gibt, wandert und loopt von Track zu Track, von Skizze zu Skizze. Würde man ein Genre zur Beschreibung suchen, dann passt am ehesten Free Jazz. Aber noch besser vergisst man Genres und Schubladen. Der Film, den „Small Craft On A Milk Sea“ vertont, existiert nicht. Aber Eno und seine beiden Mitmusiker hatten ohnehin Komplizierteres im Sinn: spiegelverkehrte Stummfilme, nur-Ton-Filme sollten es sein, die man zu „Small Craft…“ sehen (oder hören?) kann. Brian Eno hat die Lust aufs Experiment noch nicht verloren.
Brian Eno: Small Craft on a Milk Sea. Warp (Rough Trade).
www.brian-eno.net
 Hair done by…
Hair done by…
Im Gegensatz zum echten Dandy Bryan Ferry wäre Steven Patrick Morrissey gern einer – seine permanenten Selbstvergleiche mit Oscar Wilde legen die Vermutung nahe. Doch Morrissey hat sich in der Öffentlichkeit immer zu stark ereifert, was ein Dandy nie tun würde. Außerdem ist Morrissey inzwischen viel zu muskulös, ein echter Dandy treibt keine Sport. Eitel wie zehn Dandys war Morrissey allerdings schon immer, selbst seine Smiths-Wimpyness war geschickt transformierte Eitelkeit. Vor allem seine Haare standen im Mittelpunkt seiner Ich-Sorge: im Booklet seines anlässlich des 20. Jubiläums wiederveröffentlichten Soloalbums „Bona Drag“ findet sich der Eintrag „Cover photography by Juergen Teller, hair by Dave Gerrard“. Hair by Dave Gerrard! Sowas würde man von Bryan Ferry erwarten, aber von Morrissey anno 1990? Genug der Äußerlichkeiten, es soll ja um Musik gehen: 1990 befand sich Morrissey auf dem Zenit seiner Solokarriere. Die Smiths waren Geschichte, er landete mit „Everyday Is Like Sunday“, „Suedehead“ oder „The Last of the Famous International Playboys“ Hit auf Hit. Das Album „Bona Drag“ war genau genommen keine neue Platte, sondern eine Sammlung bereits veröffentlichter Songs, wie es auch schon The Smiths mit „Hatful Of Hollow“ und „The World Won’t Listen“ praktiziert hatten. Im Gegensatz zu den in 2009 erschienenen Compilations ist die Neuausgabe von „Bona Drag“ mit Morrisseys Legitimation entstanden. Er selbst hat das Cover zur ebenfalls neu veröffentlichten Single „Everyday Is Like Sunday“ ausgesucht, ebenso die Bonustracks auf „Bona Drag“: neben den vierzehn Songs des Originalalbums befinden sich sechs bisher unveröffentlichte Stücke darauf, die gut sind. Und die Frisur sitzt sowieso.
Morrissey: Bona Drag. Original Recording Remastered. EMI Catalogue.
http://www.itsmorrisseysworld.com/
 Innovativer Sound
Innovativer Sound
Zum Thema Eitelkeit hätte auch der als einziger Protagonist dieser Kolumne bereits verstorbene Miles Davis einiges beizutragen. Andererseits: wer will über einen Mann richten, der mit seinem Horn (man verzeihe mir die Anzüglichkeit) so große Dinge tat wie Miles Davis? Der 1926 geborene Davis veränderte mit seiner Trompete Sound und Image des Jazz für immer. Nach seinen Anfängen in Bebop und Cool Jazz und dem wegweisenden Album „Kind of Blue“ war Davis für Experimente mit anderen Stilrichtungen immer offen. Ende der 1960’er Jahre ließ er Rockelemente in seine Musik einfließen, der Fusion-Jazz erreichte mit dem Album „Bitches Brew“ 1970 seinen Höhepunkt. Noch stärker als beim Vorgängeralbum „In A Silent Way“ dominierte nicht Swing den Rhythmus, sondern Funk und Rock. Elektronisch verstärkte Rockinstrumente sorgten für einen innovativen Sound – der in Jazzkreisen ungewöhnlich und zunächst verpönt war. Zudem wurde „Bitches Brew“ im Studio stärker bearbeitet als es sonst bei Jazzplatten üblich war – der Producer/Mixer wurde Teil der Band. „Bitches Brew“ ist eins der wichtigsten Alben für Miles Davis, aber auch eins der bedeutendsten der neueren Musikgeschichte. 1970 ist allerdings auch schon vierzig Jahre her, aus diesem Anlass wurde „Bitches Brew“ heuer als Legacy Edition wiederveröffentlicht. Auf zwei CDs befindet sich das Originalalbum mit unveröffentlichten Bonustracks, dazu gibt es eine Live-DVD mit einem kompletten Konzertmitschnitt aus Kopenhagen von 1969.
Miles Davis: Bitches Brew. Legacy Edition BoxSet. Columbia (Sony).
 Ever- und Nevergreens
Ever- und Nevergreens
Dass der erst 36-jährige Robert Peter Williams alias Robbie in dieser Kolumne gelandet ist, liegt an der Vermarktungspolitik seiner Plattenfirma: die angegebene Veröffentlichungszeitspanne von zwanzig Jahren macht einfach alt. Auf der Tatsache, dass Robbies Solokarriere erst 1997 mit dem George Michael-Cover „Freedom“ begann (wegen einer Vertragsklausel durfte Robbie seine erste Single nach dem Take That-Split erst veröffentlichen, nachdem Gary Barlow vorgelegt hatte), wollen wir hier nicht groß herumreiten: offenbar hat Robbie Williams ein neues (2004 gab´s schon mal eins) Greatest Hits-Album bitter nötig, seine letzten Platten „Rudebox“ und „Reality Killed The Video Star“ waren Flops. Die Doppel-CD „In And Out Of Consciousness“ lockt mit 39 Songs, die alle „Hits“ zu nennen allerdings schwer fällt. „Werkschau“ wäre angemessener. Oder „Die Höhen und Tiefen einer Popkarriere“. Bis man zu den wirklichen Hits/guten Songs – die natürlich bekannt sind – durchdringt, will viel mediokrer Füllstoff durchlitten sein. Hat man die knapp drei Stunden durchgehalten, überkommt einen der – ebenfalls bekannte – Gedanke, dass Robbie Williams nur einen guten Songwriter braucht, dann flutscht der Rest schon. Mit seiner Stimme, die zwischen Rotzlöffel und Sean Connery-Seriosität changiert, kann er eigentlich alles machen, nur nicht diese scheußlichen, auf Stadiontauglichkeit hingestümperten „Powerballaden“ und „Hymnen“ wie zum Beispiel „Sin Sin Sin“ oder „Morning Sun“. Soll heißen: Guy Chambers war sein passendster partner in crime, die anderen bringen es nicht so. Immer noch schön anzuhören sind Robbies Duette mit Nicole Kidman („Somethin‘ Stupid“) und Kylie Minogue („Kids“), über Songs wie „Rock DJ“, „Millennium“, „Let Me Entertain You“, „Feel“, „She’s The One“ und natürlich „Angels“ braucht man nicht mehr zu reden, die sind einfach toll und längst Evergreens. An die unglückselige „Swing When You’re Winning“-Phase, mit der Robbies Niedergang begann, wird einzig mit „Mr. Bojangles“ erinnert. Gut so. „In And Out Of Consciousness“ beginnt übrigens mit der neuen Single „Shame“, die Robbie mit seinem ehemaligen Erzfeind Gary Barlow im Duett singt; das Album endet mit den zwanzig Jahre alten Take That-Hit „Everything Changes“ – sieht so aus, als hätte Robbie Williams nur eine begrenzte Zeit in Freiheit gehabt. Take That sind stärker.
Robbie Williams: In And Out Of Consciousness. Greatest Hits 1990 – 2010. 2 CD. EMI.
Christina Mohr