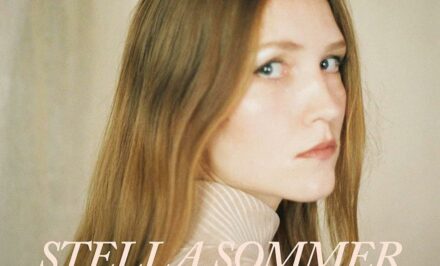In dieser Woche unternimmt unsere Autorin Christina Mohr einen literarischen und musikalischen Streifzug durch die Caféhauskultur vergangener Tage. Und apropos vergangen, eines ist klar: Loungemusik im Café ist total Neunziger, aber echt!
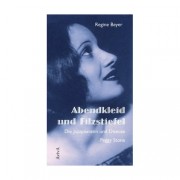 Resilienz
Resilienz
Wenn man die 430 Seiten der Biographie über die Jazzpianistin und Diseuse Peggy Stone zu Ende gelesen hat, findet man es nicht mehr besonders erwähnenswert, dass Stone, geborene Rosa Goldstein, volle 102 Jahre alt geworden ist. Ein solches Leben braucht Zeit, das muss man erstmal schaffen! Die in 1907 in Berlin geborene Tochter einer polnischstämmigen jüdischen Kaufmannsfamilie bekam als Zwölfjährige den Spitznamen Peggy verpasst, weil sie so gut sang, tanzte und überhaupt performte wie der US-amerikanische Kinderstar Peggy Montgomery. Damit war ihr weiterer Lebensweg besiegelt: Peggy zog es auf die Bühne. Sie spielte hervorragend Klavier und arrangierte schon in jungen Jahren bekannte Musikstücke nach ihrem Gusto um – wilden, verruchten, amerikanischen Jazz liebte sie besonders. Nach Zwischenstationen als Filmstatistin und Chorgirl gründete sie 1928 mit Laelia Rivlin das Damenduo Lil & Peggy Stone/The Stone Sisters. Was die beiden darboten, war einigermaßen unerhört: zwei talentierte, hübsche, junge Frauen am Klavier, die Schlager und Jazz in -zig Sprachen sangen. The Stone Sisters waren eine Sensation und wurden von den angesagtesten Varietés und Tanzdielen der Schweiz, Paris und ganz Westeuropas engagiert. Dann kamen Ehemänner und Kriege – und Mrs. Stone war fortan auf der Flucht respektive auf Reisen, Umzügen, Engagements von Riga bis Nowosibirsk. Sie lebte in Moskau, Białystok, Bukarest, Tel Aviv und fing in New York City nochmal ganz von vorne an. Mrs. Stones gesamte Lebensgeschichte nachzuerzählen, würde hier zu lange dauern – an dieser Stelle so viel: auch wenn Peggys musikalisches Renommée ein bisschen im Dunkel bleibt (wie bekannt war sie wirklich und wie gut?), ist einem Rosa Goldstein alias Peggy Stone nach der Lektüre so nahe wie die eigene Oma. Das liegt daran, dass sie – geschmeichelt durch das Interesse der Biographin, der Berliner Journalistin und Dozentin Regine Beyer – außerordentlich gern Rede und Antwort stand und dies, siehe oben, dank ihrer robusten Gesundheit bis zur Drucklegung des Buches auch tun konnte. Das Werk besteht zum Großteil aus Originalzitaten, man hat also Peggys Redeweise stets vor Augen und erlebt en passant noch einige Kapitel Weltgeschichte mit. Regine Beyer greift ein paar Mal zu einem stilistischen Kunstgriff, dessen es eigentlich gar nicht bedurft hätte: sie arbeitet einige Begebenheiten aus Peggys Leben in fiktive Filmskripte um, was innerhalb dieser lebensprallen Biographie deplatziert und konstruiert wirkt. Der Hauptgrund aber, weshalb man Peggy Stone so sehr ins Herz schließt, ist, dass sie sich von nichts und niemanden ins Bockshorn jagen ließ. Krieg und Judenpogrome, Mord an der Familie im KZ, gescheiterte Ehen, Krankheiten, Armut – andere Menschen wären an so viel Leid und Schrecken verzweifelt. Nicht so Peggy Stone. Ihre unbändige Lebenslust lässt sie auch im schlimmsten Elend nach vorne blicken, selbst nach traumatischen Ereignissen wie der Entdeckung, dass in den Kriegswintern auf russischen Märkten Menschenfleisch feilgeboten wurde, rappelt sich Rosa/Peggy immer wieder auf, zieht weiter, verliebt sich, spielt Klavier und singt, auch wenn ihr das Abendkleid von den abgemagerten Schultern rutscht. Als ihr dritter und letzter Ehemann, der Geiger Hermann Hönigsberg, nach ihrem Neuanfang in New York damit hadert, dass Peggy mit leichten Jazzschlagern erfolgreicher ist als er mit seinen Interpretationen klassischer Werke, wechselt sie kurzerhand die Branche, wird Textilmalerin und arbeitet für berühmte Modeschöpfer wie Oscar de la Renta. Kurzum: auch wenn Rosa Goldstein gegen Ende ihres langen Lebens verständlicherweise von allem genug hat (siehe ein sehr anrührender Brief von ihr an Regine Beyer), ist sie doch das personifizierte Beispiel für Resilienz. Und dafür, dass, wer musikalisch ist, sich immer noch ein Liedchen pfeifen kann, möge auch die Welt rundherum in Trümmern liegen.
Regine Beyer: Abendkleid und Filzstiefel – die Jazzpianistin und Diseuse Peggy Stone. Berlin: Aviva Verlag 2010. Gebunden, 430 Seiten. 24,80 Euro. http://aviva.txt9.de
 Bohemistisch-hedonistisch-urbane Melange
Bohemistisch-hedonistisch-urbane Melange
Ob Peggy Stone jemals im Münchner Café Luitpold auftrat, ist nicht überliefert. Denkbar wäre es, denn das Café in der Briennerstraße eröffnete 1888 und avancierte rasch zum Treffpunkt der feinen Gesellschaft. Von Anfang an spielte die Musik eine wichtige Rolle im Luitpold, wo sich bedeutende Literaten und Künstler wie Stefan George, Ludwig Thoma, Franz Marc und Christian Morgenstern bei Kaffee und Wein trafen, um zu plaudern, zu rauchen und natürlich neue Werke zu verfassen oder anzudenken. Zum vom hauseigenen Konditor gebackenen Kuchen wurde hochkarätige Musik kredenzt: Kapellmeister Will Glahé und der berühmte Geiger Barnabás von Gézcy spielten hier auf, häufig flogen die auf den Tischen ausgebreiteten Künstlerkladden in die Ecke, damit das Tanzbein geschwungen werden konnte – ob es heuer in Digi-Boheme-Hotspots wie dem Berliner „Café Oberholz“ auch so wild zugeht, darf bezweifelt werden. Zur Jahrhundertwende modernisierte sich das Luitpold: neben dem allgefälligen Walzer zogen frische Rhythmen wie Rumba, Swing, Jazz, Rag und Blues ein, die Tänze wurden wilder, die hier verfassten Romane seltener… Das originale Luitpold wurde in einer Bombennacht im Jahre 1944 zerstört, dank eines mutigen Investoren konnte es 1962 wiedereröffnet werden – eine Parallele zu Peggy Stone, die vom Krieg zwar gebeutelt, aber keineswegs umgebracht wurde. Das Münchner Trikont-Label widmet der Caféhaus-Musik seine neue Compilation „Liebling Luitpold – Swing, Rumba & Kaffehaus-Blues“, zusammengestellt von Jonathan Fischer. Selbst wenn vor dem Hören des Albums kurz der Gedanke aufgekeimt sein mag, dass die Caféhaus-Musik doch eine Vorläuferin neuzeitiger Loungemusic sein könnte… man wird schon vom ersten Song, Pearl Baileys raubeiniger Ansage „You Can Be Replaced“ (1959) eines Besseren belehrt. Die hier ausgesuchte Musik hat nichts mit form- und konturlos wabernden „Wohlfühlklängen“ zu tun. Der legendäre Swing-Gitarrist Coco Schumann gibt das schmissige „Exotique“ zum Besten, Joao Gilberto überbringt mit der Bossa Nova „Chega de Saudade“ zärtliche Grüße aus Brasilien, die unvergleichliche Nina Simone verleiht der Irving Berlin-Nummer „Love Me Or Leave Me“ mehr Tiefe, als der Komponist selbst je beabsichtigt hatte. Es wird geswingt, geschwoft, gecha-cha-chat, Louis Armstrong fehlt ebenso wenig wie Billie Holiday, Abbey Lincoln oder Carlos Augusto. G Rag Y Los Hermanos Patchekos machen mit ihrem „Swing 39“ ganz wuschig im Kopf, die libanesische Sängerin Soumaya Baalbaki bringt mit dem traurigen Tangostück „Achanak Ya Amar“ auch den hartnäckigsten Zeitungsleser zum Weinen. Und auch wenn „Besame Mucho“ zu den meistinterpretierten Kompositionen dieses Planeten gehört: die Version der Ray-O-Vacs aus den 1940er Jahren ist ein ganz besonderes Hör- und Schwoferlebnis. Trikont-eigene Acts wie das aus Japan stammende Münchner Duo Coconami und die chilenische Hamburgerin Universal González schleusen behutsam moderne Klänge ins Luitpold. Peggy Stone hätte an dieser bohemistisch-hedonistisch-urbanen Melange ihre wahre Freude gehabt, wir Nullerkinder sollten sogenannte „Bars“, in denen „Loungemusik“ läuft, künftig mit Verachtung strafen.
Various: Liebling Luitpold – Swing, Rumba & Kaffeehaus-Blues. Trikont (Indigo). www.trikont.de
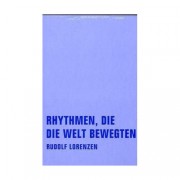 Tanzgeschichten
Tanzgeschichten
Dass die Geschichte der Popmusik nicht erst mit den Beatles beginnt, dürfte klar sein. Wie früh aber populäre Musik und Tanz in Gestalt von Walzer, Polka, Schlager, Rag und Schieber die Gemüter von Öffentlichkeit und Kritik(ast)ern erregte und erhitzte, zeigt Rudolf Lorenzens dicker Sammelband „Rhythmen, die die Welt bewegten. Geschichten zur Tanz- und Unterhaltungsmusik 1800 bis 1959“, wiederveröffentlicht vom wagemutigen Verbrecher Verlag zu Berlin. Autor Lorenzen wurde 1922 in Lübeck geboren, arbeitete als Grafiker und Werbeberater, seit Mitte der 1950er-Jahre lebt er als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane wie „Alles andere als ein Held“* sind leider viel weniger bekannt als die seiner Zeitgenossen Böll oder (Martin) Walser, galten aber z. B. Sebastian Haffner und Walter Kempowski als die eigentlich wichtigen Werke der deutschen Nachkriegsliteratur. Lorenzen versteht sich aber nicht nur auf den großen Wurf, der Vielschreiber tummelt sich auch kenntnisreich, witzig und versiert im Bereich kürzerer Essays und Kritiken. Seine „Tanzgeschichten“ füllen knapp 450 Seiten und wer sich nun fragt, ob Gesellschaftstänze, Stehgeiger und Chorgirls wirklich ein Stoff sind, mit dem ein so dickes Buch vollgeschrieben werden kann, wird sich schon nach den ersten Seiten positiv überrascht fühlen. Lorenzen kennt sich nämlich nicht nur mit allen Facetten der Polka aus (Aufzählung am Kapitelanfang: „Bayrische Polka, Bebob, Black Bottom, Blues Dance, Boogie Woogie….“), er bettet die Tänze und Musik in historische, politische, kulturelle, soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge. Lorenzen plaudert, parliert, doziert, lästert – vor allem aber erklärt er Dinge, von denen wir bisher nichts wussten. Dank Rudolf Lorenzen wissen wir jetzt, was es mit der US-amerikanischen Mode der „Tiertänze“ auf sich hat (The Horse, The Bug, etc.), er erläutert Stand und Stellung des Gigolos, entlarvt die verdeckte Frivolität angeblich harmloser Schlager wie „Oh Donna Clara“, zitiert mit Wonne alberne Operettentexte und und und. „Rhythmen, die die Welt bewegten“ ist viel viel mehr als ein Buch über Musik und Tanz: es ist ein Geschichtsbuch, dem man erstmal nicht anmerkt, wieviel man aus ihm lernen kann. Also super. Für taktlose NichttänzerInnen (wie mich) ist das Buch in folgende sinnvolle Kapitel aufgeteilt: „Im Zweivierteltakt“, „Im Dreivierteltakt“, „Im Viervierteltakt“, „Im Tango-Takt“. Mein Opa hätte solche Hilfestellung natürlich nicht gebraucht: er hätte mich kurzerhand untergehakt und „In einer kleinen Konditorei“ angestimmt …
Christina Mohr
* Dieser Roman und andere Werke Lorenzens sind ebenfalls via Verbrecher Verlag erhältlich.
Rudolf Lorenzen: Rhythmen, die die Welt bewegten. Geschichten zur Tanz- und Unterhaltungsmusik 1800 bis 1950. Berlin: Verbrecher Verlag 2010. Gebunden, 444 Seiten. 28,00 Euro. www.verbrecherverlag.de