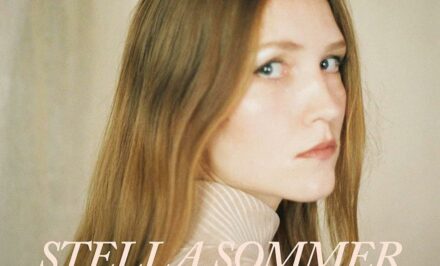Angestachelt von einem eher ärgerlichen Buch über Missverständnisse beim Musikhören hat sich Christina Mohr in dieser Woche insbesondere um Musik aus nicht-englisch- und nicht-deutschsprachigen Gefilden gekümmert – wie wunderbar man sich da verhören kann…
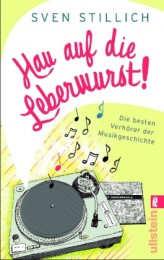 Witz, komm raus :
Witz, komm raus :
Au weia, da hat uns Axel Hacke mit seinem „Weißen Neger Wumbaba“, dem „Kleinen Handbuch des Verhörens“ ganz schön was eingebrockt (mal abgesehen vom „Neger“ im Titel… ok , andere Diskussion). Es konnte ja nicht allzu lange dauern, bis sich Nachahmer und Trittbrettfahrer zu Wort melden, so zum Beispiel Sven Stillich, seines Zeichens stellvertretender Kulturchef des Hamburger Abendblatts. Wo Hacke mit feinem Humor und größtmöglicher Behutsamkeit als Autor kreativ falsch verstandene Liedtexte präsentiert, da geht Stillich mit dem Holzhammer vor. Seine angeblich „besten Verhörer der Musikgeschichte“ (Aha! Gibt es auch eine Sammlung nicht so guter Verhörer?) verpuffen größtenteils im Nirwana des höchstens Mittelkomischen. Meistens sind seine „Ohrtümer“ (pfffhhhahah, Ohrtümer statt Irrtümer, verstehen Sie?) aber einfach nur unwitzig. Stillich weiß das im Grunde auch und setzt der Peinlichkeit noch einen obendrauf, indem er die Verhörer umständlich erklärt. Also, das geht ja überhaupt nicht: Witze ERKLÄREN. Entweder etwas ist lustig, dann lacht man eben; oder eine Sache ist nicht lustig, dann hilft auch keine Erklärung, sondern macht alles nur noch schlimmer. Bei Stillich sieht das so aus, dass er den „Verhörer“ groß und fett über einen Absatz stellt, im Absatz folgt die Erklärung, darunter klein und fett die Originalzeile. Also wie z. B. auf Seite 18 (ich erkläre Ihnen das jetzt nochmal):
Mando Diao, Gloria
„Sie ist nur neidisch auf sie“
Mehrere Zeilen erklärender Text, dann:
„She´s no longer your slave“
Wieder mehrere Zeilen erklärender Text. Darunter farblich unterlegter Kasten mit Infotext zu Mando Diao.
So geht das über mehr als 200 Seiten, am Anfang aktuelle Titel, zum Schluss alte Titel. Aufgebläht durch besserwisserische, längst bekannte und daher unnötige Abhandlungen über Bands, Pop-Kuriosa, etc. Dazu kommt, dass Stillichs gesammelte Verhörer (Wo überhaupt gesammelt? Wer hat ihm Beispiele geschickt? Oder hat er alles selbst verhört?) entweder lahm und unwitzig sind wie z.B. eine Zeile aus dem Beatles-Song „Lucy in the sky with diamonds“: „The girl with kaleidoscope eyes“ (Originaltext) / „The girl with colitis goes by“ (angeblicher Verhörer). Oder schlicht unglaubwürdig, denn wer hört schon innerhalb eines englisch gesungenen Titels auf einmal deutsche Wörter wie bei „Lady in Black“ von Uriah Heep: „And I begged her give me horses“ (Originaltext) / „Da wechsle ich die Hosen“ (angeblicher Verhörer). Seufz. Doppelseufz. Die Veröffentlichung dieses Buches kann nur damit erklärt werden, dass Autor und Verlag vor langer Zeit einen Vertrag geschlossen hatten ohne genau zu wissen, was für ein Buch am Ende herauskommen sollte. Als der Erscheinungstermin näher rückte, kam Sven Stillich der Geistesblitz, „genau, ein Buch mit lustigen Textmissverständnissen – das ist es!“ Aber woher lauter lustige „Verhörer“ nehmen und nicht stehlen? Darüber musste Stillich nochmal lange, lange grübeln und so entstand das unfassbar zähe und, ich wiederhole mich nur ungern, komplett unwitzige Buch „Hau auf die Leberwurst“, was angeblich jemand bei Paul McCartneys „Hope of Deliverance“ verstanden haben soll. Ich verstehe weder die Beweggründe des Verlags noch die des Autors und empfehle Sven Stillich untenstehende Platten, damit er sich mal wieder so richtig dolle verhören kann. Und das auch noch in ganz komischen Sprachen wie Spanisch oder Norwegisch – was das für Möglichkeiten bietet! Huahaha.
Sven Stillich: Hau auf die Leberwurst. Die besten Verhörer der Musikgeschichte. Ullstein, Berlin 2011. Taschenbuch, 224 Seiten. 7,95 Euro.
Die Homepage von Sven Stillich.
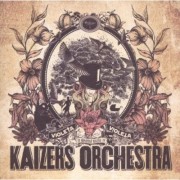 Kaizer’s Orchestra, Violeta Violeta Vol. 1
Kaizer’s Orchestra, Violeta Violeta Vol. 1
Ich sag´s jetzt einfach mal: ich mag Kaizer´s Orchestra nicht besonders. Der Umpta-Umpta-Gypsy-Balkan-Punk der norwegischen Band hat mich nie begeistert, allerdings gilt das bei mir auch für fast alle anderen Balkan-Punkrock-Bands. Mit ihrem ersten Album „Ompa til du dor“ (na, Herr Stillich, kann man sich da nicht irre witzig verhören? „Aber Dill ins Ohr“ oder so?) wurde das Orchester sofort sehr erfolgreich, die Platte war das meistverkaufte Rockdebüt in ihrem zugegeben recht kleinen Heimatland. Ihre Liveshows inklusive brennender Ölfässer, Pumporgeln, Kontrabässen und Gasmasken als Bühnenoutfit gelten als legendär, was ich ehrlicherweise weder bestätigen noch widerlegen kann. Jetzt haben sich die Musiker um Sänger Janove Ottesen etwas vorgenommen, was zurzeit – siehe Eels, Badly Drawn Boy oder Robyn – regelrecht in Mode gekommen ist: „Violeta Violeta Vol. 1“ ist der erste Teil einer Trilogie, Teil zwei und drei sollen im nächsten Jahr erscheinen. „Violeta Violeta“ erzählt die Geschichte des Mädchens Violeta, das so schön ist, dass die Eltern ihren Vornamen gleich doppelt eintragen mussten. Die Texte werden wohl nur wenige Skandinavisten verstehen, ich wüsste zum Beispiel gern, was „Svarte katter & flosshatter“ heißt (wahrscheinlich ein Song über einen schwarzen Kater) oder zu welcher Gelegenheit man mit dem Satz „Din kjole lukter bensin mor“ punkten kann. Die Musik spricht wie immer bei Kaizer´s Orchestra für sich, nur dass dieses Mal die Produktion noch glatter und mainstreamiger geraten ist als beim Vorgänger „Maskineri“. Es rumpelt und pumpelt immer weniger, dafür sind die Songs eindeutig für den Einsatz in großen Stadien konzipiert worden, vor allem die Single „Hjerteknuser“ oder „Femtakt filosofi“. Kaizer´s Orchestra probieren verschiedene Stile aus, darunter auch so etwas wie Jazz oder Blues. Die Fans können zwar immer noch schunkeln und pogen, aber gewünscht sind künftig auch La-Ola-Wellen und brennende Feuerzeuge, bzw. heutzutage eher hochgehaltene Mobiltelefone. Episch-pompöser Breitwandrock verdrängt den raubauzigen Balkanpunk, der mir plötzlich doch sehr ans Herz wächst, jedenfalls im Vergleich zum neuen Sound von Kaizer´s Orchestra, deren Fan ich in diesem Leben wohl nicht mehr werde.
Kaizer’s Orchestra: Violeta Violeta Vol. 1. Petroleum Records (Rough Trade).
Die Band auf Myspace und bei Facebook. Die Website von Kaizer’s Orchestra.
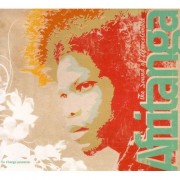 Afritanga. The Sound of Afrocolombia
Afritanga. The Sound of Afrocolombia
Bei Trikont-Veröffentlichungen kann man jederzeit bedenkenlos zugreifen, selbst wenn man mit dem Sujet nichts anfangen kann, weil man z. B. noch nie hebräischen Hip-Hop gehört hat. Aber genau dafür ist Trikont ja da: dir, mir und den vielen anderen Ignoranten die Musik der großen weiten Welt nahe zu bringen, ohne in Ethnopopkitsch zu versinken. Der neueste Trikont-Sampler „Afritanga“, kompiliert von Steen Thorsson aka DJ Chango, bringt uns nach Kolumbien: der Titel setzt sich zusammen aus Afrika und einem Grill-Gericht namens Fritanga – wortschöpferische Anspielung auf Kolumbiens afrikanisch-karibische Wurzeln in Musik und Kultur allgemein. Die auf „Afritanga“ versammelten fünfzehn meist sehr jungen Bands und KünstlerInnen orientieren sich weniger an Rock, Pop und Hip-Hop westlich-angloamerikanischer Provenienz, sondern berufen sich auf ihre afrikanischen roots in Verbindung mit der südamerikanischen/kolumbianischen Lebensrealität. So ist die Cumbia, der hierzulande sehr in Mode gekommene kolumbianische Paartanz auf Off-Beat-Basis, in vielen Songs erkennbar, ebenso traditionelle Instrumente wie die Gaita-Flöte, das Piano de la selva („Piano aus dem Dschungel“) und die xylophonartige Marimba. Natürlich gehen an Kolumbien aktuelle musikalische Trends nicht vorbei, weshalb „Afritanga“ kein folkloristisches Museum zum Hören ist: die Band Systema Solar benutzt Synthesizer und Soundcards, Cynthia Montano und Choc Quip Town rappen ihre Texte, die reggae-beeinflusste Band Roots Radical wandelt mit „Rastaman“ auf den Spuren Bob Marleys. Gesungen wird auf Spanisch (der Amtssprache Kolumbiens) und Englisch. Man wird auf „Afritango“ gewiss nicht alles ‚verstehen‘, wenn auch klar sein sollte, dass es in „Chorizo“ von Tumbacatre ums Essen geht. Oder? Hab ich da was falsch verstanden? Ein Blick ins wie immer pralle CD-Booklet kann, falls gewünscht, zur Aufklärung beitragen…
Various: Afritanga. The Sound of Afrocolombia. Trikont (Vertrieb: Indigo).
www.trikont.de
 Cornershop & The Double-O Groove Of. Featuring Bubbley Kaur
Cornershop & The Double-O Groove Of. Featuring Bubbley Kaur
Ein neues Album von Cornershop, so rasch nach „Judy Sucks A Lemon For Breakfast“? Ja und nein, denn „Cornershop And The Double-O Groove Of“ ist eigentlich schon sechs Jahre alt. Tjinder Singh hatte es laut eigener Aussage überhaupt nicht eilig, diese Platte herauszubringen, die vor allen Dingen richtig gut werden sollte. Die Besonderheit: Cornershop sind im Grunde „nur“ die Backingband für Sängerin Bubbley Kaur, die auf allen Stücken zu hören ist. Singh und Kaur kennen sich seit vielen Jahren, trafen sich zum Musikmachen aber erst 2005 wieder. Die gemeinsame Liebe zu traditioneller Punjabi-Folkmusic animierte Bubbley Kaur dazu, eigene Texte in Punjabi zu schreiben und zu Singhs Musik zu singen. Die Musik ist weitgehend typisch Cornershop, eine eingängige, anziehende Mixtur aus Britpop, Elektro, Dance und indischen Klängen. Da Bubbley ausschließlich in Punjabi singt, wirkt die Platte viel ‚indischer‘ als andere Cornershop-Veröffentlichungen – zur ungefähren Orientierung sind die Songtitel aber auf Englisch abgedruckt: „Topknot“ und „Natch“ erschienen schon vor einiger Zeit als Doppel-A-Seiten-Single, zu „Double Decker Eyelashes“ oder „Supercomputed“ kann man supergut tanzen. House- und Discoelemente finden sich fast in jedem Track, wenn auch der „Bollywood-Effekt“ überwiegt. Kein wirklich überzeugendes neues Album von Tjinder Singh und Kollegen, aber ein gelungenes Ins-Rampenlicht-Schieben einer bis dato unbekannten Sängerin, die im Übrigen eine tolle Stimme hat. Verhörer-Gefahr: extrem hoch!
Cornershop & The Double-O Groove Of. Featuring Bubbley Kaur. Ample Play Records.
Die Homepage der Band und die Künstler auf Myspace.
 Ebo Taylor: Life Stories. Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980
Ebo Taylor: Life Stories. Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980
Viele angloamerikanische Künstler wie die Talking Heads, Paul Simon und jüngst Vampire Weekend greifen auf afrikanische Musiktraditionen zurück und waren/sind sehr erfolgreich damit. Die Vorbilder sind hierzulande kaum bekannt – das britische Label Strut bemüht sich seit einigen Jahren darum, Musikern aus Ghana, Soweto und anderen afrikanischen Staaten und Städten zur verdienten Popularität zu verhelfen. Zum Beispiel dem ghanaischen Gitarristen Ebo Taylor, der inzwischen 75 Jahre alt ist, aber noch längst nicht an Ruhestand und Rente denkt. 2010 erschien sein aktuelles Album „Love And Death“, Strut veröffentlicht nun „Life Stories. Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980“, das eine sehr rührige Ära im Schaffen Taylors präsentiert. „Highlife“ wurden im Afrika der sechziger Jahre tanzbare Musikstile genannt, die auf traditionellen Rhythmen basierten und in westlich orientierten Rock-, Pop- oder Big-Band-Arrangements aufgenommen wurden. Auch Jazz, Soul und Funk flossen in Highlife ein, bei dem es, der Name sagt es, ganz schön hoch hergeht. Ebo Taylor war mit Highlife viele Jahre sehr erfolgreich, sechzehn ausgewählte Tracks mit so schönen, garantiert unverständlichen Titeln* wie „Ohye Atar Gyan“, „Etuei“, „Kwaku Ananse“, „Aba Yaa“ (los, Sven Stillich, gib´s uns!) lassen keine andere Wahl als die Anlage lauter zu drehen und wild zu tanzen.
* Einige Stücke haben englische Titel, z. B. „Heaven“ oder „What Is Life?“ Das versteht man natürlich, macht aber in punkto Hör- und Tanzspaß keinen Unterschied.
Ebo Taylor: Life Stories. Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980. Doppelalbum. Strut.
Die Homepage von Ebo Taylor und das Plattenlabel. Der Künstler auf Myspace.
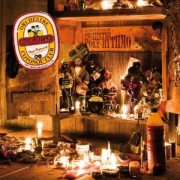 Orchestre Poly-Rythmo: Cotonou Club
Orchestre Poly-Rythmo: Cotonou Club
Noch ein Orchester, nochmal Strut, nochmal Afrika: das Album „Cotonou Club“ vom Orchestre Poly-Rythmo aus Benin ist im Gegensatz zu Ebo Taylor deutlich politisch gefärbt. Das Orchestre, gegründet in den sechziger Jahren, ist eine Institution in Benin. Mit ihrer Musik unterstützten sie stets die Unabhängigkeit Benins, lieferten den fröhlich-tanzbaren Soundtrack zur Vision eines demokratisch-sozialistischen Staates. Der französische Radiomoderator Elodie Maillot traf vor sieben Jahren einen Teil der Originalbesetzung des Orchestre Poly-Rythmo in Benin und konnte die Musiker zur Reunion überreden. Die Herren traten seitdem in New York und anderen Metropolen auf, wurden von KünstlerInnen wie Angelique Kidjo und Franz Ferdinand um Kooperationen gebeten und erfreuen sich ähnlicher Beliebtheit wie vor einigen Jahren die Omas und Opas vom kubanischen Buena Vista Social Club. Die Musik des Orchestre Poly-Rythmo ist allerdings ungeschliffener, rauer und lebendiger als die sanften lateinamerikanischen Klänge des Buena Vista SC: die elf Stücke auf „Cotonou Club“ scheppern krachig aus den Boxen, der Rhythmus packt einen sofort. Die Texte sind auf Französisch, das in Benin hauptsächlich gesprochen wird, teils auf Afrikanisch, was Herrn Stillich erfreuen wird, fordern doch Titel wie „Holonon“ lustige Verhörer geradezu heraus („Holt mol on“, Hohoho). Besondere Schmankerl: Angelique Kidjo ist bei „Gbeti Madjro“ zu hören, Franz Ferdinand auf dem Bonustrack „Lion Is Burning“, und die afrikanische Sängerin Fatoumata Diawara veredelt „Mariage/Ou C’est Lui“.
Orchestre Poly-Rythmo: Cotonou Club. Strut.
Die Website der Band. Poly-Rythmo auf Myspace.
Christina Mohr