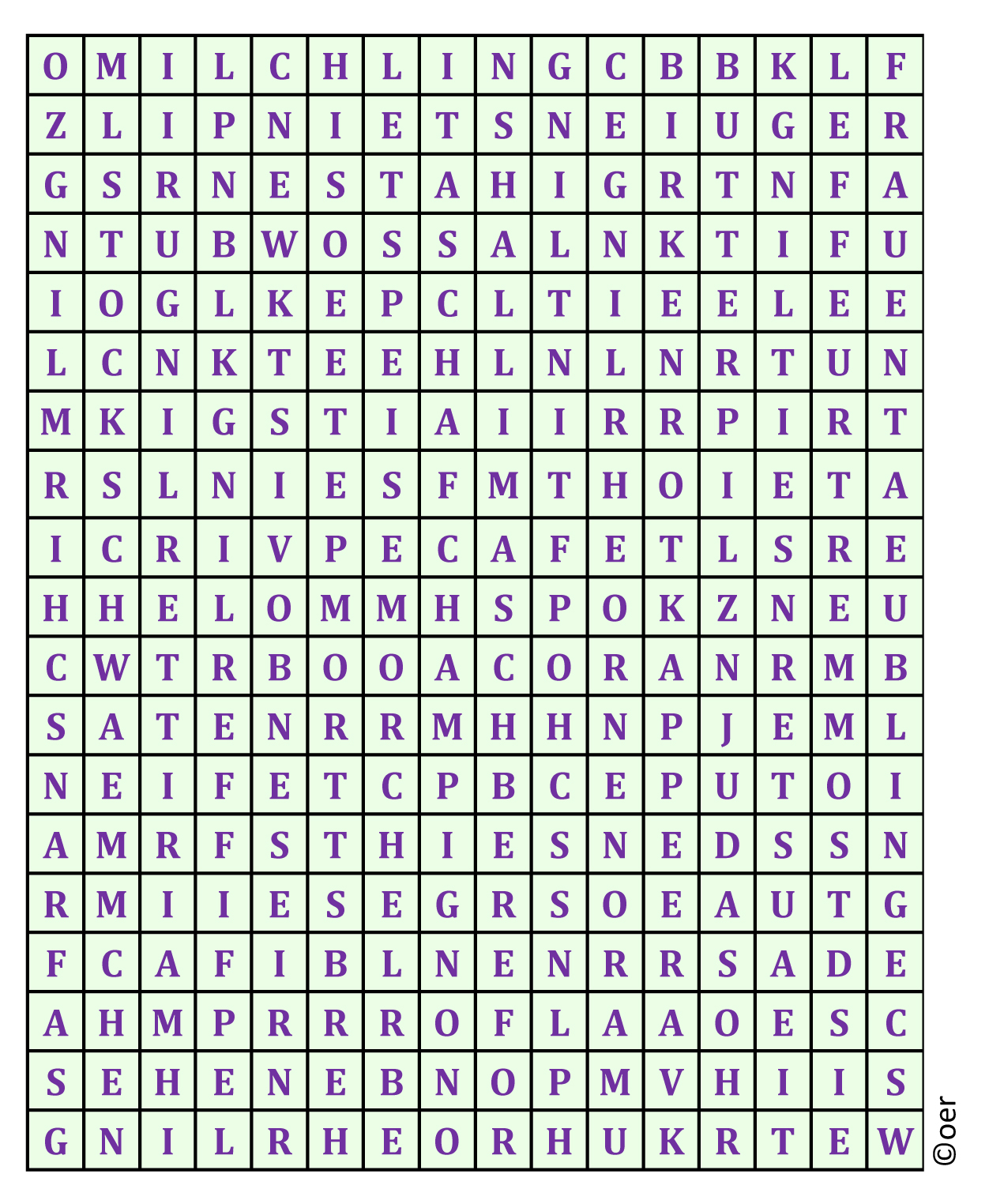Der Wochenrückblick von Christina Mohr diesmal mit:
 Depeche Mode: Delta Machine
Depeche Mode: Delta Machine
Während der gesamten 1980er Jahre begleiteten mich vier Jungs-, heutige Männerbands: The Cure, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Depeche Mode. Mit “begleiten” meine ich, dass ich alle ihre Platten kaufte, wenn möglich ihre Konzerte besuchte, die Texte fehlerfrei mitsingen konnte und mich in Einzelfällen zu auf T-Shirts bekundeter Schwärmerei hinreißen ließ (Cure/Ärzte). Im Lauf der Jahre kühlte die Beziehung vor allem zu den Toten Hosen und The Cure stark ab, die Gründe dafür liegen auf der Hand und werden an dieser Stelle nicht eingehender beleuchtet. Mit den Ärzten dagegen fühle ich mich bis zum heutigen Tag sehr wohl, irgendwie haben es BelaFarinRod geschafft, ihr inneres Kind ohne nennenswerten Zahn- und Haarverlust ins Erwachsenenleben mitzunehmen.
Womit wir beim SorgenKIND Depeche Mode angelangt sind, die auf ihrem dreizehnten Studioalbum “Delta Machine”, ihrem ersten Majorlabel-Deal (bisher traditionell Mute, jetzt Sony) relativ häufig das “child inside” bemühen, als könne die Beschwörung längst vergangener Jugendtage verhindern, dass die große Zeit dieser Band vorbei ist. Puh, das klingt hart, aber jetzt steht es da und soll auch nicht wieder zurückgenommen werden. Mit dieser Einschätzung bin ich nicht alleine, Sascha Kösch z.B. schreibt in De:Bug, dass Depeche Mode mit „Delta Machine“ (oh bedeutungsschwangerer Anfangsbuchstabenquatsch) ihr erstes schlechtes Album abgeliefert haben. Mit den letzten beiden Platten „Playing the Angel“ und „Sounds of the Universe“ beschritten DeMo neue Wege, gingen ganz im Sound auf, der roh, experimentell und krachwuchtig war. Von Experimentierlust ist auf „Delta Machine“ kaum etwas zu spüren, vielmehr vom allzu selbstzufriedenen Immerwiederaufkochen eigener Großtaten.
Es ist ja nichts gegen deftige, gute Selbstzitate zu sagen, macht Bowie schließlich auch und sieht ziemlich elegant dabei aus. Depeche Mode aber wirken im 34. Jahr ihres Bestehens stumpf, erdrücken ihre Musik mit staatstragendem Pathos, als verbeugten sie sich ehrfürchtig selbst vor ihrer langen Karriere. Beim Verbeugen guckt man aber nur auf den Boden, schadet seinem Rücken und kommt bestimmt nicht auf gute Ideen – gibt es doch mal welche, singt Dave Gahan mit Donnerhall gegen sie an. Songschreiber Martin Gore hatte offensichtlich keine besonders gute Phase, die besten Momente auf „Delta Machine“ sind nämlich diejenigen, die an frühere Zeiten erinnern wie z.B. das schwere, trockene Bluesintro vom dann leider ins altherrenmäßig Frivole abdriftende „Slow“ oder das hypnoide Synthiefiepen in „My Little Universe“. Man konnte auf den letzten Platten eventuell große Hit-Melodien vermissen, aber Depeche Mode waren stets Meister ihres Sounds – was sie jetzt, trotz bewährter Producer wie Ben Hillier, Flood und Christoffer Berg, nicht mehr sind.
Die düstere Magie, die seit den mittleren Neunzigern Depeche Modes Image prägte, ist dahin. Die „Delta Machine“ erzeugt Klänge, die nur noch entfernt an die einstige Größe der Band erinnern.
Depeche Mode: Delta Machine. SonyMusic. Zur Homepage und zum Video von „Soothe My Soul“
 James Blake: Overgrown
James Blake: Overgrown
Auch über James Blake gehen die Meinungen weit auseinander. Die Einschätzungen zum zweiten Album des auch jetzt erst 24-jährigen Londoners reichen von „jammerige, verheulte Jungsmusik“ (Facebook-Freundin x.) bis „der größte Songwriter seiner Generation“ (Frankfurter Rundschau). Beides stimmt. Blake kultiviert auf „Overgrown“ den fragil-zarten Falsettgesang, der auf seinem gefeierten Debüt von 2011 die kunstvoll gebrochenen Beats im Dubstep-Bett so überirdisch schön kontrastierte. Das kann man „jammerig“ finden, aber auch höchst anziehend anti-machohaft, sensibel und poetisch.
„Overgrown“ ist aber in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, denn das Album ist eine echte Weiterentwicklung auf der Basis des bisher Geschaffenen. Zum Beispiel – und darüber staunt Blake selbst am meisten – kann er nach dem riesigen Erfolg seines Debüts einfach alles ausprobieren und bei jedem anklopfen, weshalb Wu-Tang-Clanmitglied RZA in „Take A Fall For Me“ einen sehr lässigen Rap abliefert, und Brian Eno beim reggaelastigen, vergleichsweise optimistischen Elektroniksoul-Track „Digital Lion“ mitgearbeitet hat. Überhaupt, die Beats: die sind so unauffällig wie essenziell, „Retrograde“ schwebt geradezu auf zart-knackigen Handclaps und ist ätherischer R’n’B, wundervoll. In „Voyeur“ wird eine separierte Kuhglocke angeklöppelt, schattige Vocals und Synthieschleifen verschmelzen im endlosen Loop. „DLM“ und der Titeltrack sind ergreifend sakral, der Gospel eines dünnen, weißen, jungen Mannes, voller Zweifel und Melancholie, aber auch in Größe und Schönheit.
Coverversionen wie Feists „Limit to Your Love“ gibt es auf „Overgrown“ nicht, wobei dieser Schritt gewiss kein „nicht mehr“ einläutet: James Blakes Schwermut rettet ihn vor Größenwahn, weshalb „Overgrown“ sowohl eine Lektion in Demut als auch der Schritt in seine noch unvorstellbare, aber nicht anders als große Zukunft ist.
James Blake: Overgrown. Universal. Zur Homepage.
Peter Hook: Unknown Pleasures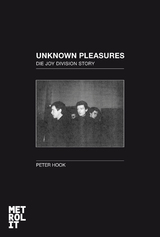
Von wem James Blake ästhetisch und optisch gelernt hat, sind Joy Division, über die schon so viele Bücher geschrieben wurden, dass Bassist Peter Hook entschied, dass sich endlich mal ein echtes Joy Division-Mitglied zu Wort melden sollte. Denn: „Viele Leute denken, dass sie wissen, was damals passiert ist. Wissen sie aber nicht. All die Leute, die ein Buch über Joy Division geschrieben haben oder einen Film gedreht haben – wer nicht bei uns im Bus gesessen hat, weiß gar nichts!“ schreibt Hooky und hat: Recht.
Der 1956 selbstverständlich in Salford geborene Peter Hook ist eine echte Frohnatur, der gern und viel lacht und oberflächlich betrachtet das genaue Gegenteil zum in sich gekehrten Ian Curtis ist – aber die Legende vom todessehnsüchtigen Problemfall Curtis gehört zur Joy Division-Saga wie so vieles anderes, das Hooky in seinem Buch „Unknown Pleasures“ genüsslich über den Haufen wirft. Denn natürlich waren Joy Division und später New Order zuallererst ein Haufen sehr junger Jungs, die so erfolgreich werden wollten wie die Sex Pistols und sich zu Beginn ihrer Karriere furchtbar darüber ärgerten, dass andere Bands aus Manchester wie z.B. The Fall schon längst Platten herausgebracht hatten, während die ehemaligen „Warsaw“ noch immer in kleinen Pubs vor ihren zwanzig besten Freunden spielten.
„Unknown Pleasures“ ist zwar das -zigste Buch über Joy Division, und dennoch ist es wichtig: weil es Mythen zerstört und trotzdem Joy Division nicht kaputt macht. Ganz im Gegenteil, man atmet richtiggehend auf, wenn Hooky über durchsoffene Nächte berichtet und Fotos von den nackten Hintern seiner Bandkollegen abbildet. Außerdem ist es nie verkehrt, die Geschichte des Postpunk von Beteiligten zu hören.
Peter Hook: Unknown Pleasures. Die Joy Division Story (Metrolit, Gebunden, 352 Seiten, übersetzt von Stephan Pörtner). Zur Webseite des Verlags.
ISBN: 978-3-8493-0064-7
 OMD: English Electric
OMD: English Electric
Das Erste, was man diesem Album vorwerfen kann/muss, ist, dass wegen der Promotion für “English Electric” der deutsche Teil von Claudia Brückens Tour mit ihrem Album „The Lost Are Found“ gestrichen wurde. Wie das zusammenhängt? Nun, OMD-Keyboarder Paul Humphreys ist Brückens Lebensgefährte und Musiker auf ihrer neuen Platte. Offensichtlich liegen OMD Humphreys aber doch noch ein bisschen mehr am Herzen als die Musik seiner Gattin, was ja verständlich ist und für OMD-Fans auch sehr erfreulich. Schade in diesem Zusammenhang ist nur, dass die neue OMD-Platte (drei Jahre nach dem Comeback-Album „History of Modern“) ziemlich öde geraten ist, Frau Brücken durch ihren Gastgesang immerhin ein paar Stücke aufwertet und man ihr deshalb etwas entgegen kommen könnte… aber gut, so läuft´s im Showbusiness 😉
„English Electric“ demonstriert auf langweilige Art, dass OMD, seinerzeit Orchestral Manoeuvres in the Dark in den frühen bis mittleren 1980er Jahren einer der besten, wegweisendsten und erfolgreichsten Elektropop-Acts aus England waren. WAREN, wohlgemerkt, denn die neuen Songs sind nur blasse Abbilder früherer Erfolge wie „Enola Gay“ und „Maid Of Orleans (The Waltz Joan of Arc)“ – sogar die Themenauswahl wiederholt sich, „Helen of Troy“ z.B. ist eine schwache Ode an eine historische Frauenfigur, kein Vergleich zu OMDs Riesenhit über die Heilige Johanna von 1981. Zwar ist Andy McCluskeys Stimme noch immer so eindringlich wie früher, aber die Vocals können auch nicht überdecken, dass OMD in den vielen Jahren ihrer Zusammenarbeit (die Trennung bzw. McCluskeys Solo-Karriere unter dem Bandnamen OMD mal beiseite gelassen) das Talent für tolle Melodien abhanden gekommen ist. Ihren typischen Sound können sie partiell noch einigermaßen nachbilden, aber in Gänze klingt „English Electric“ eher retrofuturistisch, also so, wie man sich in den frühen Achtzigern mal die Zukunft vorgestellt hat.
An Kraftwerk erinnernde, mal melancholische, mal euphorische Synthie-Flächen erheben sich über meist sehr unsensible 4/4-Beats und manchmal, bei „Atomic Ranch“ zum Beispiel, klingt das richtig schön. Das meiste aber wirkt very outdated, das können auch digitalisiert-verfremdete Stimmeffekte nicht wettmachen. Eine Platte für nostalgische Komplettisten und Night-of-the-Proms-Besucher.
OMD: English Electric. BMG (Rough Trade). Zur Homepage der Band und zu ihrem Facebook Auftritt.
 Yeah Yeah Yeahs: Mosquito
Yeah Yeah Yeahs: Mosquito
Eine Bemerkung vorab: „Mosquito“, viertes Album der Yeah Yeah Yeahs, ist keine Mainstream-Hitplatte geworden. Eine Entwicklung á la Gossip lag beim New Yorker Indiehipster-Trio um die charismatische Sängerin Karen O dabei durchaus im Bereich des Möglichen: seit dem letzten Album „It´s Blitz“ nahm Karen O den Soundtrack für „Wo die wilden Kerle wohnen“ auf und schrieb mit Trent Reznor einen Song für den Score von „Verblendung“. Und die Oper „Stop the Virgens“ verfasste sie auch noch, aber wer Opern schreibt, verweigert sich dem Mainstream ja sowieso – siehe Damon Albarn.
Typische Yeah Yeah Yeahs-Dancefloor-Hymnen wie „Zero“ oder „Gold Lion“ finden sich auf „Mosquito“ (produziert von David Sitek, wem sonst, möchte man ergänzen) nur in Form des Titeltracks und der Single „Sacrilege“, die mit einem durchgedrehten Gospelchor-Finale aufwartet und damit auch nicht wirklich hitverdächtig ist. Bei den übrigen neun Songs (+ vier Bonustracks auf der Limited Edition) erlauben sich Gitarrist Nick Zinner, Drummer Brian Chase und Mme. O alle Freiheiten und entgehen so der Langweiler-Falle. Erratisch, skizzenhaft und experimentell sind Tracks wie „These Paths“ oder die Sci-Fi-Spacerock-Ausflüge „Area 52“ und „Under the Earth“ geraten, bei denen man asiatisch anmutende Elemente heraushören kann. Beim gothic-inspirierten „Slave“ und dem so hoffnungsspendenden wie düsteren „Despair“ singt Karen O richtig schön Siouxsie-mäßig, während sie sonst die ganze Bandbreite ihres from-a-whisper-to-a-scream-Organs präsentiert. „Subway“ und „Buried Alive“ (mit einer oldschooligen Rap-Einlage von Dr. Octagon) verbinden spinnerte Künstlichkeit mit glamouröser Pop-Aura, mit dem „Wedding Song“ gelingt ein ähnlich melancholischer Ausklang wie mit „Turn Into“ vom 2006er-Album „Show Your Bones“.
Kurzum: nicht nur durch die Auswahl des einzigartig grässlichen Covermotivs versuchen die Yeah Yeah Yeahs ihre potenzielle Hochglanzkarriere zu verhindern, was an dieser Stelle ausdrücklich gewürdigt sein soll.
Yeah Yeah Yeahs: Mosquito. Universal. Zur Homepage und zum Video von „Sacrilege“
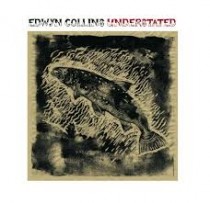 Edwyn Collins: Understated
Edwyn Collins: Understated
Ach, es ist doch immer wieder schön, von Edwyn Collins zu hören! „Understated“ ist das erste „richtige“ Album nach Collins’ schweren Schlaganfällen im Jahr 2005, die er nach langer Reha-Phase glücklicherweise gut überstand und „nur“ Einschränkungen in Bezug auf seine Fingerfertigkeit, sprich Gitarrespielen hinnehmen musste. 2007 veröffentlichte Collins mit Unterstützung seines Sohnes Will die Comeback-Platte „Home Again“, deren Songs aber schon vor seiner Erkrankung fertig gestellt waren. „Losing Sleep“ von 2010 war ein Buddy-Album, auf dem die schottische Postpunk-Legende befreundeten Musikern wie Nick McCarthy von Franz Ferdinand oder Johnny Marr die Bühne weitgehend überließ.
„Understated“ ist nun ganz der neue alte Edwyn, mit einer kleinen Schar Begleitmusiker und erneut mit seinem Sohn am Bass; die Coverzeichnung und –typo stammt von Collins selbst. Für Jammern und Klagen ist ohnehin keine Zeit: „what the heck, I´m living now“ croont Edwyn in „31 Years“, das sehr unmittelbar auf seine lange Musikerlaufbahn Bezug nimmt und gleichzeitig der Welt entgegenruft, dass noch lange nicht an den Ruhestand zu denken ist. Dafür wäre es auch definitiv zu früh, denn die Songs klingen so frisch, zupackend und optimistisch, als schrieben wir 1980 und nicht 2013. Mit über 50 hat Edwyn Collins seine Form gefunden, die bruchlos Gestern und Heute verbindet. Seine alte Band Orange Juice blitzt atmosphärisch durch, die Liebe zum Soul („It´s A Reason“, „Too Bad, That´s Sad“) ist ungebrochen, ebenso der Hang zu schrammelnden, twangenden Gitarren und hymnischen, perfekten Popsongs.
„Understated“ ist ein Dokument des Lebensmuts in elf Stücken: „I´m so lucky to be alive“ singt er in „Forbooth“, und es liegt kein Gramm Zynismus darin. Nur die reine Freude.
Edwyn Collins: Understated. AED Records. Zur Homepage.
Christina Mohr