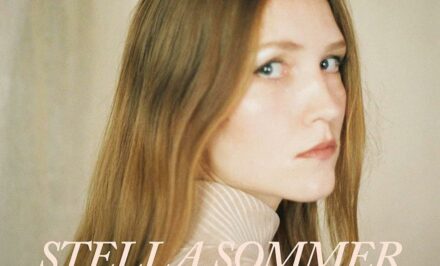In einer neuen Ausgabe ihrer Kolumne begibt sich Christina Mohr auf einen Streifzug durch Bücher, die sich mit dem Phänomen Pop beschäftigen. Ein Album der Pet Shop Boys darf bei diesem Thema natürlich nicht fehlen.
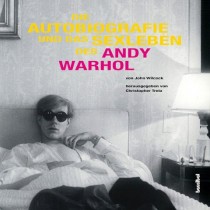 Andy Warhol Superstar
Andy Warhol Superstar
„Es wäre besser, Andy Warhol hätte es nie gegeben“, sagt Mark Greif, der momentan zu Recht allgegenwärtige New Yorker Hipster-Intellektuelle. Der schelmische Greif, der solche griffig-provokanten Thesen wie nebenbei aus dem Ärmel schüttelt, meint damit: Durch Warhol kamen die Anführungszeichen in die Kunst, was dazu geführt hat, dass in Formaldehyd eingelegte Haie höher gehandelt werden als ein van Gogh oder Picasso. Darüber ließe sich vortrefflich streiten, schließlich ist Ironie (intendiert oder nicht) ein Hauptmerkmal von Pop und Camp – und Pop (Art) wiederum ohne Andy Warhol nicht denkbar, jedenfalls nicht the way we know it.
Warhol selbst war klug oder schlichten Gemüts genug, um so gut wie nichts über sich preiszugeben. Er erklärte weder sich noch seine Kunst, und sprach er doch etwas, kamen Gemeinplätze dabei heraus wie „Everything is beautiful“, die je nach Sichtweise als hohl oder zutiefst philosophisch ausgelegt werden können. Das Phänomen Andy Warhol brachte aber seit seinem ersten Erscheinen viele Menschen dazu, über ihn zu reden – die Person Warhol setzt sich aus dem zusammen, was andere über ihn zu sagen hatten. Bei Hannibal ist kürzlich ein Buch erschienen, das aus einer Idee Paul Morrisseys von 1971 entstand. Morrissey, damals Warhols Manager und Village Voice-Gründer und Interview-Mitbetreiber John Wilcock suchten nach Leuten, die auf irgendeine Weise mit Warhol zu tun hatten: als seine Superstars, Galeristen, FreundInnen, Factory-Besucher, etc. und befragten sie, wann, wie und wo sie Andy kennengelernt hatten, was ihnen besonders bemerkenswert an ihm erschien, ob sie glaubten, dass er reich sei oder gar sexy. Auftretende Personen: Brigid Polk, Marisol, Gerard Malanga, Eleanor Ward, Nico, Taylor Mead, Henry Geldzahler und viele mehr.
Der Buchtitel „The Autobiography And Sex Life Of Andy Warhol“ war so unverschämt irreführend und großspurig, dass er allein schon als Pop Art-Kunstwerk durchgeht und er ist im Grunde gar nicht falsch: Andy Warhol war ohne seine Entourage nichts, weshalb das „Auto“ in „Biography“ schon in Ordnung geht. Über sein Sexleben erfährt man außer Andeutungen freilich nur wenig, dafür jede Menge andere interessante Dinge über den Kunstbetrieb der späten sechziger Jahre und natürlich über New York. Das Buch war rasch vergriffen und wurde nicht wieder aufgelegt, bis der Fotograf Christopher Trela eine Ausgabe im Antiquariat erstand und so begeistert davon war, dass er es in neuer Gestaltung, ergänzt um bis dato unveröffentlichte Fotos und Abbildungen von Warhol-Werken vor kurzem wieder herausbrachte. „Die Autobiografie und das Sexleben des Andy Warhol“ ist ein reich bebildertes Who Is Who der New Yorker Kunstszene und es wird klar, dass Mark Greif mit seinem Zitat nur zu scherzen beliebt.
John Wilcock: Die Autobiografie und das Sexleben von Andy Warhol (Hannibal, Gebunden mit Schutzumschlag, 256 Seiten). Zum Verlag.
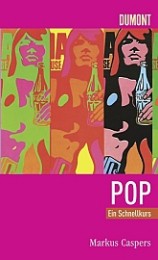 The Age of Popkultur
The Age of Popkultur
Ob man Andy Warhol als Pop-Art-Heiligen verehrt oder als Scharlatan verdammt, niemand wird bestreiten, dass wir uns seit gut fünfzig Jahren in the Age of Popkultur befinden. Oder eigentlich sogar noch länger: spätestens mit dem Aufkommen von Lichtspieltheatern, Musikautomaten und bebilderten Zeitschriften wurde Kunst und/oder Unterhaltung für alle zugänglich, die ein paar Cent erübrigen konnten, um Bilder zum Laufen und Töne zum Schwingen zu bringen. Genüsse der leichten und schwereren Muse waren seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr das Privileg der Reichen und Adligen, endlich konnte sich das gesamte Volk den Sangeskünsten eines Enrico Caruso, dem Schmachtblick eines Rudolpho Valentino hingeben.
In den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs explodierte die populäre Kultur nur so: Kino, Elvis, die Beatles und der Minirock, Woodstock – wollten die Jugendlichen zunächst an allem teilhaben, was die Erwachsenenwelt bot, kämpften sie etwas später umso erbitterter dagegen an, jeweils von typischen Soundtracks untermalt und passenden Bildern illustriert. Pop ist mehr als die Summe seiner Teile, mehr als das Nebeneinander-Existieren verschiedener Künste wie Musik, Malerei, Design, Schriftstellerei, Mode, Architektur; Pop ist eine umfassende Ästhetik und ein Lebensgefühl, das inzwischen nicht mehr den Jugendlichen vorbehalten ist, sondern alle Generationen miteinschließt. Der vom Neu-Ulmer Professor für Gestaltung und Medien Markus Caspers für den Dumont Verlag zusammengestellte „Schnellkurs Pop“ fasst auf 180 Seiten alles Wichtige zusammen: der kundige Caspers reitet im Eiltempo durchs 20. und junge 21. Jahrhundert und vergisst weder Comic, Werbung, Mode, Literatur, Clubkultur, Musik, Film, noch technische und ästhetische Errungenschaften und bringt immer die richtigen Beispiele. Caspers begnügt sich nicht mit dem Aufzählen der immergleichen Protagonisten (Warhol) und Artefakte (Suppendosen), er zeigt auch Abseitiges („Lavalampen“-Softerotiksampler) und Spezialwissen (Black Flag; Rave), woraus sich Pop ja immer zuerst speist, bevor der avantgardistische Trend zum Mainstream wird.
Markus Caspers: Pop. Ein Schnellkurs (Dumont, Broschur, 189 Seiten). Zum Verlag.
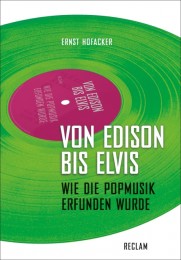 Die Kunst mischt sich unters Volk
Die Kunst mischt sich unters Volk
Einen komplett anderen Ansatz als Caspers‘ Schnellkurs (Gesamtphänomen in Kurzform ) verfolgt der Musikjournalist Ernst Hofacker in seinem bei Reclam erschienenen Buch „Von Edison bis Elvis“, in dem er die Entstehung der Popmusik von ihren Anfängen erläutert. Der Untertitel „Wie die Popmusik erfunden wurde“, ist natürlich Quark, denn Pop wurde nicht erfunden, sondern entstand – zwar nicht ganz von selbst, aber wie von selbst. Zunächst werden Geräte und Medien konstruiert, die Klänge und Bilder allen zugänglich machen (siehe auch Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“) und schon sitzt die Kunst nicht mehr auf ihrem hohen Ross, sondern mischt sich unters Volk.
MusikerInnen und SchauspielerInnen werden weit über ihren Wirkungskreis hinaus bekannt, und: Sänger wie Caruso bleiben nach ihrem Tod weiterhin beliebt und berühmt. Von der Schellackplatte bis zum iPod war es ein langer Weg, der auch wirtschaftliche Umwälzungen mit sich brachte. Ernst Hofacker bezieht alle Aspekte mit ein und widmet sich mit besonderer Hingabe der Herleitung der verschiedenen Wurzeln, aus denen Popmusik entstand: Hillbilly, Country, Jazz, Blues, Klassik, Rag, Doo Wop mit ihren Protagonisten (soweit bekannt) werden ausführlich vorgestellt, daneben die jeweiligen technischen Neuerungen von der Tonwalze über das Radio, Geräte wie das Theremin und der Synthesizer bis zum MP3-Musikdateiformat. Hofacker befasst sich hauptsächlich mit der Zeit zwischen 1880 und 1950, die Jahrzehnte danach bis heute streift er eher sporadisch, was ein bisschen schade ist, denn schließlich hat sich Popmusik und ihre Rezeption – sowohl in ästhetischer als auch ökonomischer Form – in den letzten Jahren drastisch verändert.
Ernst Hofacker: Von Edison bis Elvis. Wie die Popmusik erfunden wurde (Reclam, Broschur, 460 Seiten). Zur Verlags-Seite.
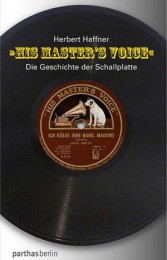 Unterhaltsame Geschichte
Unterhaltsame Geschichte
Einer der Schutzheiligen der Popkultur im Allgemeinen und der Popmusik im Besonderen ist Emil(e) Berliner: der 1851 als Sohn deutsch-jüdischer Kaufleute in Hannover geborene leidenschaftliche Erfinder gilt als Vater der Schallplatte und des Grammophons. Ob Berliner tatsächlich als Erster Gerät und Medium der Weltöffentlichkeit präsentierte oder ob es schnellere Mitbewerber gab, wird sich womöglich nie ganz aufklären lassen. Fakt ist, dass die Berliner-Familie große Popaffinität aufweist: Bruder Joseph gründete die Deutsche Grammophon Gesellschaft und war außerdem an der massenhaften Verbreitung des Telefons maßgeblich beteiligt.
Ob nun Emil Berliner oder jemand anderem der Lorbeerkranz gebührt: ohne die Schallplatte gäbe es die Popmusik nicht, auch wenn das gute alte Vinyl heutzutage kaum noch eine Rolle bei der Verbreitung neuen Tonmaterials spielt. Der Klassik- und Kulturjournalist Herbert Haffner zeichnet in „His Master´s Voice“ die Biografie der Schallplatte unterhaltsam nach und endet fatalistisch-schwarzhumorig, indem er die englische Firma And Vinyly empfiehlt, die die Asche von verstorbenen Musikliebhabern zu Schallplatten presst.
Herbert Haffner: His Master´s Voice. Die Geschichte der Schallplatte (Parthas, Gebunden, 280 Seiten).
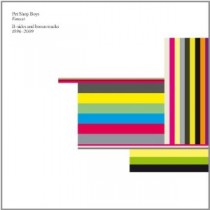 B-Seiten und Bonustracks
B-Seiten und Bonustracks
Kaum eine Band bekennt sich so bedingungslos zum Pop wie die Pet Shop Boys. Große Gesten, konsequente Durchästhetisierung des Gesamtprodukts, Verschmelzen von Intellekt und Mainstream-Kompatibilität. Seit dreißig Jahren machen Neil Tennant und Chris Lowe gemeinsam Musik, im Herbst 2012 soll nach „Yes“ (’09) ein neues Album erscheinen. Mit „Format“ veröffentlichen PSB jetzt eine 38 Stücke starke Sammlung von B-Seiten und Bonustracks aus den Jahren 1996 bis 2009. Die Pet Shop Boys haben die B-Seite (als es sie noch gab) nie als zweitrangig betrachtet, sondern haben dort häufig mehr ausprobiert und gewagt als auf den als Hits definierten Songs. Chris Lowe merkt zudem lapidar an: „We do stockpile songs.“ Dieses für einen Popmusiker recht nüchterne Bekenntnis kann man im Booklet zu „Format“ nachlesen, in dem sich ein Interview von Jon Savage (u. a. Autor des „Faber Book of Pop“) mit den Pet Shop Boys befindet – sozusagen ein Gipfeltreffen des Pop.
Savage stellt im Grunde wenige Fragen, sondern bewirft PSB lediglich mit den Titeln ihrer Songs, was Lowe und Tennant aber völlig zu genügen scheint. Die Geschichten zu den Tracks sind mindestens so toll wie die Songs selbst: so ist „The truck-driver and his mate“ durch eine homoerotische Schokoriegel-Werbung inspiriert, „Discoteca“ reflektiert wie viele andere PSB-Stücke die Post-Aids-Ära. „Confidential“ sollte ursprünglich von Tina Turner gesungen werden und es ist wahrscheinlich ein sehr glücklicher Umstand, dass sie den Song nicht mochte und die Pet Shop Boys ihn selber aufnahmen.
Auf CD 2 ist Elton John auf einer Version von „In Private“ zu hören – Dusty Springfields brüchig-heisere Stimme passt besser zu diesem Lied als Eltons hier beinah dröhnendes Organ, andererseits ist die Kombination PSB/Elton John mehr als sinnfällig. Die Pet Shop Boys lösen sich auf ihren B-Seiten gern von ihrem eingeführten Elektro-Disco-Pop, spielen mit Rock, Techno und House, bleiben aber immer erkennbar PSB. Der Albumtitel „Format“ ist nicht zufällig gewählt, neben den musikalischen Experimenten lässt sich die technische Entwicklung der musikalischen Reproduktion der letzten 25 Jahre nachvollziehen: vom Kassettentrack über DVD- und Videosingles bis zum Download-only haben die Pet Shop Boys stets jede technische Neuerung mit Freuden ausprobiert. Die CD als Medium für diese Songauswahl ist ein freundlicher Kompromiss, ein Zugeständnis an jene Fans, die sich (noch) nicht vom physischen Tonträger verabschieden möchten.
Pet Shop Boys: Format. Doppel-CD. EMI Catalogue. Zur Homepage der Band.