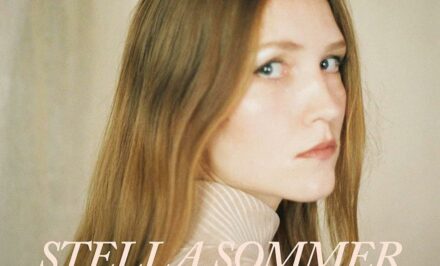Jetzt aber schnell, die nächste Buchmesse kommt bestimmt! Wie es manchmal so ist: eigentlich hätte diese Kolumne vor der Sommerpause erscheinen sollen, als vorurlaubliche Leseempfehlung sozusagen. Dieser Plan wurde durch verschiedene Vorkommnisse vereitelt, unter anderem dadurch, dass die betreffenden Bücher von Christina Mohr erst in ihrem eigenen Urlaub gelesen werden konnten und sich die Bearbeitung deshalb stark verzögerte. Zum Glück wird Papier ja nicht so schnell schlecht und wir schicken die Leseeindrücke eben jetzt heraus, gerade noch rechtzeitig vor der kommenden Frankfurter Buchmesse und ihren 90.000 Neuerscheinungen…
 Nur Zombies und Verrückte
Nur Zombies und Verrückte
Dass Dee Dee Ramones Roman „Chelsea Horror Hotel“ skurrile Leseerfahrungen verspricht, dürfte auf der Hand liegen. Douglas Glen Colvin (*1951 oder 52, verstorben 2002), seines Zeichens Gründungsmitglied und Bassist der Ramones, lebte einige Jahre im legendären New Yorker Künstlerhotel Chelsea an der 23. Straße und teilte sein Zimmer mit Gattin Barbara, Hund Banfield und jeder Menge Drogen. Unruhig, getrieben und stets auf der Suche nach etwas zu rauchen, zu schlucken oder zu drücken streift Dee Dee durch das im Lauf der Jahrzehnte ziemlich runtergekommene Hotel und trifft auf bizarre Figuren, die ebenfalls im Chelsea leben oder als Untote durch die Flure schlurfen, man weiß es nicht genau.
Dee Dee leidet an Albträumen und Wahnvorstellungen und ist unter anderem davon überzeugt, dass die Hotelleitung ihm und Barbara das sagenumwobene Zimmer 100 angedreht hat, in dem Sid Vicious angeblich Nancy Spungen erstach. Zimmer 100 existiert offiziell aber gar nicht mehr – und diese Merkwürdigkeit ist nur ein Anlass für Dee Dee, sich die abstrusesten Gedanken zu machen. Im Chelsea Hotel gibt es keinen einzigen normalen Menschen, nur Zombies, Verrückte, Junkies, NymphomanInnen, Betrüger, Dealer, Mörder, etc.pp., die schreckliche, irre Dinge tun. Dee Dees Paranoia führt dazu, dass er sich von jedem und allen verfolgt und gepeinigt fühlt und vor seinem inneren Auge Massaker auf Massaker abläuft.
Höhepunkt der wortgewordenen Horrorshow ist ein Konzert mit seinen toten Punkrockfreunden Sid Vicious, Johnny Thunders und Stiv Bators – dass zu guter Letzt auch noch der Teufel mit von der Partie ist, wundert sicherlich niemanden mehr, am wenigsten den guten Dee Dee. „You´ll leave with your feet first“, lautet eine der vielen Warnungen vor dem Chelsea Hotel. Für Dee Dee Ramone bewahrheitete sich die Prophezeiung leider: nach einer Überdosis Heroin checkte er für immer aus.
Dee Dee Ramone: Chelsea Horror Hotel (Chelsea Horror Hotel, 2001). Übersetzt von Matthias Penzel. Milena / Beastie Books 2012. Gebunden. 227 Seiten. 19,90 Euro. Mehr hier.
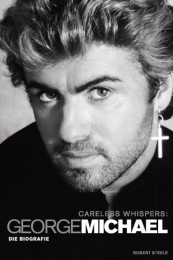 Bewundertes biografiertes Objekt
Bewundertes biografiertes Objekt
Drogen spielen im Leben von Georgios Kyriacos Panayiotou a.k.a. George Michael ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle, das Buch „Careless Whispers“ von Star-Biograf Robert Steele ist allerdings so akribisch und beinah lückenlos recherchiert, dass man buchstäblich jeden Joint mitrauchen kann, den George bis zum Jahre 2011 (Erscheinungsjahr der Originalausgabe bei Omnibus Press) gebaut hat.
Steele zeichnet den Lebensweg des Sohnes einer britischen Mutter und eines griechisch-zypriotischen Vaters in London nach, begleitet ihn in die Schule und natürlich in den ersten Proberaum, wo der längst noch nicht geoutete George mit seiner ersten Band The Executive die Prä-Wham!-Phase einläutet. Die Geschichte um George und Andrew Ridgeley und ihren Manager Simon Napier-Bell ist popkulturelles Allgemeingut, wer noch Unsicherheiten zeigt, sollte in Steeles Buch unbedingt hineinlesen. Das gilt genauso für die Post-Wham!-Zeit, in der George Michael erst richtig zum Weltstar aufstieg; die harten Jahre, in den George den Tod seiner Mutter und seines Freundes zu verkraften hatte.
Das einzige, was man Robert Steele vorwerfen kann, ist der Umstand, dass er – wie viele Biografen – gern den Eindruck erweckt, praktisch überall dabei gewesen zu sein: am Frühstückstisch mit Georges geliebter Mama und Schwester beispielsweise; oder küchenpsychologische Kommentare zu George Michaels Trotzphase und Pubertät. Solche Aufblähungen sind ärgerlich, aber üblich, und deshalb sollte man Steele nicht zu sehr zürnen. Er bewundert sein biografiertes Objekt und füllt stolze 360 Seiten, die man spätestens bis zu George Michaels 50. Geburtstag am 25.6.2013 auch bestimmt durchgelesen hat.
Robert Steele: Careless Whispers: George Michael. Die Biografie. Übersetzt von Maximilien Vogel und Hannes Köhler. Bosworth Edition 2012. 362 Seiten. 18,75 Euro.
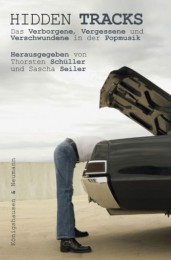 Verborgenes
Verborgenes
Das Thema klingt erstmal sehr spannend: einen ganzen Reader über das „Verborgene, Vergessene und Verschwundene in der Popmusik“ haben Sascha Seiler und Thorsten Schüller zusammengestellt und wecken zumindest bei mir hohe Erwartungen – die nur zum Teil erfüllt werden.
Manche Geschichte wurde schlicht und einfach schon oft erzählt, wie zum Beispiel, dass das Werk der Berliner Band Die Tödliche Doris sehr viel mit dem Nicht-Zeigen und Nicht-Sagen zu tun hat. Wenn dann auch noch ein gewisser Matthias Motte (sic!) erfunden wird, der angeblich als Doktor Motte Techno-Geschichte schrieb, wird man doch ein wenig misstrauisch.
Der im Grunde höchst interessante Artikel über den zurzeit gar nicht so sehr verschwundenen Holger Hiller (Palais Schaumburg treten derzeit häufig auf, das erste Album wird im Herbst wiederveröffentlicht) basiert auf einem Interview, das vor zwei Jahren in der De:Bug erschien, also einigen schon bekannt sein dürfte. Auch dass man in Morrisseys Texten verklausulierte biografische Details aufstöbern kann, die eventuell auf seine sexuellen Begierden oder Nicht-Begierden schließen lassen oder eben auch nicht, hat man so oder ähnlich schon oft gelesen.
Schade ist es, dass Autor Torsten Hoffmann für sein wirklich essenzielles und existenzielles Topic des Todes im Popsong als Beispiele Songs von Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen und – okay – Peter Gabriel aussuchte. Beim Lesen fallen einem sofort hundert Titel ein, die der genaueren Betrachtung ebenso würdig gewesen oder sogar noch passender gewesen wären.
Sehr lesenswert dagegen ist Jonas Engelmanns Vorstellung des in der Tat sehr verborgenen amerikanischen Songwriters Jandek, der unzählige Alben veröffentlicht hat, offensichtlich über eine treue Fangemeinde verfügt und dennoch so unbekannt ist, dass zumindest hierzulande noch niemand je von Jandek gehört hat.
Thorsten Schüller, Sascha Seiler (Hg.): Hidden Tracks. Das Verborgene, Vergessene und Verschwundene in der Popmusik. Königshausen & Neumann 2012. 218 Seiten. 29,80 Euro.
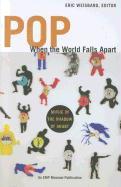 Notwendige und richtige Fragen
Notwendige und richtige Fragen
Der bei Duke University Press erschienene Sammelband „POP when the world falls apart“ ist ungleich spannender: das Experience Music Project EMP konferierte zuerst im Jahre 2002 und beschäftigt sich seitdem mit der Rolle der Popmusik in Zeiten des Irakkrieges, religiös initiierter Terroranschläge und den Auswirkungen von Naturkatastrophen wie Hurricane Katrina. Hat Pop heutzutage noch etwas zu sagen, wirken Poptexte noch so aufrührerisch und gesellschaftsumwälzend wie in den 1960er-Jahren – oder hat Pop aufgegeben und beschränkt sich auf das unterhaltende Moment?
Diesen Fragen gehen AutorInnen wie Jonathan Lethem, Scott Seward, Diane Pecknold, Alexandra Vazquez oder Eric Lott nach, beleuchten unheilige Allianzen (Folkmusic/Dead Cultures) oder stellen die provokante Frage, ob nur tote Künstler gute Künstler sind (Karen Carpenter, Elvis). Das Experience Music Project findet keine allgemeingültigen oder beruhigenden Antworten, stellt aber definitiv die notwendigen und richtigen Fragen.
Eric Weisbard (ed.): POP when the world falls apart. Music in the Shadow of Doubt. Duke Press/ An EMP Museum Publication 2012. 330 Seiten. 21,99 Euro.
Christina Mohr