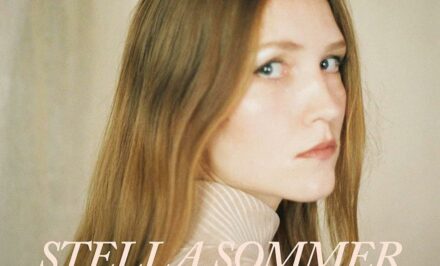Intellektuelle Weichspülung
Intellektuelle Weichspülung
Schamonis beste Zeiten scheinen vorbei zu sein. Er und seine Mitstreiter von Little Machine präsentieren zahme Melodien samt zahnloser Texte.
Singen kann er nicht, das steht fest. Rocko Schamoni trällert noch unbeholfener als einer seiner größten Bewunderer, Jochen Distelmeyer. Für den Sänger und Texter von Blumfeld ist und bleibt Rocko einfach der „King“. Wer aus der „Hamburger Schule“ schert sich schon um den Gesang. Solange die leichtgewichtigen Arrangements den schwergewichtigen Gedanken Auftrieb verleihen, hat man in dieser musikalischen Schule das Klassenziel schon erreicht. Der an der Alster residierende, komponierende und dichtende Allroundkünstler hat sich auf seiner neuesten CD dieser „Bewegung“ angeschlossen und einen der Mitbegründer der bewusst auf mittelmäßige Kompositionen und kritische Texte setzenden Poprichtung als Produzent angeheuert. Der Einfluss von Tobias Levin ist nicht zu überhören, der von Rocko Schamoni schon.
Kuschelrock statt Punkrock
Vom Punkrock der frühen Jahre ist bei seinen neuestem musikalischen Ausflug partout nichts zu spüren. Stattdessen breitet er einen Soundteppich aus, der sich so flauschig anhört wie sich ein Flokati aus den 70ern anfühlt. Die in lockere Lounge-Schwaden gehüllten Lebensweisheiten finden nicht so recht den Weg vom Gehörgang in die Gehirnwindungen. Aber genau die steuert Schamoni in seinen zehn neuen Songs an, wenn er auf Hammond-Orgel, Synthie-Bass, E-Gitarre und Schlagzeug den freien menschlichen Willen in Frage stellt. Schopenhauer und Adorno lassen in einfältigen Textvariationen oder plumpen Anspielungen grüßen: „Ein richtiges Leben in einer falschen Welt“ heißt es im musikalisch einfallsreichsten Song. Hier hat sich jemand kräftig aus dem Zitatenschatz des Frankfurter Sozialphilosophen bedient, der einmal meinte, das wir im Industriezeitalter das richtige Leben im falschen lebten. Wenn es da nicht sofort bei allen Abiturienten und Studienabbrechern klingelt.
Schamoni erreicht mit sanften Rhythmen und halbgarer Lyrik weder Herz noch Kopf. Er segelt mit den Songs, besonders mit „Weiter“ so dicht in Blumfelds musikalischem und intellektuellem Windschatten, dass von seiner einstigen Schlagfertigkeit und Individualität kaum noch ein Hauch zu spüren ist. Provokationen mutieren nun zu generationsübergreifenden Pöbeleien wie in „Jugendliche“ („Wir haben schon genug Ärger. Mit den Rentnern. Und mit Verbrechern. Mit Verbrechern wie Euch. Ihr seid wahrscheinlich Verbrecher“).
Das alte Lied vom freien Willen
Dass der freie Wille nur eine Chimäre ist, braucht uns Schamoni nicht mehr vorwurfsvoll ins Ohr zu flöten („Wir suchen nach Wegen. Nach eigenen Spuren. Und bilden uns ein. Wir könnten entscheiden“). Spätestens seit Schopenhauer wissen wir es ohnehin besser. Und der Hirnforscher Wolf Singer vermag unsere liebgewonnenen Illusionen sogar neurobiologisch zu widerlegen und mit Sätzen wie „Der freie Wille ist nur ein gutes Gefühl“ viel entspannter auszudrücken. Schamonis pseudointellektuelle Weichspülungen sind quasi „überflüssig“. Das philosophische Problem ist für Schamoni einfach eine Nummer zu groß.
Doch der Pessimist scheint die Existenz von Freiheit und Liebe nicht wirklich zu leugnen. Auch wenn es in „Muster“, dem Schlüsselsong des Albums, heißt: „Es gibt keine Freiheit. Es gibt keine Liebe“. Zum Trost für alle Fans des vom Dorfpunk zur popkulturellen Allzweckwaffe gereiften Künstlers wird man feststellen dürfen: Schamoni bleibt sich zumindest auf der zweiten Hälfte des Albums treu. Und zwar als rebellischer Romantiker. Am Ende zählt bei ihm nämlich doch das Gefühl. „Infektion“ erzählt von der lebensnotwendigen Liebe, die mit gedämpften Handclaps beklatscht und von einem charmanten „Jungfrauenchor“ besungen wird. „Das erste Mal“ greift das Thema nochmals auf, nähert sich ihm ein bisschen intimer, ohne jedoch ins Schmuddelige oder Ironische abzudriften.
Schwer verständliches Pathos
Und so säuselt uns Schamoni die Ohren voll, frei von Ironie, frei von Zynismus. Aber keineswegs frei von leichter und schwerer verständlichem Pathos wie in „Der See“ oder in „Der Weg“, das so gitarrenselig daherkommt wie die Harmonien des deutsch-französischen Chansoniers Reinhard Mey. Übrigens ein pures Instrumental, das nur im Booklet zur Sprache findet. Zu einer Sprache, die genauso verdreht ist wie die von ihm gefürchtete „schwarze Gedankenspirale.“
„Unser Sein ist Provokation“, heißt es im zivilisationskritischen Finale „Tiere in der Großstadt“. Doch das einzige, womit er neuestens provoziert, ist die Hinwendung zum softintellektuellen Deutsch-Pop Hamburger Machart und die Abkehr vom individuellen Poptrash. Seine mittlerweile zwölfte LP/CD zählt sicherlich nicht zu den „Sternstunden der Bedeutungslosigkeit“ (so der Titel seines im April erscheinenden Buches). Wenn es wirklich die letzte Platte ist, wie er es zaghaft der Öffentlichkeit kundtut, dann haben „ein Jahr Vorbereitung, elf Probetreffen, vier Probekonzerte, vier Wochen im Studio, vier Wochen zu Hause im Schnitt“ nur sein künstlerisches Ego befriedigt. Aber nicht die Freunde seines skurrilen Humors.
Jörg von Bilavsky
Rocko Schamoni & Little Machine: s/t. Trikont, US-0359 (Vertrieb: Indigo.)
Reinhören bei Trikon