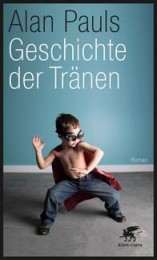 Kopfgeburt
Kopfgeburt
– Es gibt Romane, für die bin ich wohl zu schlicht, um sie zu goutieren. Bleibt mir nur, den Hut zu ziehen vor den Kritikern, die aus ihnen die klügsten Dinge herauszulesen verstehen und sich bestens mit ihnen unterhalten, während ich mich gelangweilt, ja genervt von Seite zu Seite quäle. „Geschichte der Tränen“ des Argentiniers Alan Pauls ist ein solcher Roman. Von Eva Karnofsky
Der Inhalt ist schnell erzählt. Ein namenloser Mann erinnert sich – und ein allwissender Erzähler gibt es in Fragmenten wieder – an Episoden seiner Kindheit mit der ständig leidenden Mutter, die nach der Scheidung zu ihren Eltern zurückgekehrt ist. Sie liefert ihn, gerade vierjährig und in einem Superman-Kostüm, wenn sie ausgehen will, bei einem Nachbarn ab, der Offizier zu sein scheint. Und er denkt an die Wochenenden mit dem Vater zurück, einem Bonvivant, der ihn zu gemeinsamen Unternehmungen abholte.
Unseren Protagonisten zeichnet zudem zweierlei aus: Jeder schüttete ihm, weil er so gut zuhören konnte, von klein auf sein Herz aus und immer, wenn er mit dem Vater zusammen war, brach er ob des kleinsten Anlasses in Tränen aus. Das führte dazu, dass er irgendwann keine Tränen mehr hatte. Das wars? Das wars. Spannungsbogen? Durchaus: Der Offiziersnachbar, dem der Protagonist im Übrigen einmal vor die Füße kotzt, stellt sich später nicht nur als Frau, sondern auch als Guerilla-Kommandantin im Untergrund heraus.
Liebling des argentinischen Bildungsbürgertums
Der Autor Alan Pauls gehört seit einiger Zeit zu den Lieblingen des argentinischen Bildungsbürgertums oder zumindest zu dem Teil, der sich zur aufgeklärten Linken zählt. Wer sich gegen die unselige Heiligsprechung der Guerillabewegungen der Sechziger- und Siebzigerjahre wendet, wie sie die derzeitige Regierung betreibt, wird sich in der „Geschichte der Tränen“ zumindest gelegentlich wiederfinden (auch wenn ein Autor wie Martín Caparrós das Thema weitaus vielschichtiger bearbeitet) und wissend nicken, wenn Pauls seinen Protagonisten 1974, damals dreizehnjährig, zum Kiosk eilen lässt, wo er die neueste Nummer der Zeitschrift der Linksperonisten ergattert, um sie dann förmlich einzusaugen (obwohl sie doch gänzlich unprofessionell gemacht war – da spüre selbst ich die beißende Kritik des Autors an seiner Generation). Wenn Pauls dann noch die Polit-Theoretiker der damaligen Zeit anruft, die unser Protagonist bereits in frühester Jugend verschlang und mit denen heute wohl nur noch Politologen etwas anfangen können, dürfte dies so manchem Revolutionsromantiker die Tränen in die Augen treiben. Selbst wenn er Ernest Mandel oder Marta Harnecker nie gelesen hat.
Deutsche Leser fahren auf die Aufarbeitung der argentinischen Diktatur besonders ab, so dachte sich wohl der Verlag von Pauls und verkauft die Geschichte der Tränen unter diesem Rubrum. Dem Protagonisten offenbare sich die Skurrilität des Lebens in einer Militärdiktatur, heißt es auf der Buchrückseite. Ob damit jenes Fragment gemeint ist, in dem unser Protagonist an einem der Wochenenden mit seinem Vater das erste Konzert eines Liedermachers nach dessen Rückkehr aus dem Exil besucht und sich in der Rückschau heftig darüber lustig macht? Dies wird ein Geheimnis des Verlags bleiben. Als unser Protagonist, damals war er zwölf, während des Fernsehberichts über den Militärputsch gegen Chiles gewählten Präsidenten Salvador Allende keine Träne mehr für die Ereignisse hat, wurde Argentinien jedenfalls gerade demokratisch regiert, auch wenn dem Verlag dies offenbar nicht präsent ist.

Manierierte Sprachkompetenz
Pauls’ Roman ist eine Kopfgeburt. Man mag ihm zugutehalten, dass gelegentlich das Leiden des Jungen, den Pauls allerdings nie wirklich zum Leben erweckt, an den privaten Verhältnissen durchscheint. Doch die endlosen Sätze, manchmal sind sie über zwei Seiten lang (Übersetzer Christian Hansen, stets brillant, muss manchmal daran verzweifelt sein), lassen vermuten, dass es dem Autor weniger um die Vermittlung von Inhalten und Befindlichkeiten, als vielmehr um den Beweis von manierierter Sprachkompetenz ging, wie sie manch argentinische Literaturkritiker besonders schätzt. Man gibt sich gern gebildet und sprachlich innovativ am Río de la Plata, vor allem die Generation der heute Fünfzigjährigen, der Pauls angehört. Freilich gibt es auch junge Autoren und Autorinnen, die sich inzwischen von diesem Zwang befreit haben – und erfrischend lebendig schreiben.
Ich möchte den Roman gern ganz verstehen. Ein Interview mit dem Autor, so dachte ich, könnte mir vielleicht helfen. Um die Kultur des Weinens gehe es ihm, um den argentinischen Hang zur Rührseligkeit, die auch im Tango ihren Ausdruck findet, erfahre ich aus der Tageszeitung Página 12. Auch das bringt mich nicht wirklich weiter.
Eva Karnofsky
Alan Pauls: Geschichte der Tränen (Historia del llanto, 2007). Deutsch von Christian Hansen. Stuttgart: Verlag Klett-Cotta 2010. 143 Seiten. 17,95 Euro. Alan Pauls im Gespräch mit der ARD.
Foto: Axel Chaulet












