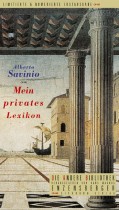 Ein Fest für Querdenker
Ein Fest für Querdenker
Der italienische Schriftsteller Alberto Savinio ist unzufrieden mit den vorhandenen Lexikas und hat sich deshalb ein eigenes Wörterbuch zusammengestellt.
Wie traurig und langweilig ist es, immer nur an die schnellen Verbindungen, die Hauptstrassen und Abkürzungen zu denken. Was uns fehlt sind die Umwege, die Liebe zu den Nebenstrassen, die Freude an Sackgassen! Der 1891 in Athen geborene, aber in Mailand und Florenz aufgewachsene Savinio war immer ein sehr eigensinniger, Nischen und abgelegene Winkel liebender Mensch. Niemals die Abkürzungen und bekannten Wege nehmend, sich immer irgendwo in Seitenstrassen verlierend. Aufmerksam gegenüber das von allen Übersehende, gleichgültig gegenüber dem, was jeder sieht und kennt. Wo auch immer er hinblickte, auf Steinsäulen, Hauseingänge, Schaufenster, Kirchentürme, entzündete sich sofort seine wuchernde Phantasie. Alberto Savinio ist ein großer Lehrer in der Kunst des intellektuellen Herumschweifens in den Abstellkammern des Alltäglichen und Normalen. Hinter der Welt, so wie sie uns erscheint, liegt für Savinio noch eine andere Welt der Träume, der Phantasien, der Erzählungen. Savinio lenkt den Blick, wie er einmal schrieb, auf die „Dinge, die im Schatten ihrer bewunderten Schwestern leben: den Aschenbrödeln der Stadt. Es geht darum, Dinge zu sehen, die auch die anderen sehen, jedoch in einem Augenblick, in dem die anderen nicht hinsehen“.
Fass-Menschen, Trinkerathleten und hohe Absätze
Flanierend, von einem Stichwort zum anderen springend, scheinbar ohne jeden roten Faden, ohne jeden erkennbaren direkten Weg hat Alberto Savinio auch sein „privates Lexikon“ angelegt. Angefangen hat Savinio diese bizarre Enzyklopädie noch in den Jahren des Duce Mussolini, dem er in dem Lexikon auch raffiniert versteckte Bösartigkeiten gewidmet hat. Er schlug vor, in dem Absatz über Hitler den Namen Mussolini einfach zu ignorieren und niemals seinen Namen auszusprechen. „Aus hygienischen Gründen“ wie er es formulierte. Abgeschlossen wurde das Lexikon dann in den ersten Nachkriegsjahren, allerdings ohne jeden direkten Bezug auf die neuen historischen Umstände.
Die Leser werden in diesem, vom Eichborn-Verlag geradezu atemberaubend sorgfältig gestalteten Buch, durch einen Irrgarten an Namen, Begriffen und Definitionen geschickt, die man in einem Lexikon kaum erwartet hätte und deren Platzierung oft mehr als verwunderlich ist. Dem Stichwort ‚Abendland‘ folgen da die ‚Hohen Absätze‘. Neben einem kurzen Absatz über den historisch nun wirklich wichtigen Begriff „Faschist“ steht eine 14seitige Abhandlung über die „Fass-Menschen“, von denen man vor Savinio noch nie etwas gehört hatte. „Hundeliebe“ folgt auf „Homer“. Dem „Trinkerathletentum“ folgt ein Absatz über „Tschechow“.
Insgesamt umfasst das private Lexikon des Alberto Savinio ungefähr 230 Eintragungen, von allerdings sehr unterschiedlicher Länge. Was ihm bedeutsam erschien, hat Savinio in großer Freiheit selbst entschieden. Für das ‚Philistertum‘ reichen fünf Zeilen: „Erweitern wir den Begriff des Philistertums. Dehnen wir ihn aus auf die Idee vom Vaterland. Gewöhnen wir uns daran, Ausdrücke wie ‚unser Italien, ‚unser Vaterland‘, unser Heer‘ als das zu sehen, was sie sind, nämlich der Ausdruck reinsten Philistertums.“ Mehr als diese dünnen Zeilen ist Savinio das Philistertum offensichtlich nicht wert.
Christ ja, Gott nein
Fast zwanzig Seiten hingegen werden dem Thema „Deutsche und Europa“ gewidmet. Statt hier aber etwa in die historische Geschichte des Verhältnisses von deutscher und europäischer Kultur eingeführt zu werden, mäandert Savinio durch seine persönlichen Erlebnisse mit Deutschen, den ‚deutschen Mythos‘, die ‚Wurstähnlichkeit des Deutschen‘, um schließlich bei Gott als dem Feind jedes Europäertums zu landen. Das Grundübel der Deutschen sieht Savinio in deren Stimme. „Hören Sie noch einmal die Stimme Hitlers an sein Volk: In dieser abgewürgten Stimme, die in Klumpen hervorbricht, haben Sie das Drama der deutschen ‚Unmöglichkeit‘. Eine Operation am Gaumenzäpfchen der deutschen Kinder würde vielleicht das Problem dieses unglücklichen und gefährlichen Volkes lösen.“
Eigensinnig und schräg ist auch, was Savinio etwa zum Stichwort ‚Caritas‘ notiert. Das christliche Lebensgefühl kann für ihn eigentlich nur von einem Menschen mit „plebejischen Gemüt“ empfunden werden. Und ‚Plebejer‘ sind für Savinio alle „Sklavenmenschen, die kein persönliches Kriterium, kein individuelles Urteil besitzen“. Seine Schlussfolgerung: „Für das christliche Lebensgefühl ist Gott als Prämisse nicht nötig. Das Vorurteil Gott belastet das christliche Lebensgefühl und schadet ihm. Das wahre Christentum ist gottlos.“
Die oft wahnwitzig schnellen Gedankensprünge, artistischen Assoziationen, grenzenlosen Phantasien und intellektuellen Salti Mortali des Alberto Savinio lassen die Leser seiner Bücher immer schwindelig werden. Dass der Kopf rund sei, wie Francis Picabia, der surrealistische Zeitgenosse Savinios sagt, damit sich das Denken ändern kann, ist auch das Grundmotiv des Alberto Savinio bei der Abfassung seines privaten Lexikons. Der an die philologische Präzision etwa eines „Deutschen Brockhaus“ gewohnte Leser sei vor der Lektüre dieser radikal nach subjektiven Kriterien zusammengestellten Enzyklopädie nur gewarnt. Wer allerdings ein Freund des Kreuz-und Querdenkens, des intellektuellen Freibeutertums und absurder Schlußfolgerungen ist, wird seine große Freude an dem Buch haben.
Carl Wilhelm Macke
Alberto Savinio: Mein privates Lexikon. Aus dem Italienischen von Christine Wolter und Karin Fleischanderl. Die andere Bibliothek, Eichborn-Verlag, Frankfurt am Main, 2005, Gebundene Ausgabe, 490 S., EUR 32,00, ISBN 3821845511











