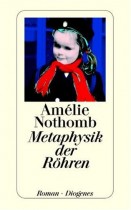 Wenn Babys sprechen könnten
Wenn Babys sprechen könnten
„Metaphysik der Röhren“ wird zu einer genussvollen Lektüre, sobald man die auf den ersten Seiten etwas mühsam entwickelte Grundidee geschluckt hat.
Amélie Nothombs absurde „Autobiographie“ der frühsten Kindheit.
Was denkt ein Kind in jener Phase des Lebens, an die man sich später nicht mehr erinnern kann? Wie erlernt ein Mensch die Sprache? Wie sieht sie aus, die Welt eines 0 bis 3-jährigen Kindes?
Bestimmt nicht so, wie Amélie Nothomb, Meisterin der außergewöhnlichen Perspektive, sie in „Metaphysik der Röhren“ beschreibt. Denn diese fiktive „Autobiographie“ der Jahre Null bis Drei verlässt von der ersten Seite an den Boden des Realen und spielt in den Gefilden einer herrlich verzerrten, grotesk verdrehten, amüsant-unmöglichen Weltsicht. Die eines Babys, das die ersten zwei Jahre regungslos im Bett liegt und nichts tun und denken will, um sich mit einem Mal zu geflügelten philosophischen Gedanken aufzuschwingen, während es noch nicht einmal weiß, was ein Staubsauger ist.
Am Anfang vergleicht sich der absurde Baby-Erzähler mit einer Röhre: Einem durchlässigen Gebilde, dessen einzige Beschäftigung Schluck- und Verdauungsvorgänge und – als deren unmittelbare Folge – Stuhlgang sind. Einem Wesen ohne gezielten Blick, der lebenden Negation des Heraklit’schen „Alles fließt“: „Hätte die Röhre über etwas wie eine Sprache verfügt, so hätte sie dem Denker aus Ephesos entgegnet: ,Alles erstarrt’, ,man steigt immer wieder in denselben Sumpf’. Zum Glück ist keine Sprache ohne die Bewegung vorstellbar.“
Die Eltern sind ratlos, natürlich, versuchen alles, konsultieren Ärzte, spielen dem Kind Musik vor, entziehen die Nahrung, sorgen für Veränderung. Doch: „Die Veränderung veränderte nichts. Eine Zimmerpflanze hätte mehr Lärm gemacht.“ Erst ein „geistiger Zufall“ regt das Kind zur Bewegung an. „Eine Windung der grauen Masse des Gehirns gebiert absichtslos einen fürchterlichen Gedanken, eine entsetzliche Vorstellung – und binnen einer Sekunde ist es für immer aus mit dem inneren Frieden.“ Zum Leidwesen der Eltern fühlt sich das seiner paradiesischen Ruhe entrissene Baby von der Welt betrogen und beginnt, voller Zorn zu schreien. Pausenlos.
Unzufrieden mit der Existenz, dem Leben, dem Sein als sprachloses Wesen hört das Kind erst mit dem Schreien auf, als es von der Großmutter herrlich schmeckende belgische Schokolade zu essen bekommt. Mit diesem ersten erfahrenen Genuss, mit dieser ersten erlebten Wonne entdeckt das Baby einen Sinn und seine Identität. Aus einem willenlosen „Es“ wird ein bewusstes „Ich“.
Aber Vorsicht: das Kind ist auch jetzt kein normales Kind. Es kann bereits die kompliziertesten Gedanken spinnen, beherrscht die Sprache bis zur komplexesten philosophischen Idee. Kulturelles Wissen wird durch den Kakao gezogen, das allseits beliebte Zitieren berühmter Sätze wird ironisiert, wenn das Kind überlegt, ob es als ersten Satz „E=m.c2“ oder „Für wen sind die Schlangen, die auf euren Köpfen zischen?“ aussprechen soll. Letztendlich fügt es sich aber doch in die Rolle eines Kleinkindes und tut ganz bewusst so, als ob es ein Wort nach dem anderen lernt. „Eltern sind eine sehr empfindliche Art Menschen; man muss ihnen die klassischen Babywörter präsentieren, bei denen ihnen die eigene Wichtigkeit sinnfällig wird.“ Deshalb zuerst das klassische Mama, direkt gefolgt vom ebenso klassischen Papa, um niemanden zu verärgern.
Die 1967 in Japan als Tochter eines belgischen Diplomaten geborene Amélie Nothomb erzählt schnell, wild, originell, frech und respektlos. Mit einem Wortwitz, der Spaß macht und die absurde Perspektive unterstützt. Problemlos folgt der Leser der verqueren Weltsicht dieses Kindes, so selbstverständlich, dass er überhaupt nicht merkt, dass die unangemessen wirkenden Reaktionen der Eltern eigentlich ganz normale Elternreaktionen sind. Spielerisch verarbeitet Amélie Nothomb sowohl eigene Erinnerungen, als auch Fakten ihrer Kindheit, die sie von Eltern und Verwandten erzählt bekommen haben muss.
Der entscheidende Unterschied von „Metaphysik der Röhren“ zu anderen Romanen, die ein Kind als Erzähler haben, ist allerdings, dass Amélie Nothomb von vornherein klar macht, dass ein Kind niemals so denken könnte, wie sie es beschreibt. Dadurch vermeidet sie die umständlichen, meist zum Scheitern verdammten und oftmals peinlichen Versuche, die Perspektive eines Kindes oder Jugendlichen konsequent und nachvollziehbar realistisch zu imitieren. Und schafft es trotzdem, unser Interesse auf das verspielte, naive Denken eines Kindes zu lenken, denn die Frage, wie Kinder diese Welt wirklich sehen, wirft der Roman ganz automatisch auf.
„Metaphysik der Röhren“ wird zu einer genussvollen Lektüre, sobald man die auf den ersten Seiten etwas mühsam entwickelte Grundidee geschluckt hat. Spätestens wenn man der Erzählerin durchs dritte Lebensjahr folgt, wenn man mit ihr den Mund über seltsame japanische Bräuche wie das No-Singen nicht mehr zukriegt, wenn man sich über Eltern ärgert, die immer das falsche Geburtstagsgeschenk aussuchen, wenn man mit ihr Lügengeschichten vor ihrer Schwester spinnt, wünscht man sich wie sie, dass sie immer ein Kind bleiben könnte. Denn viel zu schnell ist ihre Erzählung vorbei.
Textauszug:
Seit sehr langer Zeit gibt es eine riesige Sekte von Schwachköpfen, die Sinnlichkeit für das Gegenteil von Intelligenz halten. Dies ist ein Teufelskreis: Sie enthalten sich des Genusses, um ihre intellektuellen Fähigkeiten zu steigern, mit der Folge innerer Verarmung. Sie werden immer dümmer – so dumm, dass sie sich in ihrer Überzeugung bestätigt finden, brillante Köpfe zu sein, denn nichts ist so hilfreich wie die Dummheit, wenn man sich für gescheit halten will.[…]
Unter den Gebildeten trifft man Leute, die sich brüsten, sich seit fünfundzwanzig Jahren des einen oder anderen Vergnügens enthalten zu haben. Man trifft auch vollkommene Idioten, die stolz darauf sind, niemals Musik zu hören, niemals ein Buch aufzuschlagen oder niemals ins Kino zu gehen. Und es gibt auch solche, die hoffen, mit ihrer absoluten Keuschheit Bewunderung zu erregen. Offensichtlich befriedigen sie damit ihre Eitelkeit: Es ist das einzige, was ihnen das Leben gewähren wird.
Markus Kuhn
Amélie Nothomb: „Metaphysik der Röhren“. Roman. Diogenes Verlag 2002. Gebunden. 160 S., 16,90 Euro.











