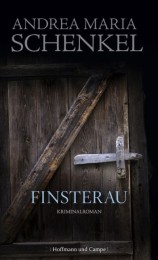 Es tannödet in Finsterau
Es tannödet in Finsterau
– Wie auch immer die wirklichen Hintergründe sind, Verlagswechsel reizen zu Kommentaren, Turbulenzen im Privatleben von Autoren werden viel diskutiert, Erfolgreiches zum Abschuss freigegeben, die ganze mediale Dynamik rauf und runter. Carlo Schäfer bemüht sich um einen kühlen Blick auf Andrea Maria Schenkels neues Buch: „Finsterau“.
Es ist eigenartig die Seiten zu wechseln, als Autor das Buch einer, wenn auch viel berühmteren Kollegin zu besprechen.
Schwierig – es droht nämlich beides: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus oder Kollegenschelte, unterdrückten Neidgefühlen geschuldet. Versuchen wir’s trotzdem.
Andrea Maria Schenkel, der mit dem Erfolg ihres Erstlings „Tannöd“ das Wunder gelang, mit einem Krimi, der gegen alle branchenüblichen Mainstreamkonventionen verstieß, einen riesigen Erfolg zu landen, noch dazu bei der feinen, aber kleinen Edition Nautilus, die von den Kettenbuchläden in der Regel überhaupt nicht beachtet wird, legt mit „Finsterau“ ihr viertes Buch vor, in der bewährten Montagetechnik aus Zeugenaussagen, Gedanken, inneren Monologen abgefasst.
Und das ist m. E. leider missglückt, und vor allem das Lektorat hat geschlampt. Ich entsinne mich unscharf, Schenkel habe seinerzeit gesagt, den Nautilanten aus Dank für die Debütchance treu bleiben zu wollen, nun ist sie doch beim deutlich größeren HoCa-Verlag angekommen und offensichtlich in die Nische bayerisch-bäuerliche historische Familiendramen gesteckt worden.
Nicht nur hierfür ist der Verlag zu preisen, auch für seinen Klappentext, der einen dreißig Seiten langen suspense, der dem Buch gutgetan hätte, sogleich vernichtet, indem er uns entgegenplärrt, dass die junge Frau namens Afra, aus deren Perspektive teilweise erzählt wird, ermordet wird. Das Buch hat 124 Seiten, es wäre zu einem Viertel spannender gewesen.
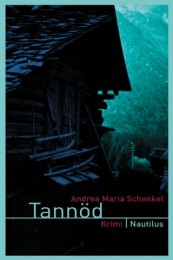 Düster, düster
Düster, düster
Es tannödet doch sehr in Finsterau: Wie im Erstling besitzt die Geschichte keinen nennenswerten Plot – das hat damals nicht geschadet, denn die düstere, schier unerträgliche Stimmung des Buchs fesselte aus sich selbst heraus – die Sprache war (fast immer) präzise und tatsächlich „eiskalt“, wie die FR auf der Rückseite des neuen Krimis zitiert wird.
Diesmal macht es sich die Autorin aber dann doch zu einfach, und wenn der historische Fall so oder so ähnlich war, dann taugt er nicht zum literarischen Stoff.
Bigotte, arme Familie am Arsch der Welt mit rebellischer Tochter, die haut ab, lässt sich von einem französischen Kriegsgefangenen schwängern, geht heim, bleibt rebellisch mit Kind, beide werden 1947 erschlagen, der Vater findet sie, hat aber leider bereits derartig Alzheimer, dass er keinen klaren Satz gesagt kriegt und ein Geständnis unterschreibt.
In Wirklichkeit war es einer von zwei Wanderburschen, ebenfalls ein Franzose, allerdings mit dem nicht ganz gallischen, auch nicht elsässischen Namen „Winfried Niedermeyer“. Der Anlass? Eigentlich keiner. Als Letztes wird der dann 18 Jahre später verhaftet und antwortet auf die Frage, warum er auch das Kind erschlagen hat: „Wenn die Katze stirbt, erschlägt man auch die Brut.“
Da ist es wieder, das düstere, grausame, bäuerliche Idiom aus dem bayerischen Wald. Nur leider aus dem Mund eines französischen Busfahrers.
Warum ein Franzose, besser gesagt, zwei? Und kann man nicht eine neue Katze brauchen, wenn die alte stirbt und Ratten und Mäuse übermütig werden?
Ungenau
Überhaupt scheint mir der Ton im ganzen Roman ungenau. Teilweise nervt es ein bisschen, wenn die verblassten historisch/regionalen Wörter gar zu geballt auftreten: Ruffel – schweiben – Höll (gemeint ist nicht die Hölle) – Speis (gemeint ist nicht die Speise) – Milchweitling, alles dieses auf zwei Seiten, gleich darauf kommt die recht moderne Wendung: „… von klein an haben sie ihr das Gefühl gegeben, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein“.
1947 ist auch zwischendurch mal jemand „scharf auf“ etwas – ich bezweifle, dass das im aktiven Wortschatz des sonst als denkbar öd umrissenen Personals vorkam.
Afras Erinnerungen an ihren Schwängerer „verblassen“ immer mehr, bis sich nicht einmal mehr an sein Aussehen erinnert – ungewöhnlich bei der einzigen Liebe des Lebens nach wenigen Jahren. Ein paar Seiten weiter trifft sie auf den anderen Franzosen, ihren späteren Mörder, und irgendetwas erinnert sie an ihm an ihren Verflossenen, sie weiß nicht was, aber es ist nicht das Aussehen, an das sie sich nun ja wohl doch wieder erinnert, um das entscheiden zu können.
Das alles kann beim Schreiben passieren und wohl jeder Autor kennt den bösen Satz: „Kill your babies“ oder, etwas – aber nur etwas – freundlicher: „Murder your darlings“. Oft ist man da, wo man sich am besten wähnt, gründlich am Pfuschen – dafür gibt es Lektoren. Wenn da auch noch, wie im letzten Beispiel, logische Fehler auftreten, sind diese erst recht gefordert.
Um noch mal zum Anfang meiner Bemühungen zurückzukehren: Zum Glück kann es mir beim Schreiben egal sein, ob ich gerade einen inneren Monolog oder eine erlebte Rede schreibe, ob ich personal oder auktorial erzähle, da dürfen die Literaturwissenschaftler ran, aber meine Erzählperspektive muss in sich stimmen. In „Finsterau“ tut sie das nicht, mir persönlich widerstrebt auch ganz besonders der Kunstgriff, Figuren halblaut mit sich selbst sprechen zu lassen, wenn grad keiner zum Reden da ist, aber das mag geschmäcklerisch sein.
Was sehr nach Lektoreneingriff aussieht, ist die Figur des Hetsch, des Dorfkrüppels, der Afra bedrängt, reichlich verdächtig wird und es dann doch nicht war: Der „red herring“, der falsche Verdächtige, ist ein beliebtes Mittel, um einer Geschichte Spannung einzuhauchen – besser sind die Geschichten, die ihn nicht brauchen oder nicht nur dafür.

Andrea Maria Schenkel - Leipziger Buchmesse 2012 (Quelle: wikipedia)
Es gibt Schlimmeres
Und ein Letztes: Jede Geschichte braucht eine Prämisse. Bei „Romeo und Julia“ könnte man als Prämisse formulieren: Auch die größte Liebe kann an den Umständen scheitern. Bei „Faust I“ scheitert der Mensch an seinem übersteigerten Selbstanspruch, das Neue Testament sagt, dass man den Tod durch Liebe überwinden kann, der Koran, dass Allah noch besser ist, die Prämisse von „Tannöd“ war: Böses Leben schafft böse Taten.
Die Prämisse von „Finsterau“? Man soll sich nicht mit Franzosen einlassen.
Eine gute Autorin hat ein, wie ich finde, nicht gutes Buch geschrieben. Es gibt Schlimmeres.
Carlo Schäfer
Andrea Maria Schenkel: Finsterau. Roman. Hamburg: Hoffmann und Campe 2012. 125 Seiten, 16,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Homepage der Autorin. Webseite von Carlo Schäfer.











