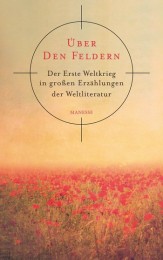 Das Jahr des größten Blutvergießens
Das Jahr des größten Blutvergießens
– Eine weltliterarische Gesamtschau des Ersten Weltkrieges mit Texten von 60 Autoren und Autorinnen aus 16 Sprachen und über alle Fronten hinweg unternimmt die von Horst Lauinger herausgegebene Anthologie „Über den Feldern. Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur“. Alf Mayer findet, solch ein Sammelband ist nicht nur etwas für das „Jubiläum“ des Kriegsausbruchs, sondern Lesestoff für mindestens vier Jahre.
Europa im Krieg. In diesen Brexit-Tagen gibt es Anlass, sich wieder vor Augen zu führen, was da vor einhundert Jahren mitten unter unseren Großvätern und Großmüttern (wahlweise Ur- oder Ur-Ur) Sache war: Krieg, die Abwesenheit des Friedens, an den sich das vereinte Europa so gewöhnt hat. Mein Großvater hatte die „Hölle von Verdun“ überlebt, zeitlebens Albträume waren die Folge, und ein Sohn, der dann freudig in Weltkrieg Zwo zog. „Ich weiß nicht“, sagte mir unlängst ein junger Verwandter, sein Enkel, „ob ich in meiner Lebenszeit nicht doch wieder Krieg erleben muss“, so tief saß ihm der Schock von inzwischen parlamentstauglicher Fremdenfeindlichkeit.
38 Texte erstmals auf Deutsch
Für mich war es Anlass, wieder in einem reichen Sammelband zu lesen. „Über den Feldern. Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur“ erschien bereits 2014, jetzt, auf sozusagen der Halbzeit des damaligen Krieges von 100 Jahren, ist er gleichermaßen aktuell. Immer noch ein Standardwerk. Ein weltliterarisches Panorama der Jahre 1914–1918. Eine editorische Großtat, besorgt vom Leiter des Manesse Verlags selbst, von Horst Lauinger.
Versammelt sind hier Novellen, Short Storys und Prosaskizzen aus sechzehn Sprachen, 38 von ihnen erstmals ins Deutsche übersetzt. Darunter etwa „Das Friedensspielzeug“ von Saki, „Die Geschichte“ von Joseph Conrad, Edith Wartons „Eine Kriegsgeschichte schreiben“, d’Annunzios „Pferde ohne Zahl“, Kiplings „Mary Postgate“, Pirandellos „Berecche und der Krieg“, Gertrude Steins „Tourty oder Tourtebattre“, Maughams „Der haarlose Mexikaner“, Apollinaires „Die Stecknadeln“, Virginia Woolfs „Der Fleck an der Wand“, Tania Blixens „Eine Safari zu Kriegszeiten“, Katherine Mansfields „Eine indiskrete Reise“, Louis-Ferdinand Celines „Wellen“, „Der Schandtatenmakler Monk Eastman“ von Jorge Luis Borges, Irène Némirovskys „Unständehalber“ und Boris Pasternaks „Briefe aus Tula“. Mit einer einzigen Ausnahme – Proust – enthält der Band abgeschlossene Novellen, Kurzgeschichten und Prosaskizzen.
Die Anthologie nimmt auch die Nebenschauplätze des Krieges in Augenschein: Etappe und Hinterland, Refugien und die „Territorien des Gewissens“ (Pasternak), die Seelenräume. „… es hat sich eben alles so ereignet; und wenn ich den Sinn wüsste, so brauchte ich dir wohl nicht erst erzählen“, heißt es in Musils Erzählung „Die Amsel“.
1916 – Das Jahr, in dem nicht nur Syrien zerlegt wurde
Vor einhundert Jahren, am 5. Juni 1916, begann die von den Briten (mit dem Geheimagenten T.E. Lawrence) unterstützte und geförderte Revolte im Osmanischen Reich – deren Ausstrahlungen bis ins Heute reichen und damals schon Syrien zerlegten.
Am 1. Juli 1916 begann die „Schlacht an der Somme“, eine britisch-französische Großoffensive gegen die deutschen Stellungen. Alleine am ersten Tag der Offensive hatte die britische Armee 57.000 Mann Verluste, darunter 19.000 Gefallene. Am 18. November desselben Jahres wurden die Angriffe abgebrochen, ohne eine militärische Entscheidung erzielt zu haben. Mit über einer Million getöteten, verwundeten und vermissten Soldaten war sie die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs.
Auf deutscher Seite wurde am 12. Juli 1916 endlich die verlustreiche Offensive bei Verdun abgebrochen, ab diesem Zeitpunkt wurde bis Kriegsende versucht, die Stellungen zu halten. Auch dies mit hohen Menschenopfern. Zwischen 1914 und 1918 wurden insgesamt 105 deutsche und 88 französische Divisionen vor Verdun eingesetzt. Bei einer durchschnittlichen Divisionsstärke von 12.000 bis 15.000 Mann waren dies etwa 2,5 Millionen Soldaten. Alleine auf deutscher Seite wurden fast 1.200.000 Mann durch die „Hölle von Verdun“ geschickt. Die Zahl der Toten kann nur geschätzt werden, die Unterzahl liegt bei 100.000 für jede Seite.
Am 19. Juli eröffnete die französisch-britische Entente die „Schlacht von Fromelles“, einen Ablenkungsangriff für das Kriegswüten an der Somme. Fromelles wurde zu einem Desaster für die „First Australian Imperial Force“. Nie zuvor und danach in der Geschichte der australischen Streitkräfte waren solch hohe Verluste in einer Schlacht zu beklagen. Eine Untersuchungskommission sprach später die Schuld zu einem großen Teil dem britischen General Richard Haking zu. Bis heute nennen die Australier ihn abwertend „Butcher Haking“ (Schlächter Haking); ein nicht unwesentlicher Teil des anti-britischen Ressentiments ist diesem Herrn geschuldet. Die Einsätze an der Somme und bei Fromelles sind ein kaum bearbeitetes australisches Trauma und bieten die Folie für einen perversen, auch noch im Jahr 2016 überall im Land anzutreffenden, kriegsverherrlichenden Heldenkult.
Wegen Krieges verhindert
Kriege hätten die unschöne Tendenz, immer in Ferienzeiten auszubrechen, zitiert Horst Lauinger in seinem informationsprallen Nachwort Gertrude Stein. Joseph Conrad wurde beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges an seinem Urlaubsziel, seiner früheren Heimat Polen, plötzlich zum feindlichen Ausländer. Max Dauthendey wurde auf Java von den Holländern interniert, Rilke durfte nicht mehr an seinen Pariser Wohnort zurück, seine gesamte Habe wurde konfisziert und versteigert. Den Münchner Handlungsreisenden Max Aub wiesen die Franzosen am Grenzbaum in den Pyrenäen ab und machten ihn so zum spanischen Schriftsteller. James Joyce schrieb seinen „Ulysses“ kriegsbedingt in der Schweiz. Marcel Proust stellte sich vor, wie „bald Millionen von Menschen in einem Krieg der Welten, dem von Wells beschriebenen vergleichbar, hingemetzelt werden“. Knut Hamsun legte sich eine Europakarte zu, um die deutschen Gebietsgewinne vor Augen zu haben, Thomas Mann meldete sich bei der Münchner Stellungsbehörde, Robert Musil begrüßte den Kriegsausbruch euphorisch, meldete sich freiwillig an die Alpenfront, erlebte den Dolomitenkrieg und wurde Hauptmann,
Guillaume Appolinaire erlebte die Beförderung zum „cannonier conducteur“, Richard Demel wurde mit 50 zum Seniorinfanteristen, der sechzehnjährige Curzio Malaparte zum Kindersoldaten in der Legione Garibaldina und der Schweizer Blaise Cendrars zum Fremdenlegionär (siehe auch unseren Kolumnisten Frank Göhre zu diesem Dichter der Moderne). Kriegsteilnehmer waren auch John Buchan (der das Scharfschützentum förderte, weil er darin eine neue Form der Kriegsführung erkannte), ebenso Gilbert Chesterton, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle und Rudyard Kipling. Herman Löns, Georg Trakl, Louis-Ferdinand Céline, Michail Bugalkow, Hugo Zuckermann, Paul Élouard, Gabrielle d’Annunzio, Louis Pergaud, Jean Giradoux, Oskar Kokoscha, Egon Erwin Kisch, Ernst Jünger, Ludwig Thomas, Blaise Cendars, Robert Graves, Ford Maddox Ford, Leo Perutz, John Priestley, John Tolkien, Heimito von Doderer, Tomasi d Lampedusa, Dashiel Hammett, Ludwig Ganghofer, Erich Kästner. E.E. Cummings und John Dos Passos, C.C. Lewis, Ernest Hemingway, Carl Zuckmayer und Wilfried Owen.
In seinem beachtlich recherchierten Nachwort reißt Horst Lauinger manches Schicksal und manchen Zusammenhang an. Die für die meisten Autoren und Autorinnen eigens recherchierten Kurzbiographien gehen je besonders auf deren Kriegszeit ein. Ich kann ergänzen, dass auch Raymond Chandler, James M.Cain und der Filmregisseur William A. Wellman Kriegsteilnehmer waren. Chandler erlebte und durchlebte den Geschützgrabenterror in Flandern, verlor darüber nie ein schriftliches Wort.
William Faulkner war zu klein
Zu den Autoren des Bandes gehören Autoren und Autorinnen aus rund 20 Staaten. Da ist etwa Akatugawa Ryunosuke (1892-1927), der während des Ersten Weltkriegs japanische Offiziere am Ingenieurskolleg von Yokosuka in Englisch unterrichtete. Kurosawas berühmter Film „Rashomon“ basiert auf zweien seiner Kurzgeschichten. Isaac Babel diente 1917 an der rumänischen Front und arbeitete als Übersetzer in der Spionageabwehr der „Tscheka“. Der junge Jorge Luis Borges erlebte den Kriegsausbruch bei einer Deutschlandreise, den Krieg verbrachten er und seine Eltern in der Schweiz. Eugen Berthold Friedrich Brecht war erst kriegsbegeistert, schrieb Gedichte und Reportagen von der Heimatfront, ehe sich seine Gesinnung wandelte.
Gabriele d’Annunzio meldete sich als Freiwilliger, war erst bei der Kavallerie, dann bei der Luftflotte und ein eifriger Bombenwerfer. Robert Musil wurde von einem italienischen Fliegerpfeil verwundet. Nach Kriegsende besetzte d’Annunzio an der Spitze von 250 Freischärlern das vormals österreichische Fiume (Rijeka) und reklamierte es für Italien. Die Kuppe seines Anwesens am Gardasee ziert ein Monument für die „Helden“ dieser Unternehmung. Der Nervenarzt Alfred Döblin ließ sich vom Vater von Max Ophüls eine Uniform maßschneidern, diente in einem Seuchenlazarett in Saargemünd, wo die im Band abgedruckte Erzählung „Die Schlacht, die Schlacht!“ entstand.
Der Iraner Mohammad Ali Dschamalzade hatte in Europa studiert und gründete zusammen mit anderen Exil-Iranern 1917 in Berlin die Deutsch-Persische Gesellschaft. William Faulkner wurde von der US-Armee abgelehnt, weil zu klein, bewarb sich bei der britischen Luftwaffe als Engländer und absolvierte 1918 in Kanada eine Grundausbildung bei der Royal Canadian Airforce, wurde aber nicht ins Flying Corps übernommen. Als er in Europa eintraf, waren die Kampfhandlungen eingestellt, was ihn nicht an der Selbststilisierung als Kriegsheld hinderte.
Hemingway hingegen wurde echt verwundet
Der Sanitätsfreiwillige Ernest Miller Hemingway hingegen bekam echte Granatsplitter ab, als er an der österreichisch-italienischen Front im Einsatz war. Heinrich Mann war ein entschiedener Kriegskritiker, der Bruderzwist nahm nach den „Gedanken im Kriege“ seines Bruders Thomas den Anfang. Katherine Mansfield hatte sich in Paris in den Franzosen Francis Carco verliebt, es entwickelte sich eine „grande passion“ im Schatten des Krieges. William Somerset Maugham arbeitete unter dem Decknamen „R“ für eine von der Schweiz aus operierendes britisches Spionagenetzwerk, hatte auch einen Russlandeinsatz, um die provisorische Regierung Kerenki an der Macht zu halten.
Luigi Pirandello war bei Kriegsausbruch als Journalist beim „Corriere della Siera“, Marcel Proust lebte in der Angst, eingezogen zu werden, sein Asthmaleiden bewahrte ihn davor. Am Kriegsgeschehen nahm er regen Anteil, schickte Hilfspakte mit Schokolade und Tabak ins Feld. Mehrere Episoden im letzten Band seiner „Suche nach der verlorenen Zeit“ schildern Paris im deutschen Bombenhagel, eine davon ist im Band wiedergegeben. Das Schützengrabendasein im suppigen Schlamm beschrieb Saki (als Hector Hugh Munro in Burma geboren) in seiner Story „The Square Egg“. Trotz mehrfacher Verwundungen kehrte er beharrlich an die Front zurück, am 14. November 1916 wurde er von einem deutschen Scharfschützen aufs Korn genommen. Seine letzten Worte, bevor die Gewehrkugel ihn auf der Stelle tötete: „Put that bloody cigarette out!“
Alf Mayer
Horst Lauinger (Hrsg.): Über den Feldern. Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur. Mit Texten von Ivo Andrić, Guillaume Apollinaire, Louis-Ferdinand Céline, Isaak Babel, Tania Blixen, Bertolt Brecht, Joseph Conrad, Gabriele d‘Annunzio, Alfred Döblin, William Faulkner, Ford Madox Ford, Robert Musil, Virginia Woolf, Jaroslav Hašek, Franz Kafka, Katherine Mansfield, Irène Némirovsky, Marcel Proust, Stefan Zweig u.v.a. Manesse Verlag, Zürich. Hardcover, Leinen. 784 Seiten. 29,95 Euro.











