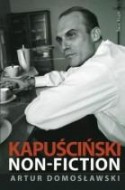 Denkmalsstürze
Denkmalsstürze
In diesen Tagen erscheint in polnischer Sprache eine Biographie über Ryszard Kapuscinski, die das von vielen errichtete Denkmal des vor drei Jahren gestorbenen Weltreporters aus Warschau erheblich ankratzt. Einige seiner Reportagen seien in ihrem Wahrheitsgehalt mehr als fragwürdig. Seine eigene Biographie habe sich Kapuscinski an manchen heiklen Stellen skandalös zusammengenschnitzt, vor allem aber habe er mit dem kommunistischen Staatssicherheitsdienst sehr viel enger zusammengearbeitet als man bislang schon wusste oder ahnte. Ein Kommentar zum „Fall Kapuscinski“ von Carl Wilhelm Macke
Vor Jahren schrieb ich einmal eine große Eloge auf den Übersetzer Curt Meyer-Clason anlässlich seines 80. Geburtstages. Er habe mit seinen vielen Übersetzungen spanischer und portugiesischer Literatur für das deutschsprachige Publikum ein Fenster zur Welt geöffnet. Über ihn hätte man wichtige anti-diktatorische Schriftsteller des spanischen und portugiesischen Kulturraumes auch bei uns kennengelernt. Seine Haltung als Direktor des Goethe-Instituts in der Zeit unmittelbar vor der demokratischen Revolution in Portugal sei vorbildlich gewesen. Er habe dort ein anti-nazistischen, demokratisches Deutschland repräsentiert, dem auch die volle Sympathie der „68er-Generation“ galt und gilt. Und – für protestantisch-asketische Leser seiner Übersetzungen gar nicht so nebensächlich – das ‚savoir-vivre’ habe man von diesem großen Bonvivant vor dem Herrn auch gelernt. Also gäbe es nur Gründe, einen Doyen der Übersetzer seiner Zeit für seine Arbeiten zu danken und ihm noch viele gesunde Jahre zu wünschen ect. pp.
Unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Grußes meldete sich dann eine Leserbriefschreiberin, die diesen Geburtstagsstrauß mit Erinnerungen an einen ganz anderen Meyer-Clason zum Welken bringen wollte. Warum man denn immer die aus ihrer Sicht mehr als eindeutige Nähe des Geehrten zum Nationalsozialismus aus den heutigen Elogen ausklammern würde. Es sei doch spätestens seit der Recherche eines amerikanischen Historikers bekannt, dass er sich in den dreißiger Jahren in Sao Paolo als „Spitzel für die Nazis“ verdingt hätte. Nichts weiter als ein ziemlich fragwürdiger ‚Wendehals’ sei der besonders von ‚linken Feuilletonisten’ gefeierte weltoffene Übersetzer. Mangels genauerer und vor allem belegbarer Informationen über weit zurückliegende Episoden in der Biographie von Meyer-Clason, blieb (und bleibt) er für mich durch seine vielen Übersetzungen und auch seine eigene literarischen Arbeiten ein ziviler Kosmopolit, der vielen aus den nach-nazistischen Generationen Deutschlands das ‚Fenster zur Welt’ geöffnet hat.
Kapuscinski: ein literarischer ,,Fensteröffner“
Und jetzt also Ryszard Kapuscinski … Auch er ein ‚neugieriger Weltenbummler’, ein ‚Kosmopolit’, der uns mit seinen vielen Reportagen aus Afrika, Lateinamerika, dem Iran und Osteuropa aus unseren provinziellen Kerkern herausgezogen hat. Seine Reportage über das Ende des Königshauses in Addis Abbeba (König der Könige) bleibt eine Orientierung, ein Leuchtturm für einen politisch engagierten, anti-feudalen, sprachlich meisterhaften Reportagejournalismus. Wie viele andere Journalisten oder einfach nur weltneugierige Leser, habe ich mir mit der Lektüre seiner Reportagen Nächte um die Ohren geschlagen.
Auch er gehörte mit seinen Büchern zu jenen literarischen „Fensteröffnern“ der deutschen Nachkriegsgenerationen, die die ganze nazistische Heimattümelei (die sowieso) genauso satt hatten wie den Mief der Bonner Republik und einiger Schriftsteller dieser Zeit, für die der Rhein und die Danziger Bucht schon die Welt bedeuteten. Von den Reportagen des Ryszard Kapuscinski ließen wir uns gern und fast schon süchtig nach seinem ‚Sound’ herausziehen aus unseren deutschen Schrebergärten und eingezäunten Reihenhaussiedlungen.
Jetzt ist in polnischer Sprache eine Biographie des vor drei Jahren gestorbenen Weltreporters aus Warschau erschienen, die das von vielen (auch von dem Schreiber dieser Zeilen) errichtete Denkmal erheblich ankratzt. Einige seiner Reportagen seien in ihrem Wahrheitsgehalt mehr als fragwürdig. Seine eigene Biographie habe sich Kapuscinski an manchen heiklen Stellen skandalös zusammengenschnitzt, vor allem aber habe er mit dem kommunistischen Staatssicherheitsdienst sehr viel enger zusammengearbeitet als man bislang schon wusste oder ahnte. Einige der von dem Autor Artur Domoslawski in seiner Biographie formulierten Vorwürfen gegen Kapuscinski scheinen sehr gut belegt zu sein. Andere bewegen sich in Andeutungen über Handlungen und Gefälligkeiten des Reporters gegenüber der kommunistischen Nomenklatura, die durchaus vielfältig interpretierbar sind.
Martin Pollack, der treue Übersetzer der Arbeiten von Ryszard Kapuscinski, konzediert dem in Polen viel diskutierten Buch von Domoslawski einige durchaus zutreffende Kritiken an der Arbeitsweise und ‚Aufdeckungen’ von grauen Stellen in der Biographie seines Freundes ‚Kapu’.
Aber würde der pedantisch genaue Nachweis einer nicht mit den historischen Realitäten hundertprozentig übereinstimmenden journalistischen Reportage etwas an der sprachlichen Meisterschaft, ja selbst an der ‚Gesamtwahrheit’ eines Artikels ändern? Der Chronist, so hat Joseph Roth, nicht nur als Schriftsteller sondern auch als Journalist einer der ganz großen Orientierungsfiguren der deutschsprachigen Literatur bis heute, einmal geschrieben, „bemühe sich, die Symptome der Zeit und des Ortes aufzuzeichnen“. In diesem Sinne bleibt auch Kapuscinski ein Vorbild – auch wenn sein Denkmal inzwischen einige Risse aufweist.
Vielleicht sollte man aber in Zukunft überhaupt keine Elogen mehr schreiben und Denkmäler errichten, sondern ganz nüchtern, vielleicht auch ohne Illusionen, die Werke von Schriftstellern, Journalisten und Übersetzern würdigen. Es wäre nicht die schlechteste Lektion, die man aus den bekannt gewordenen biographischen Retouschen geschätzter Autoren ziehen würde.
Carl Wilhelm Macke











