Bloody Chops

– heute führen das Beilchen Kirsten Reimers (KR), Sabina Schutter (SaSchu) und Joachim Feldmann (JF).
 Hic sunt dracones
Hic sunt dracones
(KR) Ein Mammut in Alaska? Ende des 19. Jahrhunderts? Ein Brontosaurier im afrikanischen Dschungel, nur wenige Jahr zuvor? Und dann ist da noch das hartnäckige Gerücht, dass im geheimen Tunnelsystem – von dem gar nicht klar ist, ob es tatsächlich existiert –, unter der Grenzstadt Mexicali, ein chinesischer Drache gehalten wird. Abenteurer, Spione, Trickbetrüger, Großwildjäger, besessene Museumsdirektoren – sie alle sind in Bernardo Fernández Roman mit an Fanatismus grenzender Leidenschaft auf der Suche nach Geld, nach Ruhm, nach dem Fabelwesen oder einfach nach Sicherheit. An der Grenze zwischen den USA und Mexiko, im kleinen Städtchen Mexicali treffen die Erzählstränge, die Suchen und Fluchten zusammen. Für manchen endet es in einer Katastrophe.
Fernández mixt gekonnt Elemente des Abenteuer- und des Fantasy-Romans mit denen des Westerns (Woher kommt eigentlich derzeit diese Neigung zum Western mit starken Mädchenfiguren?). Eingestreute historische Personen und Ereignisse verwischen die Grenze zwischen Realität und Fiktion, und die Gleichzeitigkeit des Unmöglichen mit dem Selbstverständlichen gibt dem Roman etwas Poetisches. Unterstrichen wird dies durch die Erzählung aus verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichen Haltungen. Spannend, ungewöhnlich und am Ende ziemlich blutig.
Bernardo Fernández: Das Auge des Drachen (Ojos de lagarto, 2009). Roman. Deutsch von Petra Strien. Berlin: Suhrkamp Nova 2011. 272 Seiten. 12,95 Euro.
Verlagsinformationen zum Buch mit Leseprobe
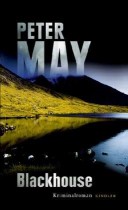 Die Schrecken der Kindheit
Die Schrecken der Kindheit
(JF) Das Handlungsmuster ist geläufig. Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehrt der Ermittler an den Ort seiner Kindheit zurück, um ein Verbrechen aufzuklären. Seinen Einsatzort empfindet er als fremd und vertraut zugleich. Frühere Freunde begegnen ihm mit Misstrauen, schließlich hat er es im Gegensatz zu ihnen geschafft, der Provinz – denn dort spielt so ein Kriminalroman zwangsläufig – zu entkommen. Zwangsläufig wird die Suche nach dem Täter zu einer Reise des Ermittlers in die eigene, gerne verdrängte Vergangenheit, um letztendlich herauszufinden, dass der Fall mehr mit ihm selbst zu tun hat, als ihm lieb ist.
Dass aber nicht zwangsläufig schlechte Literatur dabei herauskommen muss, wenn sich ein Autor eines sattsam bekannten Plots dieser Art annimmt, beweist der Schotte Peter May in seinem Roman „Blackhouse“. Detective Inspector Fin MacLeod wird auf die Hebrideninsel Lewis geschickt. Ein Mord ist geschehen, der verblüffende Parallelen zu einem ungeklärten Fall in Edinburgh aufweist. MacLeod ist in einem kleinen Ort auf der Insel aufgewachsen, wo man bis heute im Alltag Gälisch spricht und die Macht des calvinistisch geprägten Protestantismus ungebrochen ist. Außerdem handelt es sich um die letzte Gemeinde, wo sich ein vierhundert Jahre alter, bizarr anmutender Brauch erhalten hat. Jedes Jahr im August verbringt ein Dutzend Männer des Ortes 14 Tage auf einem 80 km entfernt liegenden Felsmassiv, um die Jungen der dort brütenden Basstölpel, Gugas genannt, zu erbeuten. Auch MacLeod hat als Jugendlicher an dieser Expedition teilgenommen und wurde unter mysteriösen Umständen Opfer eines Unfalls. Und das ist nicht das einzige tragische Ereignis, das die ersten 18 Lebensjahre des Polizisten überschattet.
Peter May gelingt es auf beeindruckende Weise, die zwei Handlungsstränge des Romans parallel zu führen. Während er MacLeod selbst von der Vergangenheit berichten lässt, wird die Gegenwartshandlung in der dritten Person erzählt. Dabei tritt die Kriminalgeschichte streckenweise in den Hintergrund, ohne dass dies die Spannung verringern würde, da wir es mit einer ausgesprochen komplexen Ermittlerfigur zu tun haben, die immer wieder für Überraschungen gut ist. Der Roman schließt, wie es sich gehört, mit der Entlarvung des Mörders in einem groß angelegten Showdown. Doch ganz zu Ende ist die Geschichte von Fin MacLeod noch nicht. Weitere Isle-of-Lewis-Romane sollen folgen. Man darf gespannt auf sie sein.
Peter May: Blackhouse. (The Blackhouse. 2009). Roman. Deutsch von Anke und Eberhard Kreuzer. Reinbek: Kindler 2011. 482 Seiten. 19,95 Euro.
Verlagsinformationen zum Buch mit Leseprobe

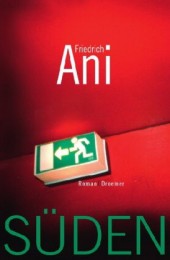 Süden grenzenlos
Süden grenzenlos
(SaSchu) „Ich werd das Hatschen nicht los“, sagt der Vater von Süden, als er ihn anruft. Tabor Süden, ehemals Kommissar bei der Vermisstenstelle der Münchner Polizei und zwischenzeitlich Kellner in Köln, konnte seinen eigenen Vater nicht finden, und jetzt ruft der Vater an.
 Süden kehrt nach München zurück, um seinen Vater zu finden. Er kehrt aber auch zurück in die Süden-Reihe, und er ist dicker geworden. Wer ist diesmal verschwunden? Raimund Zacherl, genannt Mundl, einst geselliger Wirt, ist seit Jahren verschwunden, und seine Ehefrau will ihn suchen lassen. Süden, jetzt Privatdetektiv, sucht, findet dabei einen kleinen Jungen und trifft immer wieder auf sich selbst. Der neue Job steht unserem Helden übrigens fast besser als die Polizistenstelle, schließlich muss er jetzt nicht mehr bemüht Grenzen übertreten, sondern macht das qua Status. Statt der kurzen Taschenbücher wählt Ani das dicke, gebundene Romanformat, das bei Polonius Fischer („Idylle der Hyänen“) mitunter Längen zeigt, bei Süden Tiefen eröffnet. Die Geschichte wagt sich an Symbole, die bei jedem anderen peinlich wären: Der Roman heißt Süden, Süden kommt aus dem Westen zurück nach München und fährt in den Norden, er findet einen Seehund aus Keramik … Das muss man gut beschreiben können, um nicht in die Schmonzette abzugleiten.
Süden kehrt nach München zurück, um seinen Vater zu finden. Er kehrt aber auch zurück in die Süden-Reihe, und er ist dicker geworden. Wer ist diesmal verschwunden? Raimund Zacherl, genannt Mundl, einst geselliger Wirt, ist seit Jahren verschwunden, und seine Ehefrau will ihn suchen lassen. Süden, jetzt Privatdetektiv, sucht, findet dabei einen kleinen Jungen und trifft immer wieder auf sich selbst. Der neue Job steht unserem Helden übrigens fast besser als die Polizistenstelle, schließlich muss er jetzt nicht mehr bemüht Grenzen übertreten, sondern macht das qua Status. Statt der kurzen Taschenbücher wählt Ani das dicke, gebundene Romanformat, das bei Polonius Fischer („Idylle der Hyänen“) mitunter Längen zeigt, bei Süden Tiefen eröffnet. Die Geschichte wagt sich an Symbole, die bei jedem anderen peinlich wären: Der Roman heißt Süden, Süden kommt aus dem Westen zurück nach München und fährt in den Norden, er findet einen Seehund aus Keramik … Das muss man gut beschreiben können, um nicht in die Schmonzette abzugleiten.
Ani zeigt sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens mit einem Süden, der einsam ist wie noch nie, bodenlos traurig, mit großartigem Insiderwitz „Ich heiße Tabor Süden und bin kein Japaner“ und tut das, was er immer tut: am meisten dadurch erzählen, indem er viel weglässt.
Friedrich Ani: Süden. Roman. München: Droemer. 368 Seiten. 19,99 Euro.
Verlagsinformationen zum Buch mit LeseprobeThomas Wörtche über „Süden“ bei Deutschlandradio Kultur
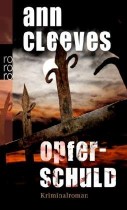 Lebenslügen & die deutsche Übersetzerin führt den Dienstgrad der „Kommissarin“ in der britischen Polizei ein …
Lebenslügen & die deutsche Übersetzerin führt den Dienstgrad der „Kommissarin“ in der britischen Polizei ein …
(JF) Ein kleines Dorf in Yorkshire. Vor zehn Jahren wurde hier die 15-jährige Abigail Mantel umgebracht. Verhaftet und verurteilt wurde, trotz einer relativ mageren Beweislage, die ebenfalls noch ziemlich junge ehemalige Freundin des Vaters. Aus Eifersucht soll sie die Tochter ihres Geliebten erwürgt haben. Gestanden hat sie die Tat allerdings nie. Nun taucht ein Zeuge auf, der ihr ein sicheres Alibi verschafft, aber leider zu spät. Kurz bevor sie die gute Nachricht erreichen kann, nimmt sich Jeanie Long im Gefängnis das Leben. Und die Polizei beginnt, den Fall noch einmal aufzurollen.
Ann Cleeves Kriminalroman „Telling Tales“, dessen nicht immer treffsichere deutsche Übersetzung den dräuenden Titel „Opferschuld“ verpasst bekommen hat, ist eine Studie über Lüge und Selbsttäuschung. Nahezu alle Figuren haben etwas zu verbergen. Von Emma, der, wie sie gerne glauben möchte, engsten Freundin des Mordopfers, die sich in die Konvention einer ziemlich leidenschaftslosen Ehe verkrochen hat, bis zu der ehemaligen Polizistin Caroline Fletcher, die bei den Ermittlungen gegen Jeanie Long auch ganz eigene Interessen verfolgte. Aber vor der übergewichtigen Kriminalistin Vera Stanhope, die zur endgültigen Aufklärung des Falles anreist, ist kein Geheimnis sicher.
Ann Cleeves unaufgeregte Erzählweise macht die Lektüre dieses Kriminalromans zu einem fast altmodisch anmutenden Vergnügen. Leider verliert die Autorin zum Ende hin ihre Gelassenheit und zaubert hastig eine wenig überzeugende Auflösung aus dem Hut. Das ist schade, denn bis dahin hatte uns dieses Buch ganz prächtig unterhalten.
Ann Cleeves: Opferschuld. (Telling Tales. 2005 Roman). Aus dem Englischen von Stefanie Kremer. Reinbek: Rowohlt 2011. 426 Seiten. 9,90 Euro.
Verlagsinformationen mit Leseprobe

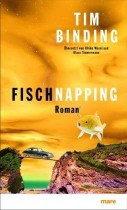 Fishbashing
Fishbashing
(KR) Ich gebe zu: eines der wenigen Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Eigentlich habe ich es kaum angefangen: Auf den ersten nicht mal zwanzig Seiten mischten sich viel zu viele schmierig-verklemmte Schenkelklopfer mit miefiger Mittelmäßigkeit. Eine akribische Nacherzählung der verworren-albernen Handlung des Vorgängerbuches riss es dann auch nicht wieder heraus. Mit etwas über Vierzig fühle ich mich definitiv zu jung für dieses Buch. Eventuell tue ich ihm ja unrecht – aber – obwohl – hm – vermutlich nicht.
Tim Binding: Fischnapping (Rump Stake, 2011). Deutsch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Hamburg: Mare 2011. 334 Seite. 19,90 Euro.
Verlagsinformationen zum Buch
Jörg von Bilavsky über Bindings „Cliffhanger“











