Bloody Chops

– heute mutwillig veranstaltet von Stefan Linster (SL), Joachim Feldmann (JF) und Thomas Wörtche (TW)
Ra sante Umstürze mit altnordischem Beigeschmack
sante Umstürze mit altnordischem Beigeschmack
(SL) Drücken wir es mal launig aus: Es gibt Bücher, die wären besser gleich Filme geworden, und umgekehrt. Nicht dass unser Islandkrimi hier schlecht wäre. Nur hätten ihm die optisch-mimetische Erzählweise, die Eindringlichkeit von (Landschafts-)Bildern und die ureigene Erfindung und Leistung des Kinos, der filmische Showdown, zum Vorteil gereicht. Und so wäre aus der leidlich ambitionierten, potentiell spannenden Geschichte um einen verschwundenen Professor, Fachmann für isländische Frühgeschichte sowie Mythen und Sagas der Wikinger, und um obskure Rassisten, die mithilfe des Ober-Asen Nordeuropa flugs wieder vom fremden Grobzeug befreien wollen, sicherlich ein echter Thriller geworden, wie auf dem Cover verheißen.
Stattdessen wird eben viel doziert, etwa über riesige, in die Landschaft eingeschriebene Symbole (Sonnenrad!), mit denen die Wikinger, so die These im Buch, ihre Landnahmen sowohl geographisch konkret als auch magisch besiegelten; oder über die unselige Neigung von Eroberern, ihre Tempel – und Kulturen gleich mit – buchstäblich auf denen der Eroberten zu errichten, etc. Dennoch bleibt vieles im Vagen, gerät zum Ungefähren – die üblichen Verdächtigen, Pyramiden, Stonehenge, Petersdom dürfen natürlich nicht fehlen –, wenn es nicht sogar mäßig wirr daherkommt; wie auch die Protagonisten eigenartig gesichtslos, eben Figuren (ich sage nur bornierter Bulle) bleiben, ohne zu Charakteren zu wachsen.
Aber vielleicht liegt das eingeschränkte Lesevergnügen bloß am recht altbackenen Erzählmodus, dem Aufbau in – zu – kurzen Kapiteln (dafür aber 9×9=81!), die jeweils, im Walzertakt durchdekliniert, von einem Handlungsstrang zum anderen springen. Denn zu guter Letzt nimmt das Wikingerschiff doch noch Fahrt auf, in einem zugegeben spannenden Finale, dessen Auflösung allerdings so gar nichts mehr mit Óðinn, Nordmannenmystik und Wikingerschätzen zu tun hat, sondern nur mit düsteren Familientragödien.
Nota male: Wahrscheinlich dräuen nun noch weitere Krimis dieser Art, denn gerade preist mir ein bekannter Buchverschicker Runen eines gewissen Elías Snæland Jónsson an …
Óttar Martin Norðfjörð: Das Sonnenkreuz (Solkross, 2008). Roman. Deutsch von Richard Kölbl. Berlin: Aufbau Taschenbuch 2011. 442 Seiten. 9,99 Euro. Zur Verlagsseite des Autors.

 Gut!
Gut!
(JF) Als die pensionierte Gymnasialprofessorin Leupold bei dem Versuch, eine defekte Glühbirne in ihrem Jugendstilleuchter auszuwechseln, vom Tisch stürzt und sich dabei so unglücklich verletzt, dass jeder Rettungsversuch zu spät gekommen wäre, mag so mancher nicht an einen Unfall glauben. Schließlich weiß die ganze Nachbarschaft der Leupold’schen Villa um die Geldnöte des missratenen Enkels der alten Lehrerin. Dass dieser längst seine brotlose Künstlerlaufbahn zugunsten eines florierenden Geschäftes mit illegalen Substanzen, die seine einst Chemie und Physik unterrichtende Großmutter in einem Kellerlabor herstellt, aufgegeben hat, ist ein Geheimnis, das der ausgesprochen souverän agierende Erzähler in Christian Mährs großartigem Roman „Das unsagbar Gute“ zunächst nur mit uns Lesern teilt. Wir befinden uns also in einer Art Krimi, was auch den Umstand erklärt, dass es bald zu weiteren Todesfällen, von denen einige Zufall und andere geplant sind, kommt. Außerdem erfahren wir allerhand Wissenswertes über das Wesen von Katzen und die theologischen Aspekte ihres Verhältnisses zum Menschen. Den Roman beschließt eine Art Happy End, das allerdings, wie im Genre üblich, nicht das gesamte Figurenensemble einschließt. Und wir haben uns ausgesprochen prächtig über dieses neuerliche Beispiel skurriler österreichischer Krimikunst amüsiert.
Christian Mähr: Das unsagbar Gute. Roman. Wien: Deuticke 2011. 319 Seiten. 17,90 Euro. Die Verlagsinformationen zum Buch.

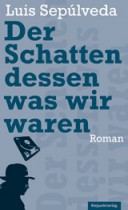 Oh, neee
Oh, neee
(TW) Den Kalauer kann ich mir nicht versagen: Verglichen mit dem „Tagebuch eines sentimentalen Killers“ wirft Sepúlvedas neuer Roman höchstens noch ein Schatten früherer Qualität.
Was so genau nicht stimmt, denn auch „Die Spur führt nach Feuerland“ und andere Texte von ihm litten schon an denselben Untugenden wie das aktuelle Buch: an redundanter muchomacho Nostalgie.
So auch hier: Abgehalfterte chilenische Linke, revolutionäre Bankräuber (drei an der Zahl, die auf Godot, nein, auf einen vierten Mann warten), im Widerstand gegen Pinochet zerschlissen, exiliert und jetzt wieder in ein neoliberales Chile zurückgekehrt, kommen mit dem neuen Leben nicht klar. Sie räsonieren, hängen nostalgischen Gedanken nach, zitieren pausenlos alte Sentenzen und Sprüche von Stalin, Lenin, Ho Chin Minh und Co., betrauern den Che und tapern durch eine mit historischen und potentiellen Raubüberfällen, viel unnötigem Hühnerzuchtwissen, versehentlichen Toten und anderen Vorkommnissen gespickte Welt. Vermutlich soll diese Welt grotesk erscheinen, komisch und abgedreht. Aber sie ist nur zäh und langweilig, unwitzig und unlustig. Und die historischen Ausflüge in die Zeiten der Allende-Regierung, des Putsches und der Diktatur lesen sich beinahe wie Opa erzählt von Stalingrad – alles schlimm gewesen, damals. Was denn sonst?
Luis Sepúlveda: Der Schatten dessen, was wir waren (La sombra le lo que fuimos, 2009). Roman. Deutsch von Willy Zurbrüggen. Zürich: Rotpunktverlag 2011. 196 Seiten. 18,00 Euro. Die Verlagsinformationen zum Buch.











