
Es choppen, dass die Fetzen fliegen – Tobias Gohlis (ToGo) George Pelecanos, Klaus Kamberger (KK) Christoph Leuchter, Kirsten Reimers (KR) Megan Abbott, Frank Göhre (FG) Sam Hawken, Frank Rumpel (rum) Émilie de Turckheim.
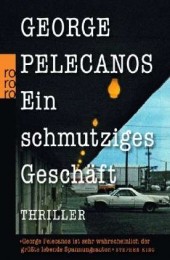 Schlechtes Geschäft
Schlechtes Geschäft
(ToGo) Stephen King und Lee Child können irren. George Pelecanos entpuppt sich in „Ein schmutziges Geschäft“ als ziemlicher Langweiler und nicht als „der größte lebende Spannungsautor“ (King). Und Lee Child soll diesen Start einer neuen Serie mit PI Spero Lucas als „Pflichtlektüre“ gelobt haben – für mich war Pflicht Last. Lästig: Personen werden durch Markennamen charakterisiert, das Buch liest sich wie ein Marathon durch eine Shoppingmall. Da sonst nix passiert: Wieviel kassiert George pro Erwähnung des iPhones? Bei 5 Dollar ca. 500.000.
Penetranter noch als der ebenfalls neu ins Rennen geschickte PI von Walter Mosley Leonid McGill leidet Spero unter einer extrem biederen Sozialarbeitermentalität. Er hilft gluckenhaft kleinen Jungs aus emotional verarmten Verhältnissen ins College-Leben und pustet halbdebile Wannabe-Gangster, die vor Bösartig- und Hässlichkeit nicht in den Spiegel gucken können und billige No-Name-Kleider tragen, in die Luft Washingtons. Immer Hausaufgaben machen und Schuhe putzen. Dann wirst Du braver Amerikaner. Von Sprache nicht die Rede. George muss sich beim Schreiben gelangweilt haben. Schlechtes Geschäft.
George Pelecanos: Ein schmutziges Geschäft (The Cut, 2011). Roman. Deutsch von Jochen Schwarzer. Reinbek bei Hamburg: rororo 2012. 583 Seiten. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch und zum Autor.

 „Literarisch“? Literarisch …
„Literarisch“? Literarisch …
(KK) Nicht jede Literatur ist literarisch. Doch das ist manchem Kreativling aus der einschlägigen Verlagswerbung offensichtlich schnurzegal. Wenn man dort meint, mal ein wenig für Distinktion sorgen zu müssen, kriegt das eine oder andere Produkt aus der hauseigenen Krimi-Küche gern das Prädikat „literarisch“ aufgepappt. Nur gut, dass man bei Steidl nicht derart peinlich die Backen aufbläst und das Debüt von Christoph Leuchter etwa als „literarischen Kriminalroman“ anpreist – was ihn übrigens davor bewahrt hat, beim Rezensenten gleich auf dem Nicht-wieder-Vorlage-Stapel zu landen.
So aber kann nun ein mit viel Witz und Atmosphäre aufwartender Kurz-Roman zur Lektüre empfohlen werden: kein „Krimi“ im gewohnten Sinne (auch wenn ein Toter, eine Rätsel aufgebende Todesart und ein überraschender Schluss nicht fehlen); statt dessen eine auf verschiedenen Ebenen spielende Geschichte: angesiedelt in einem auf sehr vitale Art aussterbenden Kaff in der Toskana, mit Protagonisten, die alle ein Leben und eine Geschichte haben – kurzum: ein kleiner, aber genauer Blick in nur scheinbar ganz normale Lebensumstände, deren Eigenart man erst ganz wahrnimmt, als ein Mann aus ihrer Mitte scheinbar ohne Grund an einem Scheunenbalken baumelt. Mord? Selbstmord? Aus welchem Motiv? Gab es da eine alte Schuld zu begleichen?
Schmerzhafte Erfahrung lehrt uns, dass viel zu viele Krimi-Plotter meinen, ihre Storys mit Rückgriffen in dunkle Vergangenheiten unheilschwanger aufmöbeln zu müssen. Ein allzu wohlfeiler Trick, um „Mystery“-Effekte zu produzieren. Nicht so Christoph Leuchter. Er geht einen anderen, zwingenderen Weg und schreitet mit seinen Protagonisten so einfühlsam wie sachlich vergangene, aber immer noch lebendige Ereignisse aus, wechselt dann wieder in eine auch nicht unschuldige Gegenwart und verklammert beides. Da dräut kein Fluch, da gebiert kein Schrecken neuen Schrecken, da erweist sich nur, dass auch dann Schuld entstehen kann, wenn es eigentlich an Vorsatz, böser Absicht oder gar schnödem Verrat eindeutig gemangelt hat.
Christoph Leuchter: Letzter Akt. Roman. Göttingen: Steidl Verlag 2012. 191 Seiten. 18,00 Euro. Zur Homepage des Autors. Verlagsinformationen zum Buch.

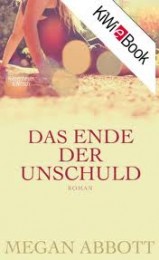 Das Ende von allem
Das Ende von allem
(KR) Lizzie und Evie sind die besten Freundinnen. Beide sind 13 Jahre alt, gehen in die gleiche Klasse, wohnen nebeneinander und teilen alles miteinander. Die Freundschaft ist so tief, dass Lizzie Evies Schmerzen fühlen kann. Und umgekehrt. Zwischen ihnen gibt es keine Lügen, keine Geheimnisse. Zumindest dachte Lizzie das. Bis Evie eines Tages verschwindet. Nun muss Lizzie sich eingestehen, dass ihre Freundschaft sich längst verändert hatte.
„Das Ende der Unschuld“ erzählt – konsequent aus Lizzies Sicht in Ich-Form – von Desillusionierungen und Verlusten, letztlich vom Erwachsenwerden. Zwar kehrt Evie nach einer Weile zurück, doch mit ihrem Verschwinden hat sich alles verändert: die Freundschaft der Mädchen und vor allem die Mädchen selbst. Denn die Erfahrungen, die beide in der Zwischenzeit gemacht haben, die Einblicke in das Leben hinter Fassaden und Masken, haben deutliche Spuren hinterlassen. Lizzie begreift, dass Liebe nichts mit ihren romantisch-verklärten Kleinmädchenträumen zu tun hat, sondern sehr komplex und schmerzhaft sein kann. Und dass die Dinge oft nicht so sind, wie sie scheinen – oder wie Lizzie sie haben möchte. Denn sie muss erkennen, dass sie ihre Erinnerungen zurechtgebogen und verfälscht hat – ähnlich, wie sie Beweise von Evies Entführung manipuliert hat.
So naiv Lizzies Weltsicht zunächst sein mag – der Roman selbst ist alles andere als romantisch-verklärend. Abbott gelingt es, die Dissonanz zwischen Lizzies Wahrnehmung und dem tatsächlichen Geschehen unangestrengt und glaubwürdig spürbar zu machen – und die gute Übersetzung von Isabel Bogdan bewahrt dies in der deutschen Ausgabe. Abbott wirft einen feinfühligen, aber nüchtern-unverstellten Blick auf das Verhältnis von Töchtern und Vätern, auf die Sehnsüchte und Fixierungen junger Mädchen und erwachsener Männer. Das Ergebnis ist ein ebenso sensibler wie verstörender und beunruhigender Coming-of-Age-Roman.
Megan Abbott: Das Ende der Unschuld (The End of Everything, 2011). Roman. Deutsch von Isabel Bogdan. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2012. 287 Seiten. 17,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

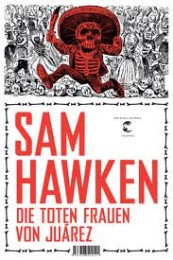 Die toten Frauen von Juárez
Die toten Frauen von Juárez
(FG) Kelly lässt sich von einem Mexikaner blutig schlagen. Kelly Courter ist Boxer. Er hatte in den Staaten ein Drogenproblem und ist über die Grenze nach Ciudad Juárez geflohen. Hier ist er auf die Vermittlung eines zwielichtigen Promoters angewiesen, um sich für ein paar Scheine im Ring ausnocken zu lassen. Er hat aber auch einen guten Kumpel. Der heißt Estéban, und Kelly vertickt mit ihm Speed an vergnügungssüchtige Touris. Mit Estébans Schwester Paloma hat er eine lockere Beziehung – aus der mehr werden könnte.
Das jedenfalls hofft man bis zum Ende der ersten 100 Seiten. Doch dann ist Paloma tot. Sie wurde misshandelt, sie wurde ermordet.
Paloma hatte sich bei einer Initiative zur Aufklärung der Frauenmorde in Ciudad Juárez engagiert. Seit 1993 – das ist die grausame Realität – wurden in der mexikanischen Grenzstadt an die 500 Frauen brutal ermordet und weitaus mehr sind spurlos verschwunden. Roberto Bolaño hat in seinem Mammutroman „2666“ (München, 2009) detailliert darüber geschrieben. Der Texaner Sam Hawken nimmt für sein Debüt „Die toten Frauen von Juárez“ diese nie aufgeklärten Fälle als Folie, um eine anfangs eher unspektakuläre Geschichte zu erzählen. Doch mit Palomas Tod entfaltet sie eine Wucht, die einem den Atem stocken lässt. Hawken wechselt von den absurderweise der Tat verdächtigten Freunde Kelly und Estéban zu dem einsamen und müden Ermittler Sevilla. Und der läuft mit vollen Risiko in einem Sumpf von Korruption und Gewalttätigkeit noch einmal zur früheren Form auf. Nicht alles endet gut. Sam Hawken aber ist ein eindrucksvoller und packender Roman gelungen. Harter Stoff. Neben seinen Agenten und Lektoren dankt er vor allem seiner Frau, „weil sie mein bester Schutz gegen schlechten Stil war“. Gratulation, Mariann Hawken, das ist gelungen!
Sam Hawken: Die toten Frauen von Juárez. (The Dead Women of Juárez, 2011) Roman. Deutsch von Joachim Körber. Stuttgart: J.G. Cotta´sche Buchhandlung Nachfolger, 2012. 320 Seiten. 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

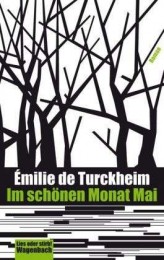 Rabenschwarze Sommergeschichte
Rabenschwarze Sommergeschichte
(rum) Einen kleinen und ziemlich bösartigen Roman hat die Französin Émilie de Turckheim mit „Im schönen Monat Mai“ geschrieben. Da empfängt der ehemalige Knecht von Monsieur Louis nach dem Selbstmord seines Chefs einige Gäste im Landhaus. Die meisten von ihnen waren vom Gutsbesitzer schon mal dorthin zur Jagd eingeladen worden, darunter ein Bordellbesitzer, ein ehemaliger Offizier, ein pensionierter Polizist und ein etwas schrilles Ehepaar namens Truchon. Sie sollen das Erbe des verstorbenen Monsieur unter sich aufteilen, müssen allerdings noch auf den Notar warten. Derweil stirbt Frau Truchon und liegt eine ganze Weile als Leiche im Wohnzimmer herum, bevor sich so ganz allmählich die Zahl der Gäste weiter dezimiert.
Die 1980 geborene Émilie de Turckheim hat das alles mit leichter Hand aus Sicht des Knechts Aimé geschrieben, der sich gerne etwas dümmer gibt, als er ist. Aber er weiß, etwas, das „Süß-Pence“ heißt, ist wichtig für so eine Erzählung und dazu gehört, nun aus Sicht der Autorin, zunächst das Setting: abgelegenes Landhaus, eine Tote und eine überschaubare Zahl von Gästen, respektive Verdächtigen. Man ahnt es schon: Eine komplett falsche Spur, die die Autorin da legt und mit rabenschwarzem Humor pulverisiert. Geschickt hält sie ihre Geschichte eines Rache-Feldzugs in der Schwebe, enthüllt nach und nach die einzelnen Puzzleteile und packt das alles in einen großartig naiven Ton. Zudem hat die Autorin einen ausgeprägten Sinn für groteske Momente.
„Wir schauen alle drei auf Frau Truchon, weil du kannst gar nicht nicht auf eine Leiche schauen, wenn eine auf dem Fußboden liegt“, heißt es da. Oder: „Wie soll man die tödliche Menge Gift in einer Kaffeetasse treffen, wenn man sein ganzes Leben lang barfuß durch den Gemüsegarten geht, damit man kein Insekt vom lieben Gott zertritt.“
Ein beschwingter Sommerroman, der eine üble Geschichte so unschuldig erzählt, dass es eine wahre Freude ist.
Émilie de Turckheim: Im schönen Monat Mai (Le Joli Mois de mai, 2010). Roman. Deutsch von Brigitte Große. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach 2012. 107 Seiten. 9,90 Euro. Zu den Verlagsinformationen.











