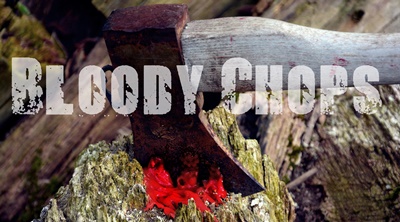Bloody Chops im August 2016
Zerteilt und serviert von: Joachim Feldmann (JF), Klaus Kamberger (KK), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW).
Über: Eric Ambler, Patrick DeWitt, Fjodor Dostojewskij, Nancy Isenberg, R.C. Kasasian, Philip Kerr, Asbjørn Jaklin, Patrícia Melo, Ottessa Moshfegh, Thomas Raab, Peter Walther und die Farm Security Administration, Robert Anton Wilson, S. Craig Zahler.
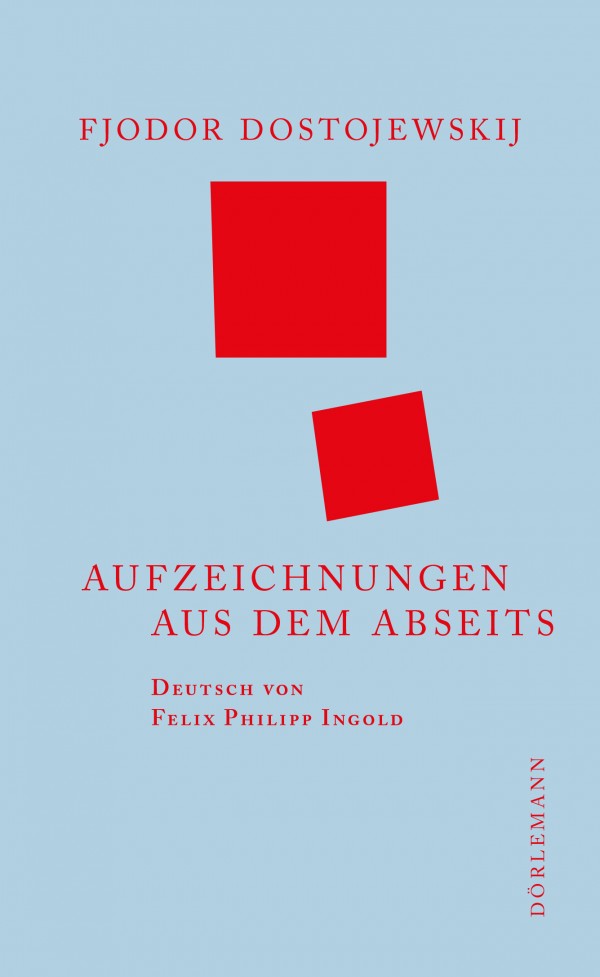 Wichtiger Text der Moderne
Wichtiger Text der Moderne
(AM) Ein immer noch ultimativ modernes Buch, das einem einen Faustschlag versetzen kann, das sind Fjodor Dostojewskijs „Aufzeichnungen aus dem Abseits“ von 1864. Seine erste große Erzählung, entstanden in einer Zeit von Krankheit, Verzweiflung und hohen Spielschulden (aus dem Kasino in Bad Homburg vor den Toren Frankfurts, wohin heute noch kulturbeflissene Russen pilgern und dann schaudern).
Man beachte: „Aufzeichnungen aus dem Abseits“, und eben nicht aus dem Kellerloch oder dem Untergrund, wie wir zu wissen und zu lesen gewohnt sind. Felix Philipp Ingold, ausgewiesener Kenner der russischen Moderne, der dieses Frühwerk Dostojewskijs jetzt neu übersetzt hat und dabei dessen Eigenarten mehr Rechnung zu tragen suchte, begründet in seinem Nachwort überzeugend diesen Paradigmenwechsel. Denn das ist es. Der Erzähler wohnt nämlich im Hochparterre, nicht in einem Keller, er gehört auch keinem irgendwie gearteten revolutionären Untergrund an, vielmehr ist er ein Mann im Abseits, der Welt und der Gesellschaft und vor allem der Moderne entfremdet. Gegenüber der Gleichmacherei und Anpassung versucht er sich zu behaupten: „Der Mensch braucht einzig und allein ein selbständiges Streben, egal, welchen Preis diese Selbständigkeit hat und wozu sie führt.“ Man darf heute hierbei auch an Amokläufer oder Selbstmordattentäter denken.
Kafkas „Verwandlung“, Saul Bellows „Herzog“, Philip Roths „Portnoys Beschwerden“, Martin Scorseses „Taxidriver“ und die Hälfte von Woody Allens Werk wären ohne Dostojewskijs Mann im Abseits nicht denkbar, hat der Filmkritiker Vincent Denby einmal bemerkt. Neben Diderots „Rameaus Neffe“ (1761 erschienen) und Flauberts „Madame Bovary” ( 1856) gelten die „Aufzeichnungen aus dem Abseits“ als der Beginn der literarischen Moderne. Nietzsche war einer der ersten Rezipienten, nannte das in zwei Teilen („Das Abseits“ und „Bei nassem Schnee“) daherkommende knapp 220seitige Werk einen „wahren Glücksgriff für die Psychologie“. Freud sog aus dem fiktiven Bekenntnis eines sich selbst zerfleischenden, sich an der Welt blutig reibenden, ruhelosen Mannes Honig für seine Neurosenlehre. Und es war die Vorbereitung für den Koloss „Schuld und Sühne“, kompromissloser in seiner scherbenhaften, schroffen Form. Ein Abgesang auch auf die Stadt der Moderne, eine Regenbeschwörung, wie sie sich auch Travis Bickle in „Taxidriver“ skandiert, „um all den Dreck wegzuwaschen“. Ein großes, wichtiges Buch, handschmeichlerisch und solide ausgestattet, von einem Verlag, der ein Herz für die russische Moderne hat. (Siehe auch den Bloody Chop zu Sigismund Krzyżanowskis „Der Club der Buchstabenmörder“.)
Fjodor Dostojewskij: Aufzeichnungen aus dem Abseits (Zapiski iz podpol‘ ja, 1864). Herausgegeben und aus dem Russischen neu übersetzt von Felix Philipp Ingold. Dörlemann Verlag, Zürich 2016. Leinen, 260 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
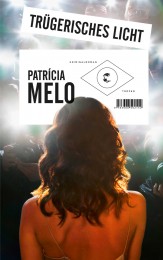 Wegwerfpenis
Wegwerfpenis
(TW) Für ihr Universum aus der allgemeinen ethischen Korrosion immerhin erstaunlich, setzt Patrícia Melo in ihrem neuen Roman „Trügerisches Licht“ auf ein paar reformatorische Kräfte in Brasilien. Dafür steht Azucena Gobbi, Chefin der Spurensicherung der Zivilen Polizei von São Paulo, vielleicht weil sie als erste Serienheldin Melos angelegt ist. Gobbi will sich nicht mit der allgegenwärtigen Korruption, der Indolenz, den Todesschwadronen und der offenen Klassenjustiz ihres Landes abfinden, auch wenn es für sie lebensgefährlich wird. Als sich ein Telenovela-Star auf offener Bühne erschießt, fängt sie zu graben an und macht dabei ein paar Fässer mit sehr unappetitlichem Inhalt auf. Aus biographischen Gründen kennt sich Melo bestens in der hemmungslosen Trash-Medien-Szene ihrer Heimat aus und unterzieht sie ihrem gefürchteten satirisch-ätzenden Blick. Eine Gestalt wie das TV-Sternchen Cayanne, die aus dem größten Schlamassel noch gute PR-Werte herausholen will, braucht vermutlich noch nicht einmal allzu viel Überzeichnung, um die Realität zu treffen. Genauso böse geht Melo mit den Hierarchien der Macht, dem Machismo (Gobbi hält sich als Antidot einen Liebhaber, den sie den „Wegwerfpenis“ nennt) und der ungeheuren sozialen Ungerechtigkeit des Landes um. An diesen Stellen schreibt sie gewohnt witzig, auf den Punkt und gnadenlos.
Leider tappt sie aber in diesem Buch ein bisschen arg in die Whodunit-Falle und verwickelt sich, im Bemühen, die Verdächtigen, die die Pistole des Stars mit echten Patronen geladen haben könnten, klassisch durch zu deklinieren, in etwas zäh geratene Befragungen, Nebengeheimnissen und falsche Spuren. Deswegen schliddert „Trügerisches Licht“ manchmal in die Nähe eines Häkelkrimis. Und den wollte Patrícia Melo eigentlich immer vermeiden. Leider ein etwas schwächeres Buch der hochgeschätzten Autorin, aber das darf ja mal vorkommen.
Patrícia Melo: Trügerisches Licht (Fogo-Fátua, 2014) Roman. Dt. von Barbara Mesquita. Stuttgart: Tropen 2016, 320 Seiten, € 14,95
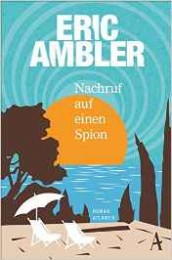 Haltbar für die Zukunft
Haltbar für die Zukunft
(AM) Stell dir vor, du bist im Urlaub an der französischen Riviera, du machst ein paar Fotos, du bringst den Film zum Entwickeln (ok, das muss man den Jüngeren erklären, was das war), und plötzlich steht die Polizei in deinem Hotelzimmer. Du hast angeblich Staatsgeheimnisse fotografiert. Um als staatenloser Flüchtling und bescheidener Sprachlehrer, der du bist, nicht eingesperrt und/ oder in ein immer chaotischer werdendes Europa abgeschoben zu werden, musst du Staatsschutzspitzel werden. Geheimagent wider Willen. Musst tun, was sie dir sagen. Musst in deinem Hotel herausfinden, wer der wirkliche Täter war, musst Grenzen überschreiten und Dinge wagen, an die du früher im Albtraum nicht gedacht hättest.
Das ist der Plot von Eric Clifford Amblers drittem Thriller. Geschrieben 1938, im Alter von 27 Jahren. Heute noch setzt dieses Buch unter Strom. Ganz ohne Schießereien, Bomben, Schlägereien und Verfolgungsjagd. Alleine die Szene, in der Josef Vadassy in ein Hotelzimmer eindringt, lässt einem die Haare zu Berge stehen. 1944 wurde das Buch als „Hotel Reserve“ verfilmt, mit James Mason in der Hauptrolle.
Ambler (1909 – 1998) wählt sich oft die Amateure, die kleinen Leute, zu Helden, zeigt uns aus deren Perspektive die Scharniere der Macht und wie leicht man sich dort die Finger einklemmt. Seine Romane werden nun wieder teilweise im Hoffmann und Campe-Verlag aufgelegt. Dass der vorliegende Band aber nicht einmal auf die anderen dort verfügbaren und noch kommenden Ambler-Bücher hinweist, ist einfach nur dumm. Klassikerpflege sieht anders aus.
CrimeMag hat Eric Ambler anlässlich der Wiederauflage von „Die Maske des Dimitrios“ einem Klassiker-Check unterzogen. Fazit: Fahrtauglich auch noch für die nächsten 50 Jahre. Wäre doch nur der heutige Thriller-Bau auf dem Niveau, das Ambler vorgelegt hat.
Und ich frage mich gerade, ob Camus wohl diesen Ambler-Roman gekannt hat. „Der Fremde“ (1942) beginnt mit: „Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht.“ Ambler hatte 1938 so vorgelegt: „Am 14. August, einem Dienstag, traf ich, aus Nizza kommend, in St. Gatien ein. Am Donnerstag, dem 16. August, um 11.45 Uhr wurde ich von einem Kriminalbeamten festgenommen und in Begleitung eines Polizisten auf das Kommissariat gebracht.“
Eric Ambler: Nachruf auf einen Spion (Epitaph for a Spy; 1938). Deutsch erstmals 1963 bei Fischer als Die Stunde des Spions. Diese Ausgabe folgt der von 1979 bei Diogenes. Aus dem Englischen von Matthias Fienbork. Atlantik Verlag/ Hoffmann und Campe, Hamburg 2016. 336 Seiten, 12 Euro.
Bei HoCa erschienen sind bereits: Die Maske des Dimitrios und Ungewöhnliche Gefahr. Im Januar 2017 kommen: Der dunkle Grenzbezirk und Dr. Frigo.
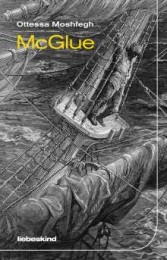 „What shall we do with the drunken sailor?“
„What shall we do with the drunken sailor?“
(AM) Was für ein Buch! Dieses Romandebüt, eine Novelle von 141 Seiten (im amerikanischen Original 118), ist ein Hurrikan. Ein sich in den Wellen aufbäumendes, bockendes Schiff, das einen umherwirft, dass die Sinne schwinden. Sturzbäche wild-schöner Sprache, kraftvoll und eindringlich, seltsam, rau und doch durchpoliert, eigenwillig, sinnlich, hypnotisch, und nirgends ein Mast, an den man sich binden oder klammern könnte, wie der Mann auf dem schönen Cover. Überhaupt ist die deutsche Hardcover-Ausgabe eine Freude. So macht man Bücher wertig. Die amerikanische Originalausgabe im Kleinverlag Fence-Books aus Albany (NY) wirkt dagegen wie eine dieser print-on-demand-Ausgaben, die einem schwarze Finger machen.
Otessa Moshfeghs „McGlue“ ist ein seltenes Juwel. Enigmatisch wie „Billy Budd“, Melvilles letzter Roman; verwandt auch der dunklen Seite Edgar Allen Poe und der gottlosen Welt des Robert W. Chambers (auf den sich „True Detective“-Autor Nick Pizzalotti beruft) und erst recht mit all dem Welthass dem Erzähler in Dostojewskjis „Aufzeichnungen aus dem Abseits“ (CM-Besprechung hier weiter oben). Wir sind im Jahr 1851, der Seemann McGlue sitzt im Gefängnis, er soll im Suff Johnson ermordet haben, seinen besten Freund. Aber ein Saufkopf, wie er einer ist, kann er sich an nichts erinnern, sein Schädel gespalten, seit er vor Monaten aus einem fahrenden Zug sprang, um nicht als blinder Passagier erwischt zu werden. McGlue will gar nicht nachdenken, will nichts wissen, und wird doch von Erinnerungen überschwemmt. Er will nur trinken, trinken, trinken: „Ich wollte meinen Namen ändern und mein Gesicht vergessen, und ich wollte trinken und meinen Kopf zugrunde richten …“ Wie Alfred Tutein in Hanns Henny Jahns „Fluss ohne Ufer“ weiß er: Ich könnte es gewesen sein. Warum aber den besten Freund erschlagen, was ist das für ein Tier in uns? Manchmal vergisst McGlue, dass Johnson tot ist. Manchmal besucht Johnson ihn in seiner Zelle.
Ottessa Moshfeghs Text – furios übersetzt von Anke Caroline Burger – ist ein existenzialistisches Drama von drängender Unmittelbarkeit, ein sich überschlagender Monolog aus Erinnerungsfetzen und Phantasmagorien, eine Liebesgeschichte. Und eine Tragödie, deren Erzähler wir so schnell nicht vergessen werden. Sehr flapsig gesagt, lässt der Plot sich auf den Refrain eines Seemans-Shantys eindampfen: „What shall we do with the drunken sailor?“ Auch das hat man ja nie wieder vergessen können. Der Verlag zitiert die „Washington Post“ mit: „Ottessa Moshfegh ist wohl das nächste große Ding.“ Die in Boston lebende Autorin kroatisch-persischer Herkunft, mehrfach hochkarätig für ihre Kurzgeschichten ausgezeichnet, ist tatsächlich eine aufregend neue, kräftige und originelle literarische Stimme. Ihr erster „richtiger“ Roman, „Eileen“ aus dem Jahr 2015, ist ein Noir der Extra-Klasse (angesiedelt in den frühen Sechzigern, mit einer jungen Frau in einem Jugendgefängnis) und steht gerade auf der Longlist des „Booker Prize“. Seit der Nacht dieser Nominierung ist meine US-Erstausgabe plötzlich 200 Dollar wert. Tendenz steigend. Aber nicht nur deswegen muss der Verlag Liebeskind diese Autorin weiter pflegen. Sie ist tatsächlich das nächste große Ding.
Ottessa Moshfegh: McGlue (2014, bei Fence Books, USA). Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Verlag Liebeskind, München 2016. Gebunden,144 Seiten, 16 Euro.
 Tote Tauben in der North Ganson Street
Tote Tauben in der North Ganson Street
(JF) Es gibt Dinge, die lassen die Kleinstadt Victory im US-Bundesstaat Missouri geradezu normal erscheinen. In der Eingangshalle des Krankenhauses müffelt es nach Urin und in der Pathologie nach „Käse und Exkrementen“, während der Flur einer Sozialwohnung „einen sauren Geruch nach Fürzen und Cheddar“ verströmt. Außerdem ist es furchtbar kalt. Viel zu kalt für Detective Jules Bettinger aus Arizona, der nach Victory strafversetzt wurde. Aber all das ließe sich aushalten, handelte es sich bei der Stadt nicht um einen wahren Pfuhl des Verbrechens. Um die 70 Prozent der männlichen Einwohner, so klärt Polizeichef Zwolinski den Neuzugang auf, seien vorbestraft, was wiederum bedeute, dass jeder Polizist in seinem Revier für „mindestens 700 Kriminelle zuständig“ sei, „von denen 400 bis 500 Gewalttaten begangen“ hätten. Kein Wunder, dass Bettingers neue Kollegen, vorsichtig formuliert, ziemlich eigenwillige Methoden der Verbrechensbekämpfung entwickelt haben. Wer sich unwillig zeigt, eine Aussage zu machen, bekommt schon mal eine der toten Tauben, die massenhaft in der Stadt herumzuliegen scheinen, in den Mund gestopft. Und das ist noch vergleichsweise harmlos.
Schon bald weiß Bettinger, der sich sinnvollerweise mit seiner Familie im 80 Meilen entfernten Stonesburg niedergelassen hat, warum die Lage in Victory so viel schlimmer ist als in anderen Teilen dieser vom industriellen Niedergang gebeutelten Region. Das fein austarierte Verhältnis zwischen dem organisierten Verbrechen und der Staatsgewalt ist ins Rutschen geraten. Wer genau sich nicht mehr an die Spielregeln gehalten hat, ist wahrscheinlich Ansichtssache, doch dass der lokale Gangsterboss Sebastian Ramirez als Schwerstpflegefall im Rollstuhl sitzt, seit er von Polizisten zusammengeschlagen wurde, lässt sich nicht leugnen. Nun scheint er auf Rache aus zu sein, denn anders lässt sich die Serie Mordserie, mit der Victorys Polizeitruppe systematisch dezimiert wird, kaum erklären. Und schon bald ist von Bettingers professioneller Distanz nicht mehr viel übrig, im Gegenteil.
Craig Zahlers Thriller „Die Toten der North Ganson Street“ beginnt wie eine klassische Polizeistory, gewürzt mit taffen Dialogen, finsterem Humor und starken Metaphern, entwickelt sich aber spätestens auf den letzten 150 Seiten zu einem aktionsgeladenen Stück Kriegsberichterstattung. Bettinger, vormals ein cooler Kriminalist mit losem Mundwerk, agiert als gnadenloser Rächer, der die einem der Gangster abgenommene, schusssichere Teufelsmaske nicht nur zur Tarnung trägt. Ein bisschen viel Symbolik, mag mancher denken, doch eigentlich nur konsequent für einen Roman, der sich nicht damit zufrieden geben mag, nur eines der möglichen genrespezifischen Handlungsmuster neu zu interpretieren. So bleibt man als Leser nachhaltig verunsichert, und das ist nicht das Schlechteste, was man über ein Buch sagen kann.
S. Craig Zahler: Die Toten der North Ganson Street (Mean Business on North Ganson Street; 2014). Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Mrugalla und Richard Betzenbichler. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 496 Seiten, 9,99 Euro.
 Grundlagenarbeit an einem tabuisierten Thema
Grundlagenarbeit an einem tabuisierten Thema
(AM) Nicht nur bei Donald Trump, auch in vielen crime novels nimmt die in den USA „White Trash“ genannte Gesellschaftsschicht eine wichtige Rolle ein. Man denke an Vicki Hendricks, an Daniel Woodrell, an all die Autoren des „country noir“, an Hammetts proletarisches Poisonville oder aktuell an Donald Ray Pollocks „Die himmlische Tafel“. Die Historikerin Nancy Isenberg, die bereits den amerikanischen Gründervätern unter die schmutzigen, raffgierigen Fingernägel geschaut hat („Fallen Founder: The Life of Aaaron Burr“ und „Madison and Jefferson“), holt nun – passender könnte das in diesem US-Wahljahr nicht sein – eine verdrängte, verleugnete und immer wieder verharmloste dunkle Seite Amerikas ans Tageslicht. „Wir haben es gelernt, die Tatsache zu übersehen, dass Privilegien tief in unsere Geschichte eingeschrieben sind und dass wir sie für normal halten“, schreibt sie als wäre es auf Donald Trump gemünzt, der sich als Superreicher zum angeblichen Schutzpatron der Benachteiligten aufgeschwungen hat und dem die das auch glauben, wo wir doch alle wissen, dass ihm der „White Trash“ nach dem Wahltag wieder herzlich egal sein wird. Unser USA-Korrespondent Thomas Adcock weist darauf immer wieder hin.
Nancy Isenberg zeigt historische Kontinuitäten auf, zeigt, wie tief Amerika immer schon seine Unterschicht gehasst und verachtet hat, allen Beteuerungen von FreiUndGleich zum Trotz, dies ohne Unterbrechung seit dem 17. Jahrhundert. „Den Rassismus begreifen wir heute als hässliche Pestbeule unserer nationalen Identität“, meint die Autorin, „Zeit, dass wir auch unserem Klassenhass ins Auge sehen.“
Nancy Isenberg untersucht dazu die politische Rhetorik und Politik, die populäre Kultur und die wissenschaftlichen Theorien aus vier Jahrhunderten.
Ihr grundlegendes, sehr lesbares, mit vielen Beispielen glänzendes Buch steht auf den Schultern des – ich sage es wieder einmal – hierzulande schmählich unbekannten Kulturwissenschaftlers Richard Slotkin, der in drei großen Büchern den Gewalt-Charakter der Vereinigten Staaten von Amerika seziert hat:
Regeneration Through Violence: the Mythology of the American Frontier, 1600-1860 (1973);
The Fatal Environment: the Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890 (1985);
Gunfighter nation: the Myth of the Frontier in Twentieth-Century America (1992).
Nancy Isenberg: White Trash. The 400-Year Untold History of Class in America. Viking Penguin, New York 2016. 460 Seiten, $ 28,00.
 Die Nachtseite Amerikas
Die Nachtseite Amerikas
(AM) Der Schwarze (Börsen-) Freitag vom 24. Oktober 1929, dazu Überproduktion, Dürre und andere Naturkatastrophe rissen in den 1930er Jahren eine buchstäblich tiefe Furche durch die ganze USA, von Kanada bis Texas. Den Bewohner der sogenannten Dust Bowl blieb nichts anderes als die Landflucht, alleine 1936 verließen dort zweieinhalb Millionen Menschen ihre Heimat. John Steinbeck, John Ford und Woody Guthrie haben das in Literatur und Film verewigt, und es gab eine Reihe sozialdokumentarischer Fotografinnen und Fotografen, die genau hinsahen, dies sogar im Regierungsauftrag, nämlich für die 1935 gegründete Farm Security Administration (FSA). (Bei einem späteren Ableger übrigens verdiente sich Ross Thomas seine ersten publizistischen Sporen, aber das ist eine andere, dann nächstes Jahr erstmals bei CrimeMag erzählte Geschichte.)
Mehr als 40 Fotografen waren unter Leitung von Roy Stryker zwischen 1935 und 1943 für die FSA unterwegs und dokumentierten mit ihren Kameras Roosevelts Beweggründe für seinen „New Deal“, ein gigantisches Umsiedlungs- und Beschäftigungsprogramm, das man heute wohl sozialistische Planwirtschaft nennen würde. Roy Strykers Anliegen war es, für nachkommende Generationen ein Zeitbild des ländlichen Amerika an der Schwelle zur Moderne zu überliefern. Es entstanden – mit einer Haltung zu den Motiven, die man als „teilnehmende Beobachtung“ beschreiben könnte – zehntausende Aufnahmen vom Leben auf dem Land sowie in den Klein- und Großstädten der USA, heute ein kultureller Schatz sondergleichen. Davon am ehesten bekannt ist wohl Walker Evans‘ Gemeinschaftswerk mit James Agee über drei Farmerfamilien: „Preisen will ich die großen Männer“ (Let Us Now Praise Famous Men, 1941).
Zu einem unfassbar günstigen Preis und in gewohnt brillanter Druckqualität bietet Taschen nun ein gut 600 Seiten starkes Kompendium dieser FSA-Fotografien, unter den rund 400 Abbildungen auch viele der erst 2004 bekanntgewordenen Kodachrome-Farbdias, ergänzt mit einem informativen Vorwort von Peter Walther, einem Register und Kurzporträts der Fotografen von Esther Bubley, Jack Delano, Walker Evans, Dorothea Lange, Gordon Parks, Louise und Edwin Rosskam, John Vachon, Marion Post Wolcott und anderen. Ein wichtiger Fotoband – und mit all den Porträts von Bergleuten, Baumwollpflückern, Stahl- und Farmarbeitern, Strafgefangen, Obdachlosen, hungernden Müttern und Kindern auch so etwas wie eine Ergänzung zur oben vorgestellten Studie „White Trash“ von Nancy Isenberg.
Farm Security Administration/ Peter Walther: New Deal Photography. USA 1935 – 1943. Verlag Benedikt Taschen, Biblioteca Universalis, Köln 2016. 608 Seiten, ca. 400 Abb., 14,99 Euro. Verlagsinformationen und Beispielbilder.
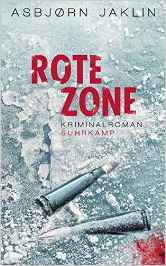 Einer großen Sache auf der Spur
Einer großen Sache auf der Spur
(JF) Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts entwickelte der Kalte Krieg eine hochgefährliche Dynamik. US-Präsident Reagan setzte auf eine Politik der Härte gegenüber dem Warschauer Pakt, was wiederum den neuen Generalsekretär der KPDSU Andropow in seiner Überzeugung bestärkte, dass ein nuklearer Erstschlag gegen die Sowjetunion geplant sei. Dass es in dieser angespannten Situation im November 1983 zu einem Atomkrieg zwischen den Supermächten hätte kommen können, weiß man, seit vor zweieinhalb Jahren entsprechende Geheimdokumente der NATO an die Öffentlichkeit gerieten. Einen konzisen Abriss der damaligen Bedrohungslage liefert das Nachwort des norwegischen Autors Asbjørn Jaklin zu seinem Thriller „Rote Zone“. Dass es sich gleichzeitig um den spannendsten Text in diesem Buch handelt, war sicherlich nicht seine Absicht. „Rote Zone“ spielt im Jahre 2010. Der ehemalige Elitesoldat Alexander Winther, seit einem Afghanistan-Einsatz schwer traumatisiert, versucht sich als Reporter bei einer Lokalzeitung im nordnorwegischen Tromsø. Durch Zufall stößt er auf eine Reihe mysteriöser Todesfälle unter den ehemaligen Piloten einer Kampffliegerschwadron der britischen Kriegsmarine. Schon bald, wir befinden uns auf Seite 72 des Romans, schwant ihm, dass er „einer großen Sache auf der Spur“ ist. Die Vermutung bestätigt sich, als ein Rundfunkjournalist, der ihn mit Informationen versorgt hat, bei einem heimtückischen Anschlag schwer verletzt wird. Winther fliegt nach Schottland, um die noch lebenden Angehörigen der Schwadron zu befragen. Hier gelingt ihm das verblüffende Kunststück, einen Mann anzurufen, der, wie wenig später betont wird, gar kein Telefon besitzt. Zurück in Tromsø will man dem Journalisten noch zweimal ans Leben, dann ist der Roman an seinem Ende angelangt und wir wissen, dass auch mit pensioniertem Militärpersonal nicht zu spaßen ist.
Wie sein Held arbeitet Asbjørn Jaklin für die Tromsøer Zeitung Nordlys und hat sich vor allem mit historischen Sachbüchern einen Namen gemacht. Seit einiger Zeit verfasst er auch Kriminalromane mit geschichtlichem Hintergrund, „Rote Sonne“ ist sein zweiter, wenig überzeugender, Versuch im Genre. Standardfiguren bevölkern einen sprachlich uninspiriert in Szene gesetzten Standardplot. Und das ist leider sehr, sehr langweilig.
Asbjørn Jaklin: Rote Zone (Rød Sone; 2014).Kriminalroman. Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 348 Seiten, 9,99 Euro.
 Es war einmal, und das in einem fernen fernen Land ….
Es war einmal, und das in einem fernen fernen Land ….
(AM) In den heutigen ernsten Zeiten ist solch ein Buch ein legitimer Eskapismus – für Leser wie Autor. Es ist so schräg und aus der Zeit gefallen, dass mir beim Lesen immer wieder der zum Schmunzeln und Kichern komische Roman Polanski als tumber Gehilfe in „The Fearless Vampire Killers“ (Tanz der Vampire, 1967) eingefallen ist – und wie er, über den Wassern schwebend, durch die schlimmsten Gefahren stolperte.
Nein, Vampire gibt es nicht, in Patrick DeWitts „Der Diener, die Dame, das Dorf und die Diebe“, aber sein Held, der 17jährige Lucien Minor, genannt Lucy, ist von ähnlichem Kaliber. Ein gar grüner Heinrich in einem vergangen, irgendwie großösterreichischen Balkan-Ambiente, das auch in einem Film von Wes Anderson („Grand Hotel Budapest“ u.a.) um die Ecke kommen könnte.
Patrick DeWitt, 1975 in Kanada geboren, nennt unter anderem Italo Calvino, Knut Hamsun, Werner Herzog, Robert Walser, Shirley Jackson und Bohumil Hrabal als Inspirationsquellen dieses der Phantastik zuzurechnendes Kriminal- und Schelmenromans. „Unklassifizierbar“ heißt dafür heute die geläufige Kategorie.
Minor bedeutet der Kleinere. Undermajordomo Minor, so etwas wie Hauptunterkammerherr, wird der 17jährige Lucy nach einer Eisenbahnfahrt (nein, ohne Vampire, aber Polanski lässt dennoch grüßen) durch die Berge im Schloss eines merkwürdigen Barons. Davor freilich ist er nach nur vier Romanseiten schon ein Junge, der dem Tod begegnet ist und uns als Lügner eingeführt wird. Wem also trauen? Seinem Vorgesetzten Mr. Olderglough etwa, einem abstrus mysteriösen Kammerherrn? Oder Memel, dem notorischen Dieb, der ihn auf der Bahnfahrt ausraubte, später aber sein Freund wird? Klara, die Betörerin, wohnt unter seinem Dach. Ihretwegen legt Lucy sich sogar mit dem Soldaten Adolphus an. „Welch ein brutales Ding ist doch die Liebe“, heißt es dazu. Merkwürdige Gestalten zuhauf, die Militärmänner in den seltsamen Uniformen (schön beschrieben) erinnern von fern an die Grenzwächter aus Dino Buzzatis „Tartarenwüste“.
Die Kapitelüberschriften sind ebenso barock wie die Windungen der Narration oder mancher Ausdruck. Das brennt das Feuer der Redlichkeit, da kommt beim Ausklopfen einer Pfeife eine pelziger Klumpen zum Vorschein, der an eine verkohlte Fledermaus erinnert, und das Schloss hat natürlich Korkenziehertreppen. Da gibt es als Cliffhänger wie etwa ein sich hinziehendes Lokführerschicksal, da geht es um Töten, ohne selbst getötet zu werden. Schon die erste Seite transportiert uns in eine „heimelige Kate“, später sind wir Zeugen von „Unaussprechlichkeiten“ oder gar „grässlicher Begebenheiten“. Der Adel vergnügt sich auf so irrwitzig obszöne Weise, dass dann auch der Sturz in ein großes Loch und eine völlige Verschiebung der bis dahin ausgerollten Schicksale möglich ist. An einer Schnur lässt Lucy sich von einem laichhungrigen Fisch flussaufwärts und wieder an die Oberfläche führen. Liebe, Verlangen, Verbrechen und Erlösung, in solch einem Kosmos ist alles möglich. Das Fingerschnipsen eines Autors genügt, der uns 2011 schon die Western-Killertravestie „Die Sisters-Brothers“ beschert hat.
Patrick DeWitt: Der Diener, die Dame, das Dorf und die Diebe (Undermajordomo Minor; 2015). Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen. Goldmann Manhattan, München 2016. 346 Seiten, 17,99 Euro.
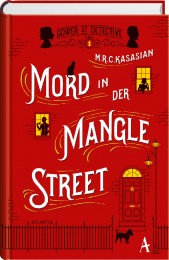 Allein es fehlt der Funke
Allein es fehlt der Funke
(JF) Englands berühmtester Detektiv ist ein eitler selbstsüchtiger Patron. Und ob es mit seiner Genialität wirklich so weit her ist, wie er selbst gern behauptet, lässt sich mit Fug und Recht bezweifeln. Schließlich ist er mit dafür verantwortlich, dass ein wahrscheinlich Unschuldiger wegen Mordes hingerichtet wurde. Selbst sein Mündel March Middleton, eine pfiffige 21-Jährige, die mehr von der Welt gesehen hat, als ihr lieb sein konnte, ist davon überzeugt, dass der exzentrische Vegetarier und Milchverächter ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ihn selbst lassen diese unangenehmen Lebensumstände seltsam unberührt. Schließlich ist mangelndes Selbstbewusstsein der letzte Charakterfehler, den man Sidney Grice vorwerfen könnte.
Wieder einmal muss Sherlock Holmes Pate für einen fiktiven Ermittler stehen. Schauplatz ist London im Jahre 1882, ein für den Großteil seiner Bevölkerung unwirtlicher Ort. Und gefährlich obendrein. Vor allem vor den Pferden solle sie sich hüten, bekommt die junge Miss Middleton gleich mehrfach gesagt, nachdem sie in der Metropole angelangt ist, die würden nämlich beißen. Doch eigentlich fürchtet sich die Tochter eines Militärarztes vor gar nichts mehr. Dass sie sich überhaupt in die Obhut von Sidney Grice, von dessen Existenz sie bis zum Tod ihres Vaters nie gehört hatte, begeben muss, liegt daran, dass sie erst mit 25 über ihr ganzes Erbe verfügen kann.
Soweit die Umstände, die dafür verantwortlich sind, dass erneut ein ungleiches Ermittlerpaar die kriminellen Abgründe des viktorianischen Englands erkunden darf. Dass March Middleton auch die Chronistin der Abenteuer, von denen in ihrem Herkunftsland bereits drei Bände vorliegen, abgibt, liegt in der Natur dieses literarischen Unternehmens. Dessen Urheber ist ein Herr namens Martin R. C. Kasasian, der dreißig Jahre als Zahnarzt tätig war, bevor er sich dem professionellen Schreiben zuwandte.
Bei uns ist nun Teil 1 der Reihe erschienen, im selben hübschen Retro-Cover wie das Original. Die Ingredienzien stimmen also. Die Mordgeschichte ist hinreichend schröcklich, die Ermittler geizen nicht mit skurrilen Eigenschaften, und sogar Sir Arthur Conan Doyle hat einen Gastauftritt. Allein, die Mixtur zündet nicht so recht, denn zwei für dieses Sub-Genre essentielle Bestandteile fehlen in der Rezeptur, und das sind Spannung und Charme. So liest man die Geschichte ohne rechte Anteilnahme zu Ende und ist nicht überrascht, dass Sidney Grice wahrscheinlich doch der großartige Detektiv ist, für den er sich hält.
R. C. Kasasian: Mord in der Mangle Street (The Mangle Street Murders; 2013). Aus dem Englischen von Johannes Sabinski und Alexander Weber. Atlantik Verlag, Hamburg 2016. 398 Seiten, 20 Euro.
 Keine elegante Bananenflanke
Keine elegante Bananenflanke
(KK) Jede noch so abgelegene Region hat bekanntlich schon ihren Krimi, und auch bei den Genres wächst marktkonform munter die Diversifikation. Neuerdings ist dort – nach Oper, Kloster, Oktoberfest etc. – der Fußball dran. Vorerst noch auf Champions- bzw. Premier-League-Ebene und nur ganz vorsichtig mal in politische Konnotationen hinüberschielend. (Aber warten wir’s ab; ist sicher nur eine Frage der Zeit, da kriegt St. Pauli seinen Zweit-Liga-Antifa-Serienmord und die Borussia ihr Attentat auf den politisch-korrekten Fanbetreuer.)
Bei Cotta (Tropen) ist gerade Philip Kerrs zweiter Fischzug im Elf-Freunde-Geschäftsfeld erschienen, und der Mann scheint das Milieu so richtig von innen zu kennen. Folglich kommen sie alle bei ihm vor, und sei es nur bei name dropping – von Lionel Messi bis Steven Gerard, von David Beckham bis Daxenberger, von Maurinho bis Fabio Capelli. Aber auch die Fans. Nicht zuletzt die Rassisten und die Schwulen-Hasser unter ihnen, die sich bekanntlich auf den Rängen wie Fußpilz ausbreiten. Und hinter den Kulissen die Agenten, die Intriganten, die Transfer-Profiteure, die Speichellecker und…und…und.
Kerr rührt das alles flott und unterhaltsam zusammen, nur verfügt er halt über so ein immenses Detailwissen, dass die Klammer, die das alles zusammenhalten soll, sich am Ende bloß als eine verbogene Sicherheitsnadel entpuppt. Bei einem Gastspiel des London FC in Griechenland gibt es einen Toten. Mord? Selbstmord? Auch ein Escort-Girl, das bei ihm horizontal vorbeigeschaut hat, wird später tot im Hafenbecken gefunden. Eine Verschwörung? Hat eine Fußball-Mafia die Finger im Spiel? Die Aufklärung des Falls nimmt gefühlte 25 von 400 Seiten des Romans ein, ansonsten geht es um Ränke der Vereine hier und Kabalen der Vorstände dort, um die Gier von Spielern (nach Geld und Weibern) und die Schrumpfgehirne von Aficionados und…und…und.
Die Story selbst (also die gefühlten 25 Seiten) hat leider nichts von einer eleganten Bananenflanke, die sich trickreich per Fallrückzieher zum Treffer verwandeln lässt, sondern verstolpert sich irgendwo weit draußen auf Höhe der Eckfahne. Also keiner Erwähnung wert. Laut Angabe des Verlags soll Kerrs erster Fußball-Krimi („Der Wintertransfer“) ein Bestseller gewesen sein. Wenn er so gut war wie dieser zweite, drängt sich nur noch die Frage auf: Wieso denn das nur?
Philip Kerr: Die Hand Gottes (Hand of God; 2015). Aus dem Englischen von Hannes Meyer. Tropen, Stuttgart 2016, 397 Seiten, 14,95 Euro.
 Bauern wurden für diesen Roman nicht zu Leberkäs verarbeitet
Bauern wurden für diesen Roman nicht zu Leberkäs verarbeitet
(JF) Viel Lob gibt es bereits für Thomas Raabs jüngst erschienene Kriminalgroteske „Der Metzger“, den siebten Band seiner Reihe um einen Restaurator und unfreiwilligen Ermittler eben dieses Nachnamens. Dem Autor bescheinigt man einen „dezenten Sinn für Humor“ (Weserkurier), „schrullige Herzlichkeit“ (Tiroler Tageszeitung) und „Sprachwitz“ (Tageszeitung Österreich), kurz „eine urösterreichische Art des Krimischreibens“ (Die Presse).
Tatsächlich wartet die blutige Satire auf den Literaturbetrieb und das Fleischerhandwerk mit einer Vielzahl kunstvoll gedrechselter Sätze auf, die zwar gelegentlich das Prädikat vermissen lassen – ein Stilmittel, das wohl Raabs Landsmann Wolf Haas in die Spannungsliteratur eingeführt hat – dafür aber mit rhetorischen Figuren aller Art aufwarten. Hier beispielsweise ist es die Personifikation: „Unmengen verschiedenster Würstel brutzeln da Haut an Haut, wie zu Ferragosto an der Adria in der prallen Hitze, und auch der schwitzende Laib Leberkäs kann sich inmitten seines gläsernen Schauofens über Isolation nicht beklagen.“
Wenn dann im Folgesatz darauf hingewiesen wird, dass in einem „Bauern-Leberkäs“, „zur Freude eines ganzen Berufsstandes“, keine Bauern verarbeitet seien, zeigt sich, dass der Wortwitz dieses Romans keine Grenzen kennt. Das kann man mögen. Unsereiner muss an Stellen wie diesen erst einmal die Lektüre unterbrechen, tief Luft holen und seinen Sinn für Humor überdenken, um dann, aller Bewunderung für das sprachliche Talent des Autors zum Trotz, das Buch zurück ins Regal zu stellen.
Thomas Raab: Der Metzger. Kriminalroman. Droemer, München 2016. 333 Seiten, 19,99 Euro.
 Lieber lachen … und immer schön dosieren
Lieber lachen … und immer schön dosieren
(AM) Die Freimaurer schäumten, weil sie sich nicht ernst genommen und in die merkwürdigsten Zusammenhänge gestellt sahen. Auch beziehe sich der einzige Literaturhinweis in ihrem Kapitel auf ein beinahe 150 Jahre altes Buch, monierte die Freimaurer-Wiki. Ganz ernst darf man das „Lexikon der Verschwörungstheorien“ nicht in jedem Punkt nehmen. Sein Autor Robert Anton Wilson (1932–2007), lange vor Dan Brown (der sich bei ihm großflächig bediente) durch die „Iluminatus“-Trilogie bekannt, zitierte gerne den Philosophen John Adams: „Bei wirklich tiefer Betrachtung der menschlichen Geschichte bleibt nur Weinen oder Lachen und ich lache lieber.“
Wilsons Enzyklopädie von 1998 hatte in der Originalausgabe ursprünglich 500 Stichpunkte, für die deutsche Ausgabe wurde auf etwa 350 Einträge verschlankt. Eine deutsche Ausgabe erschien im Jahr 2000 bei Eichborn; 2002 dann bei Piper, und wurde jetzt für den Frankfurter Westend Verlag von Mathias Brökers erneut aktualisiert. Aufschlussreich ist ein beigefügtes zehnseitiges Interview, das er 1999 mit Wilson führte. Themen dabei waren die vor der Jahrtausendwende deutlich vermehrten Verschwörungstheorien, die Ängste vor einer geheimen Weltregierung und das Ende der Kontrolle. Das Buch war und ist ein Teil der Gegenkultur wie auch teilweise deren auf den Arm nehmen.
Man sollte es sich bei Verschwörungstheorien eben schon zweimal überlegen, ehe man sie übernimmt. Klar gibt es Charles Darwins Evolutionstheorie, aber es gibt auch die Area 51. Klar gilt das heliozentrische Weltbild von Kopernikus, aber es gibt auch den Antichristen, so wie es Galileo Galileis Fallgesetze und Yin und Yang und vielleicht sogar die „Men in Black“ gibt. Gehörte Beethoven zu den Illuminati? Woher hat Mozart seine musikalischen Eingebungen? Waren es arabische Fundamentalisten, den Lady Di zum Opfer fiel? Und was alles treibt eigentlich die U.S. Army? Von den Männern, die auf Ziegen starren, wissen wir ja schon. Aber was ist mit diesen Hubschraubern am Himmel? (Siehe auch den CrimeMag-Ausflug „Verschwörung schlemmen in Rostock“.)
Kurzum, dieses Lexikon hilft, die Welt und manchen Krimiplot ein wenig besser oder auf ewige Zeiten nicht zu verstehen. Allerdings sollte man – zu viel Verschwörung macht meschugge – die Lektüre dosieren, dafür ist es ja ein Lese-Lexikon. Und ich würde mich nicht wundern, wenn genau dieses Buch das einzige wäre, das Donald Trump je gelesen hat. Oder wird.
Robert Anton Wilson: Lexikon der Verschwörungstheorien. Verschwörungen, Intrigen, Geheimbünde (Everything is under Control. Conspiracies, Cults, and Cover-ups; 1998). Aktualisierte Neuausgabe, hrsg. Von Mathias Brökers. Westend Verlag, Frankfurt 2016. Broschur, 302 Seiten, 18 Euro.